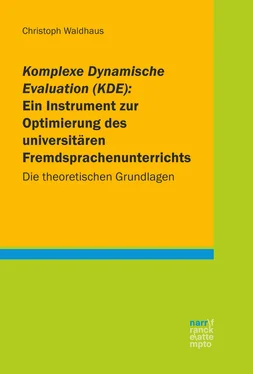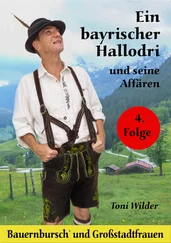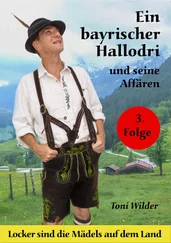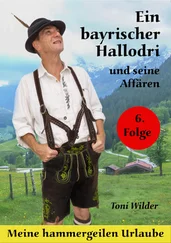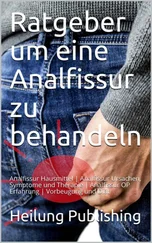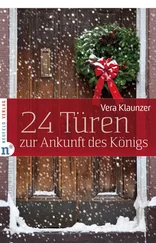1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 Im Bereich der Hochschulen werden die beiden Begriffe auch vielfach miteinander kombiniert, was dann als Qualitätsoptimierung durch Evaluation1 bezeichnet wird und das Herzstück dieser Arbeit bildet. Zahlreiche Verfahren, allen voran das Evaluieren von Lehrveranstaltungen (siehe Kapitel 3), haben sich hierzu mittlerweile auch im Bildungsbereich auf allen Ebenen etabliert. Obwohl das Evaluieren, spätestens seit es in den Hochschulgesetzen im deutschsprachigen Raum gesetzlich verankert ist (für Österreich siehe Kohler, 2009, für Deutschland siehe Schmidt, 2009 und für die Schweiz siehe Rhyn, 2009), einen fixen Bestandteil des universitären Qualitätsmanagements darstellt, ist es nach wie vor heftig umstritten und wird von manchen sogar als Evaluitis (Simon 2000, Frey 2007) bezeichnet.
Dies hat unterschiedliche Ursachen, die in den folgenden Kapiteln im Detail diskutiert werden. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle vorweggenommen, dass nach Analyse der Sachlage die Hauptgründe für eine Evaluitis in vielen Fällen relativ einfach auf den Punkt gebracht werden können: Sie entsteht vor allem dann, wenn Maßnahmen, die der Qualitätsverbesserung dienen sollen, mit wenig durchdachten Methoden durchgeführt werden, mit einem erheblichen Aufwand von Seiten der Beteiligten verbunden sind und gleichzeitig kaum ein sinnvolles und nachhaltiges Follow-up in Form von Verbesserungen nach sich ziehen.
Natürlich impliziert das hier Gesagte auch, dass Veränderungen, ganz besonders dann, wenn sie der Verbesserung dienen sollen, immer mit einem gewissen Aufwand verbunden sind. Dieser Umstand lässt sich nicht negieren. Es ist jedoch anzunehmen, dass Methoden der Verbesserung auf weniger Widerstand bzw. auf bessere Akzeptanz stoßen, wenn sie sich durch Effizienz und Effektivität auszeichnen und sich mit dem damit verbundenen Mehr an Arbeit für die Beteiligten auch eine tatsächliche Verbesserung einer suboptimalen Situation einstellt.
Ein zentrales Anliegen dieses Buches stellt daher auch die Entwicklung eines Evaluationsmodells dar, welches diesen Forderungen gerecht zu werden versucht und dadurch einer übermäßigen Evaluitis weitgehend entgegenwirken soll. Völlig verhindern kann man den mit qualitätsoptimierenden Maßnahmen verbundenen Mehraufwand jedoch nie, denn wie schon eine philosophische Beobachtung verdeutlicht: Ex nihilo nihil fit .
Bevor in den folgenden Kapiteln ausgeführt wird, welche Komponenten und Rahmenbedingungen ein Evaluationsmodell im Detail benötigt, damit es sich durch Effektivität und Effizienz auszeichnet, soll an dieser Stelle kurz auf die zentralen qualitätsoptimierenden Maßnahmen an Hochschulen eingegangen werden, da diese eine wichtige Basis für sämtliche weitere Ausführungen darstellen und ein Grundverständnis derselben für das Nachvollziehen vieler in diesem Buch beschriebenen Schritte essentiell ist.
2.2 Qualitätsoptimierende Maßnahmen an Hochschulen
An europäischen1 Universitäten wird seit gut zwei Jahrzehnten verstärkte Aufmerksamkeit auf qualitätsoptimierende Maßnahmen gerichtet, die auch nach außen transparent gemacht werden (müssen). Die Gründe hierfür sind vielfältig und hängen mit unterschiedlichen Faktoren zusammen, die seit Ende des zweiten Weltkrieges zu beobachten sind: Neave (vgl. 2012:3) nennt in diesem Zusammenhang die grundsätzlichen Veränderungen, die das Dreieck Regierung , Gesellschaft und Universität betreffen, und Weingart (vgl. 2003) spricht von einer generell stärkeren Bindung der Hochschulen an Politik, Wirtschaft und Medien.
Zudem kommen zu den traditionellen Aufgaben der Universitäten, die sich im Bereich der Forschung und Lehre befinden, neue Pflichten hinzu, die den Hochschulen im Interesse der Gesellschaft und/oder der Wirtschaft unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit auferlegt werden (vgl. Neave 2012:3). Weingart (vgl. 2003:110) bezeichnet diese sogenannte »dritte Mission« als kommerziell orientierten Innovationsmotor für die Industrie. Der damit in Verbindung stehende Druck auf Universitäten vergrößerte sich besonders auch in Europa durch die Lissabon-Strategie2, die darauf abzielte, die Europäische Union bis zum Jahr 2010 »zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum« der Welt zu machen.
Trotz dieser hier angeführten Veränderungen und dem damit vielfach einhergehenden Wandel hinsichtlich der Finanzierung der Universitäten beziehen öffentliche Hochschulen nach wie vor einen Großteil ihrer finanziellen Mittel aus staatlichen Ressourcenzuwendungen, wenngleich diese heute nicht mehr so bedingungslos sind wie etwa noch vor 30 Jahren. Als Ausnahmebeispiel für Finanzierung wäre hier das britische Hochschulsystem vor den 1980er Jahren zu nennen, welches sich, wie Pechar (2006:59) konstatiert, durch einen einzigartigen »Vertrauensvorschuss der Gesellschaft in ihr Hochschulsystem« auszeichnete, der den Hochschulen zum einen eine überwiegend öffentliche Finanzierung sicherte, sie dadurch vom Markt unabhängig machte und zum anderen diese öffentliche Basisfinanzierung nicht an staatliche Auflagen und Eingriffe knüpfte. Im Vergleich dazu sieht die Finanzierung der Hochschulen heute völlig anders aus. In der Regel sind die staatlichen Ressourcenzuwendungen mit den Hochschulen vertraglich vereinbart und die Universitäten müssen darlegen, wie sie die jeweiligen Gelder einsetzen. Pechar (2006) spricht in diesem Zusammenhang von einem Kurswechsel »vom Vertrauensvorschuss zur Rechenschaftspflicht«.
Zudem haben Krisen in staatlichen Haushalten in Europa seit den 1980er Jahren oftmals dazu geführt, dass die staatlichen Mittel für Bildungseinrichtungen gekürzt wurden (vgl. Mittag 2006:1). Diese Mittelkürzung ist aktuell auch im Zusammenhang mit der Eurokrise zu beobachten und schließt dabei auch Länder ein, die von der Krise bisher weitgehend verschont wurden. An dieser Stelle sei auch auf das Stichwort »Bildungsmilliarde« und die Abschaffung des eigenständigen Wissenschaftsministeriums in Österreich (2013) hingewiesen.
Mit den Kürzungen bei den öffentlichen Ressourcenzuwendungen geht auch die bereits genannte stärkere Bindung der Universitäten an die Wirtschaft einher. Kaum eine Universität kann aktuell auf Gelder aus Drittmittelprojekten oder auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Wirtschaft verzichten. Zwar pflegen in der Regel überwiegend technische Universitäten und Fachhochschulen einen sehr engen Kontakt zu Firmen, jedoch ist dies auch in vielen anderen Wissenschaftszweigen mittlerweile Usus geworden.
Nicht nur, dass wissenschaftliches Wissen zusehends zu einem »begehrten Gut« wird, »das die Privatwirtschaft zu kontrollieren sucht, um damit Profite zu machen«, wie Weingart (2003:103) feststellt, die »Wissenschaftspolitik drängt die Universitäten, sich enger an den Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren« (ibid. 2003:104), was sich aller Voraussicht nach auch durch die in Österreich durchgeführte Integration des Wissenschaftsministeriums in das Wirtschaftsministerium noch verstärken könnte. Dass dies nicht nur (negative) Auswirkungen auf viele Universitäten per se hat, sondern auch dramatische Konsequenzen für einige Forschungsbereiche nach sich ziehen kann, die wenig bis keinen Nutzen für die Wirtschaft haben, leuchtet ein.
Ein weiterer Grund für das knappe Budget vieler (öffentlicher) Universitäten ist ein starker Zuwachs an Studierenden, der unter anderem mit dem raschen Wachstum des Wissenschaftssystems in Verbindung steht, welches seit dem zweiten Weltkrieg in den Industrienationen zu verzeichnen ist und zum einen dazu führte, dass es zu einer Ausweitung der Eliteuniversitäten kam und zum anderen zu einer Verlagerung des Hochschulsystems der Eliteuniversitäten hin zu Massenuniversitäten, wie Trow (vgl. 2005:6) vermerkt. Ermöglichte letztere Entwicklung im Prinzip allen Bildungsschichten den Hochschulzugang, so erschwerte sie die finanzielle Situation vieler Universitäten dramatisch, da bei steigender Zahl der Studierenden die Finanzierung vielfach bestenfalls gleichblieb. Die in manchen Ländern immer wieder entfachte (politisch geführte) Diskussion hinsichtlich der Abschaffung, Beibehaltung oder (Wieder-)Einführung von Studiengebühren ist in dieser Hinsicht auch nicht besonders hilfreich.
Читать дальше