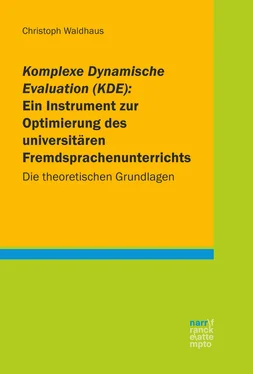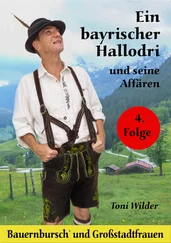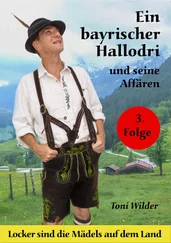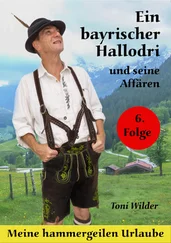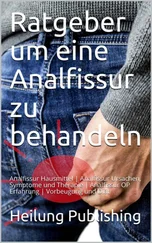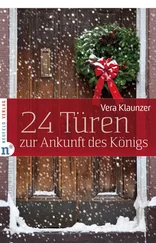1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Die Rechenschaftspflicht , die die Universitäten bzw. die Wissenschaft gegenüber ihren Geldgebern haben, gibt es zusehends auch gegenüber der Öffentlichkeit. Dies ist, wie Weingart (vgl. 2003:113) bemerkt, u.a. darauf zurückzuführen, dass die Universitäten bzw. die Wissenschaft zwar öffentlicher Gelder bedürfen, aber ihre Gegenleistungen für die Gesellschaft aufgrund der Ausdifferenzierung und Spezialisierung oft unverständlich bleiben. Demgemäß suchen die Hochschulen vermehrt die öffentliche Akzeptanz, wobei die Medien eine besonders wichtige, wenn auch nicht immer unumstrittene Funktion einnehmen. Unter dem Stichwort der Qualität bzw. der Qualitätsoptimierung , -verbesserung und -sicherung werden die Universitäten auch in der Öffentlichkeit in regelmäßigen Abständen evaluiert .
So gibt es beispielsweise Universitätsrankings, wie sie etwa vom Magazin Times Higher Education seit 2004 veröffentlicht werden, die die Qualität von Forschung und Lehre bewerten und in weiterer Folge die Hochschulen in verschiedene Ranggruppen einteilen. Die Ergebnisse werden dann üblicherweise in den Medien diskutiert, was den Druck und den Wettbewerb unter den Universitäten erneut verstärkt. Zweifelsohne wurde durch diese Rankings der Wettbewerb der Hochschulen untereinander bewusster und hat auch die Bedeutung dieser »Hitlisten«, wie sie Hommelhoff (vgl. 2008:9) bezeichnete, gesteigert, jedoch ist auch zu erwähnen, dass die Kriterien und Methoden bei der Erstellung der Rankings in der öffentlichkeitswirksamen Auswertung oft im Hintergrund stehen (vgl. ibid.).
Das Resümee, welches daraus gezogen werden kann, lässt sich aus Sicht der Hochschulen subsumieren unter monetärem Ressourcenrückgang von öffentlicher Seite, vielfach steigender Zahl der Studierenden, erhöhtem Wettbewerbsdruck, zunehmender Autonomie, stärkerer Bindung der Hochschulen an die Wirtschaft und vermehrtem Rechtfertigungsdruck gegenüber den GeldgeberInnen, der Gesellschaft und den Studierenden.
Neben diesen bisher genannten externen Faktoren, die die Universitäten von außen förmlich dazu zwangen, sich mit der Frage der Qualitätsverbesserung und -sicherung auseinanderzusetzen, ist auch ein Umdenken an den Universitäten selbst zu beobachten, eine Wandlung von innen . Waren viele Lehrende vor Jahren noch der Ansicht, dass Qualitätsmanagement, Evaluation, Akkreditierung etc. an Universitäten »unnötig« wären, oder etwa das »Tun« an Hochschulen in Frage stellen würden, wie Gaethgens dies in der Herbsttagung der HRK 2008 bereits feststellte, so wurde mittlerweile erkannt, dass man, will man im internationalen Wettstreit um Studierende bestehen, auf Qualitätssicherungsaktivitäten nicht verzichten könne. Ganz im Gegenteil, man muss aktiv Methoden und Einrichtungen schaffen, die sich mit Qualität an der Hochschule in ihrer Mannigfaltigkeit auseinandersetzen und diese auch sichtbar machen. Nicht zuletzt hängt vielfach davon das Budget – und bei kleineren Instituten sogar deren Überleben ab.
Stangl (o.J.) resümiert diesbezüglich treffend: »Wer zur Elite der Universitäten zählen will, unterwirft sich den Anforderungen des Qualitätsmanagements und dokumentiert diese für die Öffentlichkeit und vor allem für die Stakeholder gut sichtbar auf der Homepage der Universität«. Dabei müssen sich sämtliche dieser Qualitätssicherungsaktivitäten auf die gesamte Universität beziehen, sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Forschung und die Lehre.
Als Konsequenz wurden in den vergangenen Jahren unterschiedlichste Verfahren der Qualitätssicherung und -verbesserung an europäischen Hochschulen ein- und durchgeführt, die in Folge kurz besprochen werden, bevor im Anschluss daran konkret auf Qualitätsverbesserung auf Basis von Lehrveranstaltungsevaluation eingegangen wird.
2.3 Zentrale Maßnahmen im Detail
Qualitätssichernde Maßnahmen an Hochschulen im europäischen Raum waren zu Beginn vielfach wenig systematisch und wurden anfangs nur von einigen ExpertInnen thematisiert. Zudem waren diese von Staat zu Staat mitunter sehr verschieden, was nicht zuletzt auch auf die unterschiedliche Organisation der Universitäten zurückzuführen ist (vgl. The Danish Evaluation Institute 2003:7). Ein wesentlicher Schritt zu einer einheitlichen europäischen Lösung wurde in Zusammenhang mit der Schaffung des gemeinsamen europäischen Hochschulraums (siehe Bologna-Prozess) gesetzt.
Im »Kommuniqué der Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen und -minister am 19. September 2003 in Berlin« (2003:4) beauftragten die MinisterInnen jener Staaten, die den Bologna-Prozess unterzeichnet hatten, das »European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)« »über seine Mitglieder und in Zusammenarbeit mit der EUA1, EURASHE2 und ESIB3 ein vereinbartes System von Normen, Verfahren und Richtlinien zur Qualitätssicherung zu entwickeln, Möglichkeiten zur Gewährleistung eines geeigneten Begutachtungsprozesses (peer review4) für Agenturen und Einrichtungen zur Qualitätssicherung und/oder Akkreditierung zu prüfen und durch die Follow-up-Gruppe den Ministerinnen und Ministern bis 2005 darüber Bericht zu erstatten«. Zudem sollte die ENQA dabei »die Fachkenntnis anderer Verbände und Netzwerke für Qualitätssicherung« gebührend berücksichtigen (vgl. ibid.).
Im Zuge dessen erarbeitete die ENQA Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (ESG5) in Form interner und externer Qualitätssicherungsstandards für Hochschulen und externer Standards für Qualitätssicherungsagenturen, die zusätzlich zum bereits 1998 vorgeschlagenen »Vier-Phasen-Modell« (four-stage model) des Rates zum Einsatz kommen sollten. Das Vier-Phasen-Modell sieht im Wesentlichen vor, dass die qualitätssichernden Maßnahmen an den Universitäten intern (durch Selbstevaluation) und extern (durch unabhängige Agenturen und ExpertInnen) evaluiert werden und in Folge ein Bericht hierzu veröffentlicht wird.
2.3.1 Standards und Leitlinien (ESG)
Die ESG (Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum), die primär entwickelt wurden, um den Bedarf für ein gemeinsames Verständnis von Qualitätssicherung in Europa zu decken (vgl. The Danish Evaluation Institute 2009:6) bzw. einen gemeinsamen Referenzrahmen für Qualitätssicherung im europäischen Hochschulraum bereitzustellen (vgl. HRK 2015:10), bestehen sowohl in ihrer ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2005 (Originalfassung in Englisch, siehe ENQA 2005 bzw. Übersetzung ins Deutsche, siehe Alphei/Michalk 2006) als auch in ihrer überarbeiteten Fassung aus dem Jahr 2015 (siehe ENQA 2015 bzw. HRK 2015) inhaltlich aus folgenden drei Teilen:
1 Standards und Leitlinien für interne Qualitätssicherung;
2 Standards und Leitlinien für externe Qualitätssicherung;
3 Standards und Leitlinien für externe Qualitätssicherungsagenturen.
Erstere richten sich dabei an die universitätsinternen Maßnahmen der Qualitätssicherung, zweitere befassen sich mit jenen, die von den Qualitätssicherungsagenturen durchgeführt werden. Diese sollen überprüfen, wie wirksam die einzelnen Institutionen die Standards für die interne Qualitätssicherung umsetzen. Letztere stellen sozusagen eine Meta-Qualitätssicherung der Agenturen dar, damit gewährleistet wird, dass diese nach denselben Richtlinien prüfen . »Diese drei Teile sind inhaltlich aufeinander bezogen und bilden zusammen die Basis eines europäischen Referenzrahmens für die Qualitätssicherung« (vgl. HRK 2015:15) und stellen daher auch einen wichtigen Bezugspunkt bei der Evaluation der Lehrqualität dar. Für den Kontext der KDE sind primär die Standards und Leitlinien der internen Qualitätssicherung wichtig, weswegen an dieser Stelle näher auf diese eingegangen wird.
Читать дальше