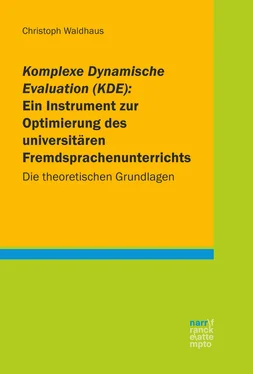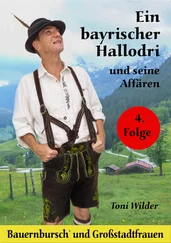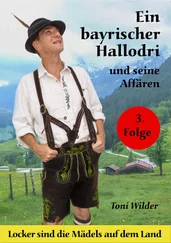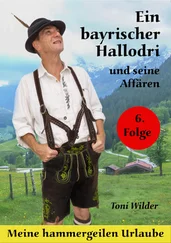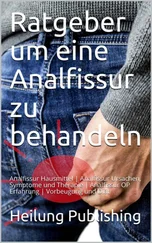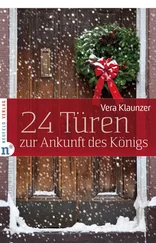2.3.1.1 ESG für interne Qualitätssicherung
Während die ESG 2005 generell allgemeiner und vielfach auch freier formuliert wurden, sind bei der Version aus dem Jahr 2015 für die interne Qualitätssicherung konkret folgende zehn Standards definiert (siehe: HRK 2015:41–43): (1) Strategie für die Qualitätssicherung, (2) Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen, (3) Studierendenzentriertes Lernen, Lehren und Prüfen, (4) Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Studienabschluss, (5) Lehrende, (6) Lernumgebung, (7) Informationsmanagement, (8) Öffentliche Informationen, (9) Fortlaufende Beobachtung und regelmäßige Überprüfung der Studiengänge und (10) Regelmäßige externe Qualitätssicherung.
Nach Analyse der einzelnen Punkte gestalten sich folgende acht Standards als besonders wichtig in Hinblick auf Qualitätsoptimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts durch Lehrveranstaltungsevaluation:
2.3.1.1.1 Strategie für die Qualitätssicherung
Das Qualitätssicherungssystem fördert eine kontinuierliche Verbesserung. Entscheidend ist somit, dass Qualitätsverbesserung im Unterricht nicht etwas Punktuelles ist, sondern ein Prozess, der kontinuierlich erfolgen soll. Zudem trägt dieses System »zur Bildung einer Qualitätskultur bei, in der alle internen InteressensvertreterInnen für die Qualität verantwortlich sind und auf allen Ebenen der Institution Verantwortung für die Qualitätssicherung übernehmen (HRK 2015:17)«. Dies schließt Lehrende und Studierende mit ein. Alle am Unterrichtsgeschehen haben daher nicht nur das Recht auf Qualität, sondern auch die Pflicht , sich aktiv an der Schaffung und Verbesserung von Qualität zu beteiligen und müssen ihre dementsprechenden Aufgaben wahrnehmen (vgl. ibid.).
2.3.1.1.2 Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen
Den Studierenden sollen nicht nur akademisches Wissen und Fähigkeiten vermittelt werden, sondern auch Schlüsselkompetenzen, »die die persönliche Entwicklung der Studierenden beeinflussen und für ihre spätere Berufslaufbahn nützlich sein können« (HRK 2015:19). Hierzu ist, wie im Kapitel zur Evaluation noch detailliert angeführt wird, auch die Selbstreflexionskompetenz zu zählen, da die Fähigkeit, über das eigene LernerInnenselbst zu reflektieren, als ein wesentlicher Aspekt der persönlichen Entwicklung von Studierenden anzusehen ist.
Des Weiteren wird gefordert, dass die Studiengänge und daher auch die einzelnen Kurse so zu gestalten sind, dass die gewünschten Lernziele klar definiert werden und sowohl die Studierenden aktiv an der Mitgestaltung beteiligt sind als auch andere externe Referenzpunkte genutzt werden.
2.3.1.1.3 Studierendenzentriertes Lernen, Lehren und Prüfen
Ein besonders wichtiger Punkt, der unter diesem Standard angeführt wird, betrifft die Durchführung der Studiengänge in der Form, dass die Studierenden ermutigt werden, »eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu übernehmen (HRK 2015:20)«. Somit wird ein verstärkter Wert auf studierendenzentriertes Lernen und Lehren gelegt, was, wie in den Leitlinien expliziert, »eine große Bedeutung für die Motivation, die Selbstreflexion und das Engagement der Studierenden während des Lernprozesses (ibid.)« hat. Als wichtige Punkte hierbei werden folgende genannt (HRK 2015:20):
»die Diversität der Studierenden und ihrer Bedürfnisse zu respektieren und ihnen durch flexible Lernwege Rechnung zu tragen;
wo es angebracht ist, unterschiedliche Vermittlungsweisen in Betracht zu ziehen und zu nutzen;
unterschiedliche pädagogische Methoden flexibel einzusetzen;
regelmäßige Evaluierungen und Anpassungen der Vermittlungsweisen und pädagogischen Methoden vorzusehen;
die Studierenden zu selbstständigem Lernen zu ermutigen und ihnen als Lehrer gleichzeitig angemessene Orientierung und Unterstützung zu bieten;
gegenseitigen Respekt in der Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden zu fördern;
ein angemessenes Verfahren für den Umgang mit studentischen Beschwerden bereitzustellen«.
Dieser Standard ist zentral in Hinblick auf Qualitätssicherung und darf daher in einem Evaluationsmodell, welches Daten zur Qualitätsoptimierung generieren soll, nicht fehlen. Wenn das Modell richtig konzipiert und eingesetzt wird und die Lehrenden die Rückmeldungen der Studierenden ernst nehmen und diese bei ihrer Unterrichtsgestaltung bzw. eventuell nötigen Adaption berücksichtigen, kann damit auch das Ausmaß an Beschwerden gering gehalten werden, denn Beschwerden kommen überwiegend dann zustande, wenn Probleme, auf die hingewiesen wurde, nicht gelöst werden bzw. die Studierenden überhaupt keine Möglichkeit haben, auf ein eventuell vorhandenes Suboptimum hinzuweisen. Das bedeutet auch, dass in einem qualitativ hochwertigen Unterrichtsgeschehen Probleme gezielt zu Tage gefördert und bearbeitet werden müssen.
2.3.1.1.4 Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Abschluss
Ein wichtiger Aspekt dieses Standards ist, dass Hochschulen Verfahren und Instrumente benötigen, »die es ihnen ermöglichen, Informationen zu den Studienverläufen zu erfassen, zu beobachten und diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen (HRK 2015:22). Dies zielt bei Fremdsprachenkursen – die sich vielfach durch Heterogenität der KursteilnehmerInnen auszeichnen – u.a. auch darauf ab, die Vorkenntnisse der LernerInnen zu ermitteln. Welche Kurse haben sie bereits besucht? Wie schätzen sie ihre eigenen Kenntnisse ein? Welche Lehr- und Lernmethoden sind ihnen geläufig und für sie besonders geeignet? etc.
Dieser Standard ist – zusammen mit jenem der Studierendenzentriertheit – meiner Lehrerfahrung nach besonders wichtig, denn viele Evaluationsmodelle berücksichtigen die veränderte Rolle der Lehrenden kaum oder gar nicht bzw. wird viel zu häufig nach wie vor die Lehrperson als Wissensvermittlungsinstanz evaluiert und dem Lernen der Studierenden zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus kann ein Evaluationsmodell auch so gestaltet sein, dass es den Lehrenden als didaktisches Hilfsmittel dient und sie – durch die richtige Art des Feedbacks – auch dabei unterstützt werden, ihre eigenen Lehrmethoden zu verbessern. Dadurch kann letztendlich auch die Lehrkompetenz gefördert werden, die auch eine zentrale Forderung der ESG darstellt.
Eine besonders wichtige Leitlinie dieses Standards wird wie folgt definiert:
»Die Bedürfnisse einer heterogenen Studierendenschaft (u.a. ältere, ausländische, berufstätige oder in Teilzeit Studierende sowie Studierende mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen) und die Ausrichtung auf studierendenzentriertes Lernen sowie flexible Lern- und Lehrmethoden werden bei der Zuteilung, Planung und Bereitstellung des Lernmittel- und Betreuungsangebots berücksichtigt« (HRK 2015:24).
Dies kann in Hinblick auf Qualitätssicherung so interpretiert werden, dass die Voraussetzungen der Studierenden bereits zu Beginn des Kurses in Erfahrung gebracht werden sollten, damit man diese als LehrendeR von Anfang an gezielt bei der Planung bzw. eventuell nötigen Adaption des Kurses berücksichtigen kann. Wer seine Gruppe kennt, kann einen für sie passenden Unterricht konzipieren.
2.3.1.1.7 Informationsmanagement
Zentraler Punkt dieses Standards ist, dass Universitäten relevante Daten erheben, analysieren und nutzen (vgl. HRK 2015:25). Evaluationsinstrumente können dabei eine wesentliche, vielleicht – wenn richtig konzipiert – die entscheidende Rolle spielen. Für mich ist an dieser Stelle zentral, dass relevante Daten erhoben und diese nach deren Analyse auch genutzt werden, um Optimierungen zu erzielen, oder wie in den Leitlinien formuliert, um »fundierte Entscheidungen treffen zu können und zu erkennen, was gut funktioniert und was verändert werden sollte (ibid.)«. Hierbei spielt natürlich auch der Erhebungszeitpunkt eine wesentliche Rolle, denn wenn die relevanten Daten zu spät erhoben werden, können sie für eine Optimierung nicht mehr genutzt werden.
Читать дальше