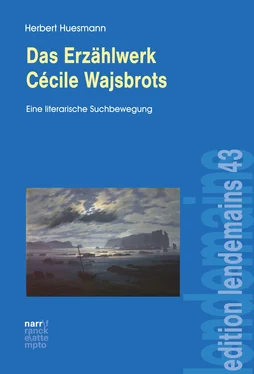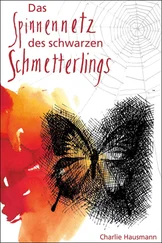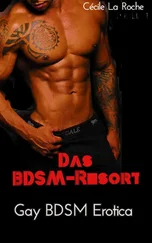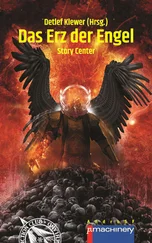Von grundlegender Bedeutung für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Holocaust im Erzählwerk Cécile Wajsbrots sind weitere Arbeiten Katja Schuberts.37 Ausgangspunkt ihrer 2001 erschienenen Studie ist „[…] die Überzeugung, dass die Verfasserinnen als Opfer oder als Angehörige und Nachkommen von Opfern extremer Gewalt eine Deutungsautorität in Bezug auf das Geschehen der Shoah und deren Spätfolgen innehaben […]“38. Dabei gelangt Katja Schubert zu der Erkenntnis, dass, „da […] die konkreten Orte des Geschehens ‚Auschwitz‘ nicht mehr existieren, […] Topographien des Gedächtnisses und des Zeugnisses durch das Schreiben selbst geschaffen werden müssen.“39 Sie führt jedoch auch aus, dass „[d]ie nach 1945 geborenen Schreibenden […] dennoch auf verschiedene Weise [versuchen], mit den Orten verbundene Erfahrungen und die dazugehörigen Geschichten der Deportierten einzuholen“40. In ihren 2007, 2008 (und 2010) erschienenen Aufsätzen über Beaune-la-Rolande, La Trahison und Mémorial41 hat Katja Schubert detailliert entfaltet, dass und warum Cécile Wajsbrot als typische Repräsentantin dieser Gruppe von Schriftstellerinnen zu betrachten ist. Wenn Cécile Wajsbrot die Funktion von Literatur anhand der von Rabelais im Quart Livre erzählten Haute Mer -Episode Pantagruels erläutere,42 dann insistiere sie auf einer „[…] approche intertemporelle et intertextuelle malgré et avec Auschwitz“ und demonstriere damit, dass sie sich trotz „Auschwitz“, das den „[…] horizon culturel et politique en Europe […]“43 bis heute definiere, in die literarische Tradition einordne. Sie tue dies umso lieber, als sie hier, womöglich anders als im Bereich der Familie, eine „généalogie intacte“ vorfinde:
La lecture et le commentaire d’autres textes littéraires portent les siens, tissent aussi leurs trames à l’intérieur des siens et créent une polyphonie qui exprime appartenance, interaction et, qui sait, aussi une généalogie intacte, contrairement à la généalogie familiale avec ses multiples ruptures.44
Die Zahl der in Frankreich und in anderen europäischen Ländern erschienenen und für diese Dissertation relevanten Studien ist relativ gering. Zu erwähnen sind die Arbeiten von Matteo Majorano, Fabien Gris, Valeria Gramigna und Teresa Baquedano Morales.45
Sowohl Matteo Majorano als auch Fabien Gris setzen sich mit Caspar-Friedrich-Strasse auseinander. Matteo Majorano charakterisiert den Roman als „[…] un enchevêtrement d’histoire (l’écroulement du mur de Berlin), de réflexion sur l’art, à partir des tableaux de Caspar Friedrich (sic!), et d’un amour impossible, à cause du mur infranchissable qui existe en chacun de nous“46.
Am Ende seines gedanklich vielschichtigen Aufsatzes fasst Fabien Gris die Art und Weise, in der Cécile Wajsbrot die Reflexion über Kunst und Geschichte fiktionalisiert hat, folgendermaßen zusammen:
Avec la fiction élaborée dans Caspar Friedrich Strasse , Cécile Wajsbrot fait partie de ces auteurs qui ont contribué à redéployer les canons de l’histoire de l’art selon de nouvelles logiques – anachroniques, fantomales et figurales –, qui échappent a priori au seul décryptage des intentions du peintre. En cela, n’a-t-elle pas suivi Friedrich lui-même qui, fidèle à l’esprit du romantisme, donnait ce conseil: „L’un des plus grands mérites et peut-être le plus grand mérite d’un artiste [est] de stimuler intellectuellement et d’éveiller des pensées, des sentiments et des sensations chez le spectateur, quand bien même ce ne serait pas les siennes“?47
Valeria Gramigna arbeitet in ihrer Studie über Stadtromane die besondere Bedeutung heraus, die in Fugue der Beziehung zwischen dem Text und den Fotografien von Brigitte Bauer sowie der Funktion der „écriture“ für die Erzählerin-Protagonistin zukommt.48 In einem Aufsatz mit einer ähnlichen Thematik konzentriert sich Teresa Baquedano Morales in dem auf das Werk von Cécile Wajsbrot bezogenen Abschnitt in Anlehnung an Augés Theorie der „non-lieux“ auf die Art und Weise, in der in Nation par Barbès das Schicksal Anielas mit der Métro als einem klassischen „non-lieu“ verknüpft ist.49
Obwohl Cécile Wajsbrot die Bedeutung des Raumes für ihr Schreiben deutlich betont hat50 und R. Böhm und M. Zimmermann das Erzählwerk Wajsbrots bereits 2010 als „literarische Suchbewegung“ bezeichnet haben, hat die Forschung die Romane und Erzählungen der Autorin bislang nicht systematisch unter diesem Aspekt in den Blick genommen. Die vorliegende Studie erfüllt folglich ein Desiderat, das umso dringender erscheint, da die Bedeutung von Raum und Bewegung für die Literatur insgesamt seit geraumer Zeit verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist.
1.4 Anmerkungen zur Rezeption der Romane Cécile Wajsbrots in Frankreich und Deutschland
Roswitha Böhm und Margarete Zimmermann haben bereits ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich bzgl. der Rezeption der Romane Cécile Wajsbrots deutliche Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland abzeichnen.1 Da eine gründliche und belastbare Antwort empirische Studien, die im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten sind, voraussetzte, seien hier nur zwei Beobachtungen zitiert, die erkennen lassen, dass die Erinnerung an den Holocaust in Frankreich und Deutschland bis in die jüngere Vergangenheit sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrief.
Bereits 2001 vermutete Katja Schubert, dass ein Roman wie La Trahison aufgrund der „[…] direkte[n] Auseinandersetzung im Frankreich der 90er Jahre zwischen einer Jüdin und einem Nichtjuden […] von einem französischen Publikum auch als eine Provokation und als eine neuartige, jedoch weitgehende Hinterfragung der eigenen Geschichte gelesen werden [konnte]“2. Das besondere deutsche Interesse für jene Romane Cécile Wajsbrots hingegen, die sich mit einer historischen Thematik auseinandersetzen, mag sich aus einem Phänomen erklären, das sie selber sehr bewusst wahrgenommen hat. Im ersten Kapitel ihrer Essaysammlung Berliner Ensemble zeigt sich die zwischen Paris und Berlin pendelnde Autorin angesichts des Berliner Stadtbildes dermaßen beeindruckt „[…] par la présence du passé, des plaques commémoratives rapportant les événements les plus sombres et par la croyance – concrétisée par le nombre de grues et de chantiers – en un avenir“, dass sie sich fragt: „Où est le présent?“3 Und in einem Gespräch mit Hélène Cixous stellt sie in einem Rückblick auf ihre inzwischen dreizehn Berliner Jahre fest, dass es in dieser Zeit wohl keinen einzigen Tag gegeben habe, an dem die Zeitungen oder das Radio nicht auf den Nationalsozialismus oder die Judenvernichtung – l’extermination – hingewiesen hätten. Zumindest zu Beginn habe sie für diese Einstellung eine stärkere Affinität empfunden als für „[…] l’amnésie et la bonne conscience – ou faut-il dire l’inconscience mauvaise – françaises“4. Unstrittig ist, dass in Deutschland aufgrund der historischen Schuld des Landes die Sensibilität für Themen, die auf den Holocaust bezogen sind, stärker ausgeprägt ist als in Frankreich, das seine durch die Kollaboration herbeigeführte Verstrickung in den Holocaust bekanntlich lange verdrängt hat.
Im Hinblick auf L’Île aux musées , den zweiten Haute Mer -Roman, stellen R. Böhm und M. Zimmermann die Frage, ob die schwache Resonanz in Frankreich der „[…] allzu radikalen ‚Verstimmlichung‘ und ‚Entkörperung‘ der Protagonisten, die für manchen Leser blass und konturenlos bleiben“,5 geschuldet sei. Im Übrigen dürfe man „gespannt sein“, ob das Interesse für die Romane Cécile Wajsbrots auf französischer Seite wachse, sobald der – mittlerweile immerhin in vier Bänden vorliegende – als Pentalogie geplante Haute Mer -Zyklus vollständig vorliege. Angesichts der Experimentierfreudigkeit der Autorin, die sich im Laufe ihrer Entwicklung immer stärker einer abstrakt-theoretischen Thematik zugewandt hat und deren sich von Roman zu Roman verändernde Erzählweise dem Leser eine beträchtliche Verstehensleistung abverlangt, ist (leider) weder für Frankreich noch für Deutschland zu erwarten, dass die Romane Cécile Wajsbrots Auflagenrekorde erzielen werden.
Читать дальше