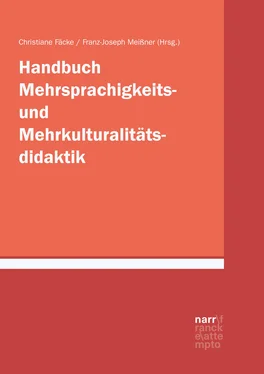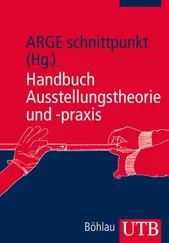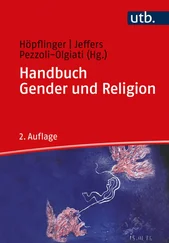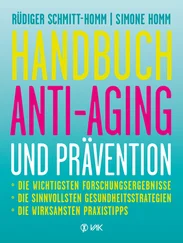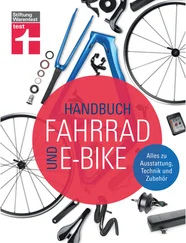3. Fazit: Was folgt daraus für eine Neuorientierung der Fremdsprachenlehrerausbildung?
Förderung von Mehrsprachigkeit durch Fremdsprachenunterricht ist nicht zum Nulltarif zu haben! Sie macht nicht nur einen veränderten Unterricht, sondern eine veränderte Ausbildung erforderlich, wie die vorangehenden Ausführungen – hoffentlich – gezeigt haben. Es würde allerdings für eine Art Betriebsblindheit sprechen, würde man curriculare Neuansätze ausschließlich bezogen auf Mehrsprachigkeit hin denken. Andere Fokussierungen sind möglich und haben ebenfalls denkbare Begründungen für ihre Realisierung auf ihrer Seite: Bilinguales Lernen (↗ Art. 111, 116), Digitalisierung, InklusionInklusion oder auch Informationstechnologie (↗ Art. 102) sind nur wenige Stichworte, die als Grundlage der Neuorientierung von Schule, Unterricht im Allgemeinen, Fremdsprachenunterricht im Speziellen und Lehrerbildung genügen mögen. Dabei liegt beinahe auf der Hand, dass ein einziger Ausbildungsgang schwerlich in der Lage sein dürfte, all diese gesellschaftlich berechtigten Anforderungen gleichermaßen zu erfüllen, schon gar nicht im bisher üblichen Zeitrahmen. Vielleicht benötigen wir vielmehr Lehrer, die sich in der Ausbildung ein spezifisches ProfilProfile von Lehrpersonen erworben haben. Was spricht gegen LehrerbildungskonzepteLehrerbildungskonzepte, die zu unterschiedlichen Profilen führen und dem angehenden Lehrenden diese spezielle Profilbildung anbieten, mit ihm umsetzen und zertifizieren? In der Konsequenz bedeutet dies allerdings auch eine klare Absage an den Einheitslehrer, wie er offenbar dem aktuellen KMK-Vorsitzenden vorschwebt. Stattdessen folgt daraus vielmehr die Notwendigkeit, qualitative Aspekte einer Lehrerbildungsreform den rein quantitativ-instrumentellen Überlegungen überzuordnen. Auch und gerade die Förderung von Mehrsprachigkeit sollte uns das aber Wert sein! Auch und gerade um den Preis einer Konsolidierung und vielleicht auch Verlängerung der Ausbildung!
Burwitz-Melzer, E., Riemer, C. & Schmelter, L. (Hrsg.) (2018): Rolle und Professionalität von Fremdsprachenlehrpersonen. Arbeitspapiere der 38. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen.
Hericks, U. (2006): Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe. Rekonstruktionen zur Berufseingangsphase von Lehrerinnen und Lehrern. Wiesbaden.
Horn, K.-P. (2016): Profession, Professionalisierung, Professionalität, Professionalismus. Historische und systematische Anmerkungen am Beispiel der deutschen Lehrerbildung. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 68/2, 153-164.
Königs, F. G. (2014): War die Lernerorientierung ein Irrtum? Der Fremdsprachenlehrer im Kontext der Sprachlehrforschung. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen 43/1, 66-80.
Königs, F. G. (2016): Der Fremdsprachenlehrer: Das unbekannte Wesen? – Was wir trotz Lehrerorientierung über Fremdsprachenlehrkräfte wissen könnten (und vielleicht auch wissen sollten). In: F. Klippel (Hrsg.): Teaching Languages – Sprachenlehren . Münster, 59-73.
Meißner, F.-J., Königs, F. G., Leupold, E. et al. (Red.) (2001): Zur Ausbildung von Lehrenden moderner Fremdsprachen. In: F. G. Königs (Hrsg.): Impulse aus der Sprachlehrforschung – Marburger Vorträge zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern. Tübingen, 159-181.
Roters, B. (2012): Professionalisierung durch Reflexion in der Lehrerbildung. Eine empirische Studie an einer deutschen und einer US-amerikanischen Universität . Münster.
Frank G. Königs
26. Lehr- und lernseitige Einstellungen zu sprachenübergreifenden Ansätzen
1. Aufriss
Der Begriff „sprachenübergreifende Ansätzesprachenübergreifende Ansätze“ impliziert, dass diese mehr als eine Sprache umfassen. Sprachübergreifende Ansätze sind eng verknüpft mit dem Konzept der Mehrsprachigkeit (↗ Art. 6, 7). Von MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit wird in der Regel gesprochen, wenn dritte oder weitere Sprachen im Spiel sind. Was Mehrsprachigkeit im Kontext des Fremdsprachenerwerbs heißt und vernüftigerweise heißen sollte, definierte 1989 ein Expertengremium so:
daß unter Mehrsprachigkeit nicht zu verstehen ist, man müsse mehrere Sprachen gleichermaßen beherrschen. Als mehrsprachig darf schon der bezeichnet werden, der auf der Basis der Kenntnis seiner Muttersprache eingeschränkte Kenntnisse in wenigstens zwei weiteren Sprachen entweder in gleichen oder verschiedenen Diskursbereichen hat (um z.B. soziale Kontakte in gesprochener oder geschriebener Sprache aufzunehmen oder Texte lesenLesekompetenz oder Fachgespräche führen zu können). (Bertrand & Christ 1990: 208)
Die Definition nimmt Abschied von der naiven und ohne empirische Evidenz herrschenden Vorstellung, Mehrsprachige könnten alle ihre Sprachen in gleicher Weise zu denselben Themen, mit demselben Kompetenzniveau beherrschen.
Sprachenübergreifende Ansätze gehen den Mehrsprachenerwerb lernökonomisch an. Sie verfolgen das Ziel, lernerseitig vorhandene Sprachkenntnisse und Sprachlernstrategien für das Erlernen weiterer Fremdsprachen fruchtbar zu machen. Es handelt sich um ein vernetzendes Lernen (↗ Art. 56).
Mehrsprachigkeit ist jedoch nicht nur Ziel des Fremdsprachenunterrichts, sie ist zugleich auch eine Voraussetzung, auf die der Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen aufbauen kann. Dies meint die den Lernenden schon bekannten Sprachen und VarietätenVarietäten: die in der Gesellschaft mehrheitlich gesprochene Sprache (z.B. Deutsch in Deutschland), die autochthonen Sprachen (↗ Art. 117), die Dialekte (↗ Art. 126) und die Herkunftssprachen (↗ Art. 106), die in Zahl und Art die Schulen vor besondere Probleme stellen.
Angestrebt wird ein Fremdsprachenunterricht, der die Zielvorstellung eines allenfalls additiven Verständnisses des Mehrsprachenerwerbs durch ein integriertes Konzept ersetzt (Krumm 2004). Vor diesem Hintergrund entstand der Begriff der SprachlernkompetenzSprachlernkompetenz. Es handelt sich um einen Handlungsbegriff, der SprachenbewusstheitSprachenbewusstheit und SprachlernbewusstheitSprachlernbewusstheit (↗ Art. 22) voraussetzt. Ihm zufolge ist ein kompetenter Fremsprachenlerner in der Lage, Sprachen reflexiv zu lernen. Hierbei greift das Individuum auf Wissensressourcen zurück, die es im Umgang mit Sprachen, ihrem Erwerb und mit Kommunikation in ihnen erworben hat.
In der sog. WissensgesellschaftWissensgesellschaft kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass einmal in Schule und Ausbildung erworbenes Wissen ausreicht, um den Anforderungen der Arbeitswelt zu genügen (Europäische Kommission 1996). Die Wissengesellschaft ist eine Lerngesellschaft. Dass unter den Bedingungen der GlobalisierungGlobalisierung und des Europäischen Zusammenschlusses gerade kommunikative Kompetenzen in mehreren Sprachen vielseitige Anschlussfähigkeit gegenüber fremden Kulturen und Wirtschaftsräumen (↗ Art. 24) herstellen, ist augenfällig.
2. Lehrseitige Einstellungen zu sprachübergreifenden Ansätzen
Und dennoch: Immer noch ist die Auffassung anzutreffen, dass die Schüler durch das Erlernen einer einzigen Fremdsprache bereits maximal belastet würden; sie „würde[n] von weitergehenden Hinweisen auf andere Spachen verwirrt und überfordert“, konstatiert eine Lehrerin in einer Untersuchung zur Einstellung von Lehrenden zur Mehrsprachigkeit (Méron-Minuth 2016: 40). Dabei sind die Einstellungen der Lehrerinnen und Lehrer, die sie ja im Unterricht an die Schüler weitergeben, mitentscheidend für deren Haltung gegenüber dem Erlernen von Sprachen und der Mehrsprachigkeit. Weitere wichtige, in empirischen Arbeiten wiederholt genannte Faktoren betreffen das Unterrichtserlebnis; den Wunsch, die Fremdsprache für Studium und Beruf zu nutzen; den Wunsch, mit den Menschen der Zielkultur zu kommunizieren – um nur die wichtigsten Argumente zu nennen (Meißner, Beckmann & Schröder-Sura 2008: 70f., 87f.), Beckmann 2016: 296, 235ff.). Beispielhaft für das Unterrichtserlebnis ist der Indikator des von den Lernenden angestrebten Kompetenzprofils im Vergleich zu den Prioritäten, wie sie in der Wahrnehmung der Lerner im Unterricht gesetzt werden. Hier besteht eine deutliche Diskrepanz (Beckmann 2016: 242, 299).
Читать дальше