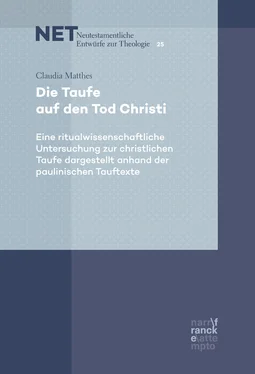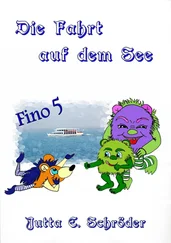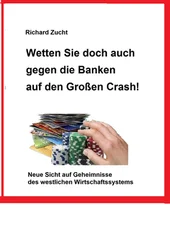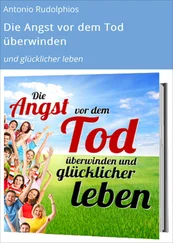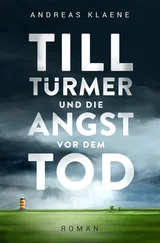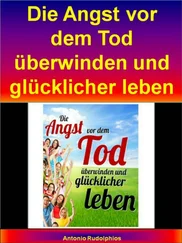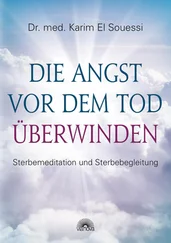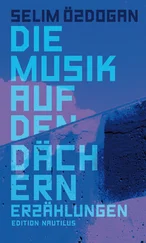Menschen, die zuvor nach unterschiedlichen Kategorien unterschieden und eingeteilt wurden (3,28a–c), bilden jetzt eine Einheit. Nur gemeinsam sind diejenigen, welche zuvor entweder der περιτομή oder der ἀκροβυστία zugeordnet werden konnten (6,15a), die καινὴ κτίσις (6,15b). Dabei handelt es sich weder bei der Einheitsvorstellung noch ihrer Bindung an die Taufe um spezifische Gal-Themen. Die verschiedenen, vielfältigen im 1Kor behandelten Themen und Probleme sind geradezu am roten Faden der Vielfalt-Einheits-Problematik aufgefädelt. Entsprechend lassen sich die Bezugnahmen auf die christliche Taufe in dem Paulusbrief mit den meisten Tauftexten an genau den Stellen finden, wo Paulus auf die grundlegende Einheit der Gemeinde abzielt.
Aus der Wahrnehmung, dass sämtliche paulinischen Taufstellen im Plural formuliert sind, ergibt sich noch ein weiterer Aspekt: Greift Paulus an diesen unterschiedlichen Stellen eine geprägte Taufformel auf. So liegt es nahe, ihren Sitz im Leben in der frühchristlichen Taufliturgie zu vermuten.2 Wird sie dort auch in pluraler Form verwendet wie bei Paulus? Gibt es also gar kein individuelles „Ich taufe dich auf …“, sondern stets nur das „Ich taufe euch …“? Es schließt sich die Frage an, ob der Plural im Vollzug der Taufe eine Pragmatik hat und wenn ja welche. Zwei Erklärungen kommen dafür in Betracht: 1) Die Taufe wird stets an mehreren Täuflingen zugleich vollzogen , welche dann gemeinsam im Plural angeredet werden. 2) Der Plural bezieht sich vielmehr auf die gesamte Gemeinde der bereits Getauften , deren Anwesenheit dann für den symbolhaft sinnvollen Vollzug der Taufe konstitutiv wäre.
Die gerade angestellten Überlegungen zur Pragmatik der Taufformel im Rahmen der frühchristlichen Taufliturgie sind keine reine Gedankenspielerei und stellen auch keinen Versuch der Rekonstruktion der christlichen Taufe in den ersten Jahrzehnten dar. Die neutestamentlichen Texte bieten keine Beschreibung des Taufablaufs. Dadurch gerät jedoch schnell aus dem Blick, dass die dem Taufritual eigene Symbolik (und ggf. deren Deutung), wie z.B. die Taufe als „Gruppenerlebnis“, von den Briefadressaten selbst erlebt wird.
Dass Paulus aber durchaus die Symbolik, welche das Taufritual bietet, aufgreift und davon ausgehend seine Interpretationen und Argumentationen entfaltet, konnte bereits für 3,27 aufgezeigt werden. Läge es dann nicht nahe, dass auch die Einheitsaussagen, welche sich stets bei den paulinischen Taufstellen finden lassen, und welchen mindestens ebensolches Gewicht zugestanden wird wie den Auswirkungen der Taufe auf den Einzelnen, ebenfalls an einen Aspekt des Taufrituals anknüpfen, nämlich den Vollzug der Taufe mit Blick auf eine Gruppe, erkennbar anhand der plural formulierten Taufformel?3
1.5.5 Abschließende Interpretation
Mit Blick auf die eingangs angefragten vielfältigen Beziehungen zum Kontext lässt sich Folgendes zusammenfassen: Mit πάντες γάρ […] ἐστε […] (3,26 und 3,28d) setzt Paulus einen strukturellen, aber v.a. inhaltlichen Rahmen , innerhalb dessen er den Galatern vor Augen führt, dass die freiwillige Unterwerfung auch nur eines einzelnen unter das Gesetz nicht nur seine eigene Erlösung durch Christus in Frage stellt, sondern der Konstitution der gesamten Gemeinde konträr gegenüberstehen würde. Denn sie alle, die sie ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ glauben und εἰς Χριστὸν getauft wurden, sind auf besondere Weise an ihn und aneinander gebunden .
Es ist eine besondere Gemeinschaft, in die hinein sie mit der Taufe initiiert wurden . Es ist eine Gemeinschaft, wie sie bis heute nur schwer vorstellbar ist, denn sie lebt gerade nicht von der Gleichgestaltigkeit ihrer Mitglieder oder doch mindestens von einem gemeinsamen Streben danach, wie es alle anderen Gruppen, Stände und Vereine tun: Die Mitglieder sind gerade verschieden in (bisheriger) Religion, Volkszugehörigkeit, sozialem Stand und Geschlecht . Das einzige, was ihnen gemein ist, ist das ἐν-Χριστῷ-Ἰησοῦ-Sein , welches dann nicht nur die Bedeutung der bisherigen, das Sozialleben strukturierenden Unterscheidungen relativiert, sondern auch die dahinterstehenden Verhältnisse und Bindungen geradezu aufsprengt. Als gäbe es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, müssen beide ἐν Χριστῷ glauben und εἰς Χριστὸν getauft werden. Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Männern und Frauen wird, indem sie sich erstmals dem gleichen Ritual unterziehen, die gleiche „Behandlung“ durch Gott zuteil . Wie könnte man dann nachträglich, indem man sich als Heide beschneiden lässt, derartigen Kategorisierungen wieder Relevanz einräumen?! Die einzige – heilsnotwendige – Verhältnisbestimmung ist die Zugehörigkeit zu Christus und die Einheit untereinander . Keine Volkszugehörigkeit, kein sozialer Status, kein Geschlecht, nicht einmal die Ehe binden den einzelnen mehr als das gemeinsame υἰοὶ-θεοῦ-Sein. Die vorherige Individualität des einzelnen, welche sich auf Verhältnisbestimmungen stützt, hat in der Taufe ihre Relevanz verloren, denn es gibt niemals den einen, einzelnen Getauften, πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ .
Ihre Einheit ist keinesfalls zu vergleichen oder gar zu identifizieren mit Christus, dennoch derartig grundlegend durch ihn begründet, dass Paulus sie später zu seiner σῶμα-Χριστοῦ-Metapher ausbaut. Sie wird sehr deutlich herausstellen, dass die Gleichheit coram deo nicht zu einer Einebnung jeder Art von Unterschieden geführt hat (und wohl auch nicht eschatologisch zu erwarten ist), sondern dass die funktionierende Einheit vielmehr von den unterschiedlichen χαρίσματα des einen πνεῦμα lebt .
1.6 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι (Gal 3,29)
Vers 29 führt über δέ nicht nur die Thematik vom Verhältnis der Christusgläubigen zu Christus weiter, sondern bringt zugleich die bereits in 3,6 beginnende Argumentation über den Glauben Abrahams und seine Erben zum Abschluss.
Wenn sich auch die Literatur einig darüber ist, dass δέ nicht kontrastierend, sondern fortführend zu verstehen ist, so scheint doch nicht ganz eindeutig, woran ὑμεῖς Χριστοῦ (ἐστέ) anknüpft: Entweder umschreibt der Genitiv das in-Christus-Sein (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 3,28d)1 oder aber er greift die Art der Zugehörigkeit (πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε, 3,26)2 wieder auf.
Unzweifelhaft handelt es sich um einen Genitiv der Zugehörigkeit, welcher sich auch in anderen paulinischen Texten an prominenter Stelle findet (Gal 5,24; 1Kor 1,12; 3,23; 2Kor 10,7 u.a.). Betz spricht sogar von einem paulinischen „Begriff Χριστοῦ εἶναι“.3 Grundthema sämtlicher Stellen ist die Betonung der ganz neuen, völlig veränderten Lebenswirklichkeit der Christusgläubigen (1Kor 1,12f; 3,23; 2Kor 10,7), welche einen Christus entsprechender Lebenswandel fordert (Gal 5,24), v.a. aber durch das in Christus bewirkte Rettungshandeln bestimmt wird (Gal 3,29). Der Verweis auf die Taufe macht dabei deutlich, was auch die maximal verkürzte grammatikalische Struktur zum Ausdruck bringt: Nicht die Christusgläubigen selbst tragen dazu bei, Kinder Gottes (Gal 3,26) oder Samen Abrahams zu sein, sondern allein ihre in der Taufe vermittelte Zugehörigkeit zu Christus (Gal 3,29). Besondere Beachtung kommt dabei dem Plural in all diesen Aussagen zu, denn: „Wenn die Gläubigen durch die Taufe in der Weise Christus angehören (Gen.poss.), daß sie in ihm eine Einheit bilden, so haben sie auch alle daran Anteil, was ihm gehört.“4 Die in Christus realisierte Verheißung gilt einerseits jedem einzelnen und andererseits allen gemeinsam als Gemeinde.
Читать дальше