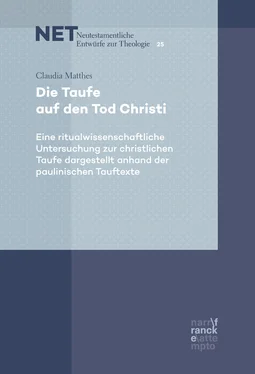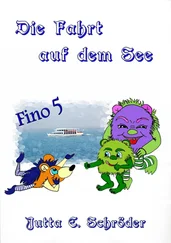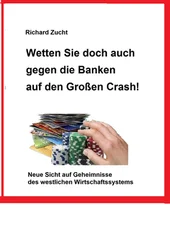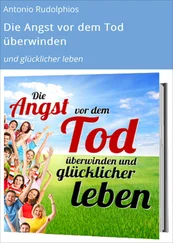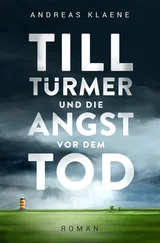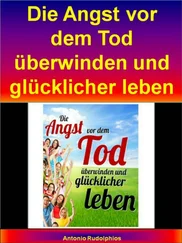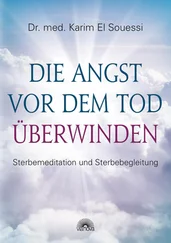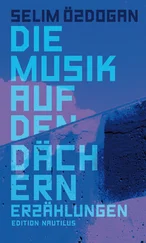Die Tradition wird in ihrem Wortlaut nicht mehr genauer zu rekonstruieren sein, jedoch lassen sich drei Elemente festhalten: 1) der Taufbezug , der konstitutiv für 2) die Negierung der Gegensatzpaare ist, auf welche (argumentativ begründend) 3) eine Einheitsaussage folgt. Wenn man sich nun die beiden textkritischen Varianten anschaut, welche als gut belegt und zugleich plausibel beurteilt werden können, so stellt man fest, dass ἐστε Χριστοῦ Ἰησοῦ der Einheitsaspekt vollkommen fehlt.13 Dass eine Einheitsaussage aber definitiv Bestandteil der Tradition gewesen ist, konnte anhand des jeweiligen Kontextes von 1Kor 12,13 und Kol 3,11 aufgezeigt werden. Demnach ist εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ als die ursprüngliche Lesart anzusehen, 14 da nur sie den Einheitsaspekt bietet .
Mit dieser Feststellung ist nun zu überlegen, wie εἷς zu verstehen ist und welche Auswirkung 3,28d als Abschluss und zugleich argumentativer Bestandteil von 3,27f auf die Interpretation des Abschnittes hat.
1.5.4 Einheitskonzepte im NT
Ist eine Einheitsaussage originär mit der Tradition verbunden, so stellt sich die Frage, wie sie sich inhaltlich zu den anderen Teilen der Tradition verhält. Vor dem Hintergrund der bereits geleisteten Interpretationen zu 3,26–28c soll noch intensiver nach Einheitsvorstellungen in den neutestamentlichen Schriften (speziell εἷς-Aussagen) gefragt werden, um die so gewonnenen Ergebnisse auf ihre Aussagekraft für eine Existenz ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ hin auszuwerten.
„εἷς here has the meaning ‚one‘ in contrast to the parts of which a whole is made up’, as suggested by the contrast with ‚all‘ (πάντες). It stresses wholeness or unity.“1 Die semantische Grundbedeutung von εἷς „einer im Gegensatz zu einer Mehrzahl“ ist so eindeutig und unbestreitbar,2 dass die Frage aufkommt, wie man überhaupt zu einer Gleichheitsaussage für Gal 3,28d kommen kann – wohl nur mit einer eindeutigen Harmonisierungsabsicht: Wer 3,28a–c als Negierung sämtlicher Unterschiede versteht, will im Folgenden in εἷς keine in Christus begründete Einheit, sondern vielmehr eine in der Taufe durch Christus bewirkte Gleichheit sehen.
So stellt sich nun die Frage, welche Konzepte und Vorstellungen von Einheit und Einzigkeit lassen sich im NT, speziell in den paulinischen Schriften finden und können sie für 3,28d in Anschlag gebracht werden? Die in den unterschiedlichsten frühchristlichen Schriften hoch gewertete, oftmals angemahnte Bedeutung der Einheit scheint zwei grundsätzliche Wurzeln zu haben: einerseits die allgemeine Wertschätzung der Einheit und andererseits die Einzigkeit Gottes.
1.5.4.1 Neutestamentliche Einheitskonzepte allgemein
Laut Betz stehen die neutestamentlichen Konzepte unter dem „Einfluß der für die antike Religion, Philosophie und Politik grundlegenden Denkkategorie Einheit–Vielheit. Das Urchristentum teilt in vollem Maße die gemeinantike Bevorzugung von Einheit und die negative Einschätzung von Vielheit in ihren verschiedenen Manifestationen.“1
Wesentlich expliziter ausgeführt und nicht zuletzt für die paulinische Theologie grundlegend ist die Vorstellung von der Einzigkeit Gottes und deren Bedeutung für die Konstitution der christlichen Gemeinde. Der Monotheismus wird dabei nicht nur in seinen Inhalten, sondern oft auch in seinen prägenden Formeln aus dem Judentum übernommen: Die sogenannte Monotheismusformel, wie sie ins jüdische Glaubensbekenntnis eingegangen ist (יהוה אלהינו יהוה ארד […] / […] κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν [Dtn 6,4]) und von Jesus als das höchste Gebot zitiert wird (Mk 12,29 par), findet sich an prominenten argumentativen paulinischen Stellen wie etwa in Gal 3,20 ([…] ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν) oder Röm 3,30 (εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει […]),2 später aber auch in den Evangelien (z.B. Mt 23,8–10). Dass der monotheistische Glaube der in der Antike verbreiteten Vielgöttervorstellung manifest gegenübersteht, verleiht seiner argumentativen Verwendung etwa bei der Beschreibung der Gemeinde ein spezielles, teilweise wohl erläuterungsbedürftiges Gewicht.
Was aber meint „Einzigkeit“? Im Kontrast zu vielen Göttern hat die Vorstellung von nur einem Gott automatisch den Aspekt der Einzigartigkeit. Dies lenkt bereits den Blick von der rein nummerischen Aussage (einer anstatt fünf) auf die Qualitätsebene. Dass diese zweite Dimension der Einzigkeit christlicherseits als mindestens ebenso wesentlich wahrgenommen wird, macht spätestens die „Erweiterung“ der Formel auf Christus deutlich: „Die Monotheismusformel wird variiert, um analog zur Einzigkeit Gottes die einzigartige Stellung Christi festzustellen (Jak 4,12; Mt 23,8–10).“3 Neben der gesonderten Stellung und Einmaligkeit Christi4 wird in der johanneischen Theologie dazu speziell die Einheit mit Gott betont: ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν (Joh 10,30). Mit Blick auf die Interpretation von Gal 3 ist dazu festzuhalten, dass das Einssein des Vaters mit Christus nie als Identität verstanden, sondern stets als besonders qualitative Form von Gemeinschaft, nämlich Einheit, dargestellt wird. Davon wird auch eine Einheitsvorstellung für andere abgeleitet: ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν […] (Joh 17,21).5 Beachtenswert ist hierbei, dass die Einzigkeitsvorstellung, welche auf Einheit abhebt, mit einer (reziproken) ἐν-Aussage kombiniert ist, wie wir sie auch in 3,28d vorfinden.6 Paränetisch-argumentativ wird die Einzigkeit Gottes gelegentlich aber auch unabhängig vom Einheitsaspekt hervorgehoben: Ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. (Mt 23,8).7
1.5.4.2 Einheitskonzepte bei Paulus
Auch für Paulus gibt „Gottes Einzigkeit gedankliches und praktisches Fundament seines Denkens“ ab:1 εἴπερ εἷς ὁ θεὸς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. (Röm 3,30) Dass Gott – in Christus – an allen gleich handelt, begründet eine Einheit von ganz neuer Qualität: οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις (Gal 6,15). Um diese Einheit zu illustrieren spielt Paulus geradezu mit unterschiedlichen ekklesiologischen Metaphern, die doch alle einen Grundaspekt seiner Ekklesiologie herausstellen, welcher sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: „Nur gemeinsam ergebt ihr ein sinnvolles, funktionierendes Ganzes – und dazu braucht es nicht nur jeden Einzelnen, sondern ein jeder wirkt auch (konstitutiv) auf die anderen ein.“ Dies verdeutlicht am sinnfälligsten sein Bild von der Gemeinde als Leib Christi: ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν […]καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά. (siehe 1Kor 12,13f; 1Kor 10,17; Röm 12,4–6)2 Aber auch Metaphern wie die Gemeinde als Bau Gottes (1Kor 3,9b–15), als Tempel (1Kor 3,16f) oder auch ungesäuerter Teig (1Kor 5,6–8)3 – wenn auch teilweise unter einem anderen Fokus herangezogen, wie etwa dem Gemeindeaufbau oder dem Gericht – zeigen, dass nicht nur die Einzigkeit und Bedeutung der christlichen Versammlung, sondern auch ihre konstituierenden Bindungen in den Blick geraten: Einerseits die jeweilige und zugleich gemeinsame Bindung an Christus (Christus als σῶμα [1Kor 12,12f], θεμέλιος [1Kor 3,11] oder πάσχα [1Kor 5,7]), andererseits die Bindung untereinander (die ergänzenden Funktionen der Gliedmaßen [1Kor 12,14–31], das Aufeinander der Steine [1Kor 3,10f], das Verderben des Teiges durch auch nur den geringsten Anteil gesäuerten Teiges [1Kor 5,6.8]).
Читать дальше