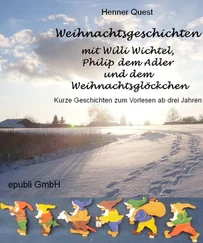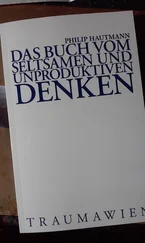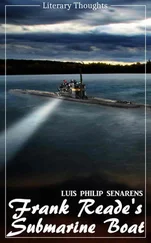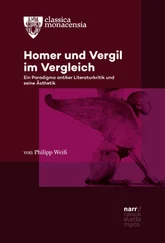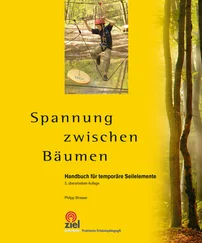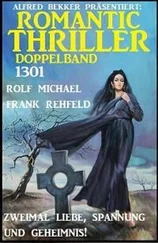Rahmen, Leerstellen und Prototypikalität: Wissensrahmen verfügen über Leerstellen.15 Diese sind standardmäßig mit ihnen verbunden und lassen sich durch Fragen paraphrasieren, die situationsabhängig mit Füllwerten besetzt werden können.16 Wissensrahmen vergleicht Minsky mit einem Skelett und mit einem Bewerbungsbogen. Beide geben eine grobe Struktur vor und müssen mit konkretem Material gefüllt werden. Ein Wissensrahmen ist a sort of skeleton, somewhat like an application form with many blanks or slots to be filled .17 Je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Leerstelle gemeinsam auftritt mit einem Wissensrahmen, desto höher ist der Grad der Prototypikalität einer Leerstelle. Barsalou spricht auch von Attributsystematizität und verdeutlicht es an dem Konzept VOGEL. Der Rezipient würde demnach Leerstellen für die Größe, die Farbe und den Schnabel konstruieren.18 Ähnlich sollte es sich mit dem Rahmen zu WEIN verhalten, prototypische Leerstellen könnten den Jahrgang, die Herkunft, die geschmackliche Richtung etc. betreffen. Mögliche Füllwerte wären zum Beispiel 1982, BORDEAUX, TROCKEN.
Rahmenlose Informationen und informationslose Rahmen: Rahmenlose Informationen streben danach, in einen Rahmen eingebettet zu werden. So werden sie zu anderen Wissenselementen in Bezug gesetzt und stellen keine atomaren Einheiten dar. Informationslose Rahmen (d.h. Rahmen mit Leerstellen) streben nach Sättigung.19 In seiner einfachsten Form wird der Drang zur Auffüllung leerer Endpunkte als eine Art Unwohlgefühl oder Hunger erscheinen .20 Leerstellen können auf zweierlei Weise durch Füllwerte gesättigt werden. Einerseits kann dies in einem Top-Down-Prozess geschehen durch typischerweise zum Wissensrahmen gehörende Elemente. Man spricht auch von Standardwerten (englisch default values , default assignments ).21
’Default assumptions fill our frames to represent what’s typical‘. As soon as you hear a word like ’person‘, ’frog‘, or ’chair,‘ you assume the details of some ’typical‘ sort of person, frog, or chair. You do this not only with language, but with vision, too.22
Zum Bereich der wissensbasierten Instantiierungen gehören auch Default-Annahmen mit antizipatorischem Charakter. (In Kapitel 4 werden diejenigen Inferenzen, Elaborationen und Erwartungen vorgestellt, die bei der Textrezeption systematisch auftreten.) Diese aus epistemischen Agglomerationen generierten Erwartungen richten sich zeitlich auf zwei Dimensionen. Einerseits auf zukünftige Ereignisse bzw. zukünftig wahrnehmbare Daten. Sieht oder liest jemand zum Beispiel, dass sich eine Person eine Fahrkarte kauft, so generiert er die Hypothese, dass die Person mit einem Zug fahren wird.23 Auf der anderen Seite richten sich Erwartungen auf Daten, die zwar zum Zeitpunkt der Hypothesenherstellung gegeben sind, die allerdings in diesem Augenblick nicht wahrgenommen werden bzw. nicht wahrnehmbar sind. Sieht eine Person zum Beispiel eine Lampe, so elaboriert sie die Tatsache, dass diese Lichtquelle über einen Knopf verfügt, der dem An- und Ausschalten dient.24 In Anlehnung an diese Beschreibung lassen sich auch Erwartungsbrüche formulieren, die auftreten, sobald die Daten mit den wissensinduzierten Hypothesen nicht übereinstimmen.25
Die aus dem prototypischen Wissen generierten Standardwerte können also einen hypothetischen Status besitzen.26 Ein Standardwert wird aufrechterhalten, wenn dieser mit dem perzeptuellen Input übereinstimmt oder wenn kein sensorisches Datum dem Standardwert widerspricht. Sollten sich nicht kompatible Füllwerte ergeben aus dem sensorischen oder aus dem textuellen Input (die zweite Möglichkeit der Sättigung), so sind diese auf Bottom-Up-Prozessen basierenden Füllwerte privilegiert gegenüber wissensgestützten und verdrängen die prototypische Instantiierung.27
Indem kognitionsbasierte Theorien verschiedener Disziplinen die Prototypikalität in ihren Ansätzen integrieren, übernehmen sie zentrale Gedanken der Prototypentheorie, wie sie von Rosch beschrieben werden. So hebt Barsalou explizit hervor, dass es sich bei einem Wissensrahmen und den damit verbundenen Elementen nicht um eine Konjunktion unverzichtbarer Bestandteile handelt. Vielmehr handelt es sich um Elemente, die nicht alle gleichermaßen realisiert sein müssen. Das führt dazu, dass wissensbasierte Instantiierungen durch perzeptuelle Stimuli korrigiert werden können. (Siehe dazu Absatz 4.) Durch die Adaption des Prototypenbegriffs wird zugleich die Annahme der kulturabhängigen bzw. relativen Intersubjektivität als tragende Säule in den Theoriekomplex installiert, die Barsalou daran erläutert, dass eher Menschen aus Ländern Katalysatoren ( smog device ) in ihrem Wissen über Fahrzeuge aufnehmen sollten, in denen diese üblich sind.28 Diese stillschweigend vorausgesetzte Annahme der Intersubjektivität schimmert auch in Minsky’s Frame-Theorie als einem Common-Sense -Ansatz durch, er beschreibt seinen Ansatz auch als eine Theorie des everyday bzw. ordinary thinking .29 Darüber hinaus erlaubt es der Prototypikalitätsgedanke, das Verhältnis zwischen Rahmen und den Elementen auf einer Prototypikalitätsskala abzubilden. Bei einer Zugfahrt würde der Kauf eines Tickets oder das Einsteigen in das Fahrzeug zu den zentralen Elementen zählen. Als optionales und eher periphereres Rahmenelement käme zum Beispiel der Erwerb einer Zeitung am Bahnhofskiosk in Frage.30 Die zentralen Elemente eines Rahmens nennt Barsalou strukturelle Invarianten .31
Rahmenwahl, Rahmenverwerfung und der sensorische Input. Ebenso wie wissensbasierte Instantiierungen von Leerstellen durch sensorischen Input korrigiert werden können, muss sich die Wahl eines Rahmens an der Realität messen lassen. Das Auftreten einer Anomalie kann sich als ein Indiz dafür entpuppen, dass der gesamte Rahmen unpassend gewählt ist bzw. dass der Wissensrahmen sich für die Integration der sensorischen oder textuellen Daten als inadäquat erweist. Das kann zum Beispiel zu einer von Minsky beschriebenen Spezialfallanpassung führen. Die Daten werden dabei von einem spezielleren Rahmen akkommodiert, der eine geringfügig abweichende Konfiguration der Informationen erlaubt. Eine solche Spezialfallanpassung veranschaulicht Minsky am STUHL-Rahmen. Dieser kann in einen SPIELZEUGSTUHL-Rahmen überführt werden, wenn eine Anomalie auftritt wie zum Beispiel eine Abweichung von der prototypischen Größe. Sollte sich ein Stuhl als wesentlich kleiner erweisen, so kann der STUHL-Rahmen mit einem SPIELZEUG-Rahmen korreliert werden, was zur Konstruktion eines SPIELZEUGSTUHL-Rahmens führt. Sollte keine Möglichkeit der Anpassung gefunden werden, so kann der vollständige Rahmen verworfen werden oder es können neue Rahmen konstruiert werden, bei denen Bestandteile bereits vorhandener Rahmen rekrutiert und in einem amalgamierten Wissenskomplex zusammengeführt werden. Bei inadäquater Rahmenwahl bieten sich dem kognitiven System also verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, die die Kompatibilität zwischen Rahmen und sensorischen Daten anstreben.32
Füllwertkompabilität, Selektion, Füllwertrestriktionen bzw. kontext-sensitive oder bedingte Prototypikalität (auch variable constraints ).33 Elemente eines Wissensrahmens müssen miteinander kompatibel sein. Um dies zu gewährleisten, gibt es bestimmte Selektionsbestimmungen für Füllwerte, die dazu führen, dass sich epistemische Einheiten rahmenintern beeinflussen.34 In einem SCHREIBEN-Wissensrahmen würden prototypischerweise PAPIER als Material und STIFT als Instrument ergänzt werden. Würde sich allerdings eines der beiden Elemente aufgrund des sensorischen oder textuellen Inputs ändern, so würde es zu einer alternativen Sättigung der jeweils anderen Leerstelle führen. Setzt man zum Beispiel TAFEL als Material ein, so würde KREIDE als Instrument instantiiert werden und umgekehrt, der Füllwert einer Leerstelle beeinflusst also den Füllwert einer anderen.35 Barsalou beschreibt diese rahmeninterne Beeinflussung am Beispiel von Transportmitteln. Mit steigender Geschwindigkeit erhöht sich der Preis. Zwischen Geschwindigkeit und Kosten besteht also eine rahmeninterne Beeinflussung.36
Читать дальше