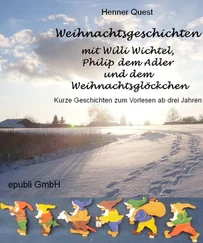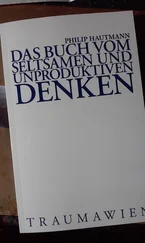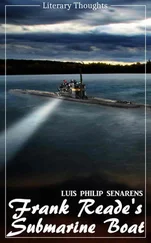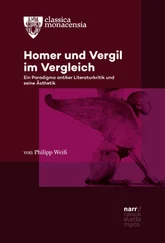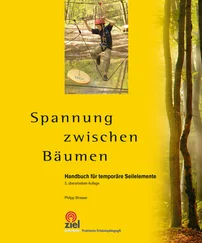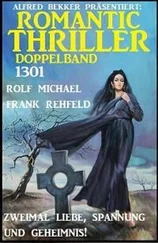II Grundlagen einer Theorie des Textverstehens
If someone said, ’It’s raining frogs‘, your mind would swiftly fill with thoughts about the origins of those frogs, about what happens to them when they hit the ground, about what could have caused that peculiar plague, and about whether or not the announcer had gone mad. Yet the stimulus for all this is just three words. How do our minds conceive such complex scenes from such sparse cues? The additional details must come from memories and reasoning.65
Sprachliche Kommunikation besitzt einen elliptischen Charakter. Auf der Basis einer geringen Anzahl textueller Signale ( sparse cues , stimulus ) wird eine Vielzahl rezipientenseitiger Aktivitäten stimuliert, die sich nähren aus den im Zitat benannten Bereichen des Wissens ( memory ) und der Inferenzen ( reasoning ), die die Grundlage bilden für die Konstruktion eines mentalen Modells (hier scenes ). Im Folgenden werden diese drei Hauptfelder kognitiv orientierter Disziplinen vorgestellt. Damit rückt dieser Teil die repäsentationalen und prozedualen Aspekte des Textverstehens ins Zentrum, die sich aus kognitionsorientierten und psycholinguistischen Ansätzen ergeben.
In Kapitel 3werden Frame- und Schema-theoretische Ansätze integrativ vorgestellt, die auch Wissen über Textsorten mit einschließen. Dabei werden zentrale Begriffe wie Leerstelle , Füllwert , Prototypikalität etc. eingeführt. Zunächst werden diese Entitäten unabhängig von sprachlichen Aspekten als fundamentale Einheiten der Kognition beschrieben.
In Kapitel 4 wird eine Vielzahl mentaler Prozesse vorgestellt, die auf den kognitiven Strukturen basieren. Dabei wird zunächst der für diese Arbeit zentrale Begriff der Inferenz definiert. Nachdem ein kompakter Einblick in die Welt der Inferenzen in der klassischen Philosophie gegeben wurde, werden die Ansätze zu verstehensnotwendigen Inferenzen aus der Textverstehenstheorie vorgestellt. Dabei werden zunächst Inferenzen auf Wortebene vorgestellt, wobei der Satzkontext in der Regel eine wichtige Rolle spielt. Dann werden Inferenzen vorgestellt, die angrenzende Sätze verbinden. Im Anschluss werden Inferenzen beschrieben, die sich auf größere Diskurssegmente eines Textes beziehen und diese vorstellen. Der Aufbau folgt also der Komplexität des zugrunde liegenden Textmaterials. Darüber hinaus wird eine weitere Klasse von Inferenzen vorgestellt, die sogenannten elaborativen Inferenzen. Diese besitzen keine kohärenzstiftende Funktion. Das Kapitel endet mit einer Klassifikation von Inferenzen und mit der Beschreibung von Leserzielen, die einen Grund dafür liefern, warum Rezipienten überhaupt eine derartige Aktivität bei der Textrezeption zeigen.
Während diese Prozesse in Kapitel 4 auf der Ebene einzelner Sätze, Satzpaare und kurzer Abschnitte beschrieben werden, fasst Kapitel 5 komprimiert zusammen, was die Textverstehensforschung im Bereich der mentalen Repräsentation umfangreicherer Texte anbietet, deren Konstruktion auf einer wiederholten Anwendung der in Kapitel 4 vorgestellten Prozesse basiert.
Im Folgenden wird eine Reihe von kognitiven Ansätzen integrativ vorgestellt. Dabei wird das kognitive System zunächst isoliert betrachtet. Dieser Schritt ergibt sich aus dem Cognitive Commitment , das besagt, dass es sich bei den Verarbeitungsprozessen nicht um sprachspezifische Mechanismen handelt sondern um allgemeine mentale Operationen.1
Kognitionsbezogene Theorien zum Wissen wurden in verschiedenen, zum Teil relativ autonomen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt und in Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsunternehmung und den damit verbundenen Erkenntnisinteressen unterschiedlich akzentuiert – letztendlich mit konvergierender Evidenz, was sich niederschlägt in einer zunehmenden wechselseitigen Rezeption und in einer verstärkten gegenseitigen Beeinflussung. Marvin Lee Minsky – Frame-Pionier, Mathematiker und Informatiker – stellt eine allgemeine Theorie auf und verweist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene, die sein Ansatz explanatorisch bewältigen kann und die hauptsächlich auf der Ebene der visuellen und sprachlichen Verarbeitung liegen. Der Linguist Fillmore bezieht sich überwiegend auf die Wort- und Satzebene, erkennt allerdings ein globales Anwendungspotential. Forscher wie der US-Psychologe Rumelhart richten ihre wissenschaftlichen Aktivitäten auf umfangreichere Texte wie zum Beispiel Geschichten. So erwachsen aus einer kognitionszentrierten Perspektive Erklärungsmöglichkeiten für eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene. Sie erweist sich als global anwendbar und besticht durch ihre unifizierende Kraft.
Trotz terminologischer und theoretischer Unterschiede zwischen den Ansätzen weisen die Theorien starke strukturelle und funktionale Parallelen auf, worauf bereits Rumelhart in seinem Artikel „Schemata: The Building Blocks of Cognition“ hinweist.2 Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum Fillmore Begriffe wie Schema , Frame etc. in einem seiner zentralen und mehrfach veröffentlichten Aufsätze „Frame Semantics“ gleichsetzt.3
Terminologische Inhomogenitäten.In der Literatur zur Untersuchung von Wissen finden sich eine Reihe konkurrierender Begriffe, die erhebliche Schnittmengen aufweisen und deshalb kaum auseinanderzuhalten sind. Die Begriffe variieren nicht nur von Autor zu Autor, sondern zum Teil auch innerhalb des Œuvres eines Autors. So bezeichnen Sanford und Garrod das Wissen als scenarios ,4 Minsky spricht von frames .5 Bei Fillmore werden verschiedene Theorieversionen begleitet von verschiedenen terminologischen Präferenzen. In seinen theoretischen Vorarbeiten spricht Fillmore (1971) von Kasusrahmen ,6 Fillmore (1975) von scene ,7 Fillmore (1977a) von scenes ,8 Fillmore (1977b) von schemata , 9 Fillmore (2006) wieder von frames .10 So soll ohne die folgenden Begriffe bereits andeutungsweise beschrieben zu haben, zunächst darauf hingewiesen werden, dass konkurrierende technische Ausdrücke alle Ebenen der Beschreibung durchdringen. Der Dichotomie von Slot und Filler stehen Alternativen gegenüber wie attributes und values bei Barsalou, terminals und instances bzw. assignments bei Minsky, Rumelhart spricht von variables und values .11
Als Kriterien für terminologische Entscheidungen dienen in dieser Arbeit die semantische Durchsichtigkeit und die Etabliertheit eines Begriffs. Die transparenteste und eingängigste Alternative zu Frame , Schema etc. bietet der Ausdruck Wissensrahmen , den Busse gebraucht. Er vermeidet die Ebenenmischung der grammatischen Oberflächenstruktur mit der Tiefendimension und beugt so terminologisch bedingten Missverständnissen vor, die möglicherweise mit Begriffen wie Kasusrahmen einhergehen.12 Slot und Filler werden in dieser Arbeit als Leerstellen und Füllwerte aufgenommen, wie es sich in der deutschsprachigen Diskussion etabliert hat (zum Beispiel bei Ziem (2008)). Hinsichtlich der übrigen Begriffe werden terminologische Entscheidungen an der jeweiligen Stelle getroffen, die den oben genannten Kriterien entsprechen.
Wissensrahmen.Denkt man an einen Kindergeburtstag, so gelangt man zu einer Ansammlung epistemischer Elemente. Es gibt eine bestimmte Kleiderordnung, jeder Gast bringt ein Geschenk mit, es gibt ein Unterhaltungsprogramm mit einer Reihe von Aktivitäten, die zum Beispiel Topfschlagen mit einschließen. Ein Kindergeburtstag findet tagsüber statt und umfasst einen längeren zeitlichen Abschnitt. Deshalb kommen eher ein Samstag oder ein Sonntag für diese Art von Veranstaltung in Frage als ein Wochentag, dessen Struktur und Organisation durch den Schulalltag maßgeblich geprägt ist.13 Bei diesem abgerufenen Komplex handelt es sich um einen Wissensrahmen, der in prototypischer Weise Wissenselemente im Gedächtnis organisiert und der das Potential besitzt, eine Vielzahl möglicher Entitäten mental repräsentieren zu können.14
Читать дальше