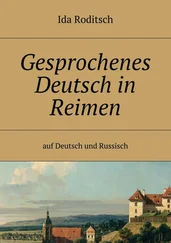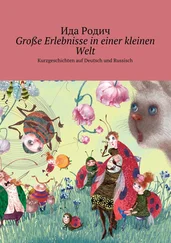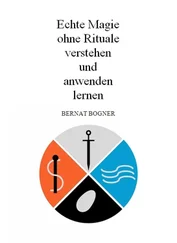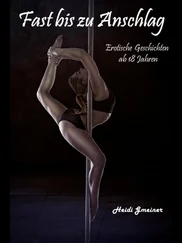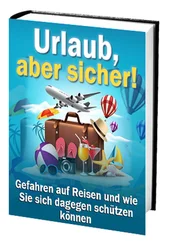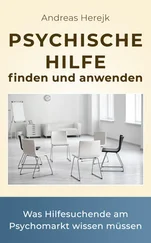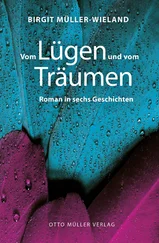Wenn es im Rahmen der neuzeitlichen Ethik nun die praktisch-vernünftigen Wesen sind, von denen gedacht wird, dass sie sich die Gesetze ihres Handelns selbst geben – nichts anderes bedeutet ja Autonomie im Unterschied zur Heteronomie beziehungsweise Theonomie der theologischen Ethikentwürfe –, ändert dies aber bezeichnenderweise nichts an dieser im Unterschied zur aristotelischen Ethik veränderten Funktion der Abwägung: Bis in die Rationale Entscheidungs- und Spieltheorie hinein, dem herrschenden praxeologischen Modell unserer Tage, werden Abwägungsprozesse letztlich nur mehr als technische Prozeduren des Aufsuchens geeigneter Mittel zu (anderweitig gegebenen und konstituierten) Zwecke gefasst.
Abgewogen werden müssen aber, wie nicht zuletzt die aristotelische Fassung des Klugheitsprozesses zeigt, nicht allein die Mittel, sondern auch die Zwecke selbst und in dieser Hinsicht sind Abwägungen typische Manifestationen der Weberschen Wert rationalität. Zwecke sind ja, formal gefasst, gewünschte und (durch bestimmte Mittel) für herbeiführbar erachtete Sachverhalte; Zweck-Mittel-Zusammenhängen eignet typischerweise eine Um-Zu-Struktur11, die aber, in der individualethischen Sphäre, ihrerseits revidierbar erscheint unter höherstufigen Kriterien des Lebenssinns bzw. -glücks, um dessentwillen bestimmte zu verfolgende Zwecke im Leben allererst gesetzt werden. Letztlich, so würde man aus der Perspektive einer aristotelischen Klugheitsethik argumentieren, werden die Abwägungsprozesse selbst um willen des höchsten Zieles, der eudaimonia als dem Lebenssinn, vollzogen. Der Lebenssinn ist aber kein möglicher Sachverhalt im Leben und damit eben auch kein Zweck, dem effektive Mittel im Sinne einer Glückstechnik zugeordnet werden können. Vielmehr ist er die wie auch immer entstehende Form des Lebens selbst, die sich je und je im Handeln, das um seiner selbst willen geschieht, manifestiert und herausbildet.
Aristoteles (1985). Nikomachische Ethik . Hrsg. v. G. Bien. Hamburg: Meiner.
Blumenberg, Hans (1979). Paradigmen zu einer Metaphorologie . Frankfurt a. Main: Suhrkamp
Heidegger, Martin (1927/1979). Sein und Zeit . Frankfurt a. M.: Klostermann.
Loh, Werner (1989). Erwägende Vernunft. Voraussetzungen und Hindernisse eines Philosophierens mit Alternativen. Prima philosophia 2 , 301 – 323.
Luckner, Andreas (2005). Klugheit . Berlin u. New York: de Gruyter.
Luckner, Andreas (2008). Heidegger und das Denken der Technik . Bielefeld: Transcript
Rhonheimer, Martin (1994). Praktische Vernunft und Vernünftigkeit der Praxis . Handlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der aristotelischen Ethik . Berlin: Akademie.
Thomas von Aquin (1933 ff.). Summa theologica . Deutsch-Latein. Salzburg: Pustet.
Die Unhintergehbarkeit der Reflexion in der anwendungsbezogenen Ethik – eine Positionsbestimmung in klugheitsethisch-topischer Perspektive
Philipp Richter
Die sog. „Angewandte Ethik“ ist heute gesellschaftlich und akademisch etabliert. Sie tritt vor allem in den Diskursen der Bereichsethiken und in verschiedenen Varianten von Beratungsgremien an Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen oder politischen Organisationen in Erscheinung. Wer sich mit dem Phänomen „Angewandte Ethik“ jedoch in theoretischer Absicht beschäftigt, betritt ein undurchsichtiges Feld: Unter dem Titel bieten zahllose Positionspapiere, Denkschriften und Ratgeber ganz unterschiedlicher Provenienz, aber auch wissenschaftliche und philosophische Abhandlungen sehr heterogene Einlassungen zu aktuellen Positionen und Methodenfragen der Moralphilosophie in ihrem Praxisbezug. Dabei zeigen sich – explizit oder implizit – deutlich konträre Konzeptionen von Angewandter Ethik, die zudem mit sehr unterschiedlichem Anspruch auftreten. Wie lässt sich mit dieser Vielheit unterschiedlicher und sich zum Teil widersprechender Ansätze umgehen? Zweifellos kann nicht jede der ethischen Äußerungen gleichermaßen wohlbegründet, überzeugend und richtig sein. Auch verbürgt die Verwendung des Titelwortes „Angewandte Ethik“ noch nicht, dass der Anspruch, eine philosophische 1 Reflexion von spezifischen Moralfragen zu leisten, auch tatsächlich eingelöst wird. Die Vielheit der konkurrierenden Ansätze wirft also die Frage auf, was das philosophisch-ethische Nachdenken über moralische Urteile und Moral im Konkreten – gewissermaßen „Ethik in Anwendung“ – von anderen Weisen der kognitiven Auseinandersetzung mit Praxis unterscheidet.
Nicht jedes Bezweifeln, Kritisieren und Diskutieren von gelebten Werten und Normen kann bereits als philosophisch-ethische Reflexion moralischer Urteile gelten. Problematisch erscheint vor allem, dass auch bei „bester Absicht“ die Ergebnisse des Nachdenkens letztlich doch durch unreflektierte Moralvorstellungen beeinflusst sein könnten – seien diese nun „noch nicht“ bedacht oder manipulativ eingesetzt – und somit letztlich nicht die vorgetragenen Argumente, sondern moralische Vormeinungen und Machtstrukturen zur Einstellungsänderung führen würden.2 Daher stellen manche Philosophinnen und Philosophen aus theoretischen Gründen die Möglichkeit einer „Angewandten Ethik“ überhaupt in Frage (Gehring 2015, Wolf 1994), wohingegen andere kein echtes Problem sehen, da Ethik wohlverstanden immer „praktisch“ sei (Fenner 2010, Vieth 2006). Es wäre natürlich denkbar, dass die Vielheit der oben erwähnten Positionen und Konzeptionen von „Angewandter Ethik“ unvermittelt nebeneinander stehen bleiben darf. Wenn wir jedoch annehmen, dass „Angewandte Ethik“ im Kern ein philosophisches Projekt ist, dann besteht notwendig ein Klärungsinteresse an der methodologischen Güte von ethischer Reflexion in konkreten Fragen. Nicht jede moralische Einlassung und nicht jede Methodenkonzeption von Angewandter Ethik kann in ein und derselben Hinsicht richtig sein – gerade die „Umsetzung“ allgemeinmoralischer Gesichtspunkte ist in der Argumentationssituation zumeist strittig und muss sich daher im Einzelnen als richtig oder falsch, besser oder schlechter begründet sowie als allgemein zustimmungsfähig, problematisch oder unverständlich etc. differenzieren lassen.
Dieses Erfordernis der epistemischen und methodologischen Differenzierbarkeit resultiert bereits aus dem Sokratischen Leitmotiv der Ethik, nur ein geprüftes Leben sei wert, gelebt zu werden, und nicht notwendig, wie manche meinen, allererst aus einer Auffassung von Ethik, die sich am Paradigma einer einseitig positivistischen Wissenschaftstheorie orientiert (vgl. Nida-Rümelin 2001: 156ff.; Nida-Rümelin 2005). Diesem Paradigma entsprechend würde Ethik und ihre Konkretisierung konzipiert nach dem Vorbild eines exakten, allgemeinen Regelwissens, das nach dem Verfahren der unpersönlich reproduzierbaren Induktion o. ä. und isolierbaren Deduktionstests nach dem Hempel-Oppenheim-Schema bestätigt würde bzw. zur „Anwendung“ käme (vgl. Fischer 2017: 4ff.). Aber nicht nur die durch den naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt inspirierten neuzeitlichen Ethikansätze, sondern auch Ansätze, die eine Aristotelische Konzeption von praktischer Philosophie als einem rationalen Umgang mit dem veränderlichen Bereich des Seins aufgreifen, müssen sich um eine klare, an methodischen Standards und Kriterien bemessene Differenzierung von bloß moralischen Aussagen und ethischen Theorien und Begründungen dieser Aussagen bemühen.3 Falls diese methodische Differenzierung und Reflexion nicht vorkommt, so bedeutet das, dass der Versuch des besseren Verstehens zugunsten einer vorfindlichen Moral als einem Komplex gelebter Werte und Normen abgebrochen wird. Hierzu lassen sich auch geteilte Auffassungen über fachliche Üblichkeiten, methodische Konventionen oder praktische Rahmenbedingungen zählen. Ein derartiger Abbruch der Reflexion kann durchaus stellenweise erwünscht oder erforderlich sein. Nur ist dieser Reflexionsabbruch dann wiederum höherstufig entweder ein reflektierter, der sich begründen und gegen schlechtere Alternativbegründungen verteidigen ließe, oder aber der Versuch des besseren Verstehens wird hier ohne weitere Begründung vertagt oder gänzlich aufgegeben. Eine vorbehaltlose, reflexive Klärung von moralischen und ethischen Vormeinungen, Aussagen und Begründungsansprüchen ist für eine philosophische Ethik jedoch unausweichlich. Daher ist es erforderlich, Strategien zur wohlbegründeten Differenzierung richtiger und falscher Urteile über die Umsetzung von allgemeinen Gesichtspunkten des Moralischen, Maximen, Normen sowie über methodische und argumentative Maßstäbe zu ermitteln. Diese methodologischen Fragen sind in der themabezogenen Literatur noch nicht abschließend bearbeitet worden. Im Gegenteil zeigen viele Ethikansätze hinsichtlich ihrer „Umsetzung“ eine deutliche Kluft zwischen dem theoretisch fundierten Anspruch auf Notwendigkeit der Erkenntnis und der Kontingenz auftretender Einzelfälle, Situationen oder dem Geschehen der Praxis. Negativ formuliert führt diese Kluft jedoch zu Ununterscheidbarkeit und Beliebigkeit in der Beurteilung der methodischen Qualität (vermeintlich) ethischer Überlegungen im Einzelnen.
Читать дальше