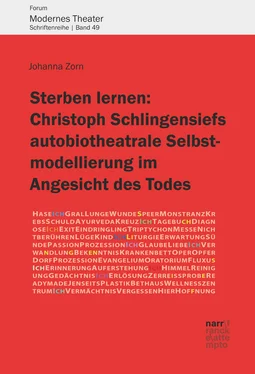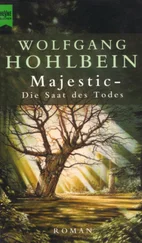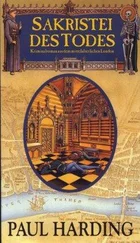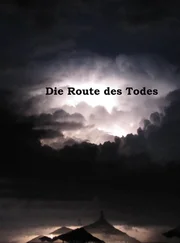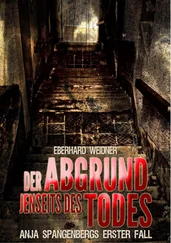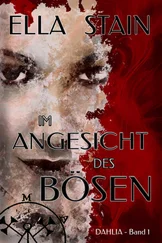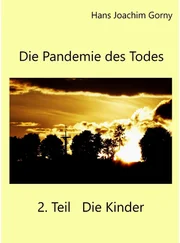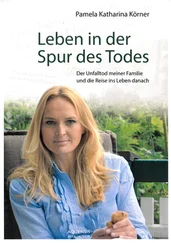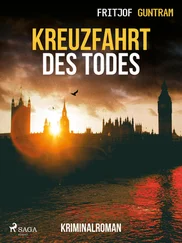Für Wolfgang Höbel hätte der Künstler, um aus der eigenen Krankheit, aus seinem Zorn, aus seiner Hilflosigkeit einen ergreifenden Theaterabend zu machen, allerdings „kein Fluxus-Brimborium“31 gebraucht, da die Kraft des Abends einzig „aus der Sprache von Schlingensiefs Krankenakte, manchmal auch aus dem Kitsch“32 gekommen sei. Höbel bewertete die christlich-rituelle Rahmung als Akzidens, das dem primären Ansinnen Schlingensiefs nach faktualer Lebensdarstellung auf der Basis autobiographischer Dokumente recht eigentlich zuwidergelaufen sei. Die Arbeit, so die Diagnose, habe durch die intermediale Verflechtung nicht an perspektivischer Vielfalt gewonnen, sondern sei ihrer möglichen Klarheit verlustig gegangen. Der Umstand, dass die medizinische Anamnese des Krankentagebuchs im Rahmen der Inszenierung einerseits über Tonbanddokumente zugänglich wurde, was einer nachdrücklichen wie irreführenden Suggestion von Authentizitätseffekten gleichkam, und andererseits durch die Lektüre von Schauspielern verfremdend zur Darstellung gelangte, warf nahezu flächendeckend die Frage auf, ob und inwiefern es sich bei Eine Kirche der Angst um Kunst, Leben oder beides zugleich gehandelt habe. Damit war ebenso zum wiederholten Mal das Bestreben einer ersatzreligiösen Erbauung wie die problematische künstlerische Funktionalisierung der „nackten Wahrheit“ angesprochen –, ein Topos, den schon Nietzsche ganz grundsätzlich in Abrede stellt und Hans Blumenberg im metaphorischen Feld von Bekleidung und Verkleidung verortet, da sich Wahrheit notwendigerweise in die Phänomene des Durchschautseins, der Maskierung und der schamverletzenden Enthüllung differenziert.33 Auf der Grundlage des ästhetisch problematischen Zusammenschießens von Authentizitätsanspruch und Selbststilisierung stellte sich Ulrich Seidler die Fragen, ob es dem Künstler Schlingensief überhaupt möglich war, beides gleichzeitig zu vertreten und, ob sich die Rezipienten seines Fluxus-Oratoriums auf der Seite seiner Kunst und seines Lebens zugleich aufhalten konnten, und gelangte dabei zu einem eindeutig negativen Urteil:
Bei Schlingensief sind die Grenzübergänge zwischen Kunst und Leben vielleicht schlechter bewacht, erlauben ein reges Hin-und-her und ziehen inzwischen einen Großteil der interpretatorischen Aufmerksamkeit auf sich. Aber man kann sich dennoch nicht – auch nicht bei Schlingensief – gleichzeitig auf beiden Seiten aufhalten.34
Peter Kümmel wiederum bezeichnete die theatrale Umspielung der eigenen Krankheit unter dem von Elias Canetti entlehnten Motto „Ihn brennt der Tod“35 als logische Konsequenz des künstlerischen Ansatzes Schlingensiefs, der das Lavieren zwischen Realität und Fiktionalität, zwischen wahrhaftiger Aussage und inszenierter Behauptung schon vor der Krebsdiagnose zum künstlerischen Credo stilisiert hatte:
Er hat sich stets geweigert, zwischen Kunst und Leben zu unterscheiden, er war zu dieser Trennung gar nicht fähig, und so war klar, dass seine verheerende Krebserkrankung, die im Januar öffentlich wurde und die ihn einen Lungenflügel kostete, Teil seines Werkes werden würde.36
Durch die Rede vom Einbrennen verwies Kümmel über den Autor Canetti zugleich auf die philosophisch-ästhetische Topologie des Schmerzes, die der selbstvergessenen Erfahrung von Lust die bewusstseinsfördernde Funktion des Schmerzes entgegenstellt. In diesem Sinne bezeichnet bereits Kant die Pein als „Stachel der Tätigkeit“37, durch die „wir allererst unser Leben“38 fühlen. Sigmund Freud wiederum verortet den Schmerz, in dem das zunächst allumfassende Ich sich in das „enge und schärfer umgrenzte […] Ich-Gefühl“39 zusammenziehe, im konstitutiven Bereich der Subjektwerdung. Nietzsche stellt in der Genealogie der Moral (1887) gar einen Konnex zwischen Schmerz und Erinnerung her, indem er das gewaltsam aufgezwängte Mal als die ewig im Gedächtnis bleibende Spur definiert: „Man brennt Etwas ein, damit es im Gedächtniss bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtniss.“40
Von der in das Leben des Regisseurs eingebrannten Wunde des bevorstehenden Todes wurde man auch als Zuschauer des künstlerischen Lebensbeweises tingiert. Der Journalist Dirk Pilz fand angesichts der Theatralisierung des Schmerzens-Ichs Schlingensief in diesem Sinne wieder zum „Kinderglauben“41 zurück, wonach „Kunst noch direkt ins Zuschauerleben eingreifen, es verändern und verwandeln“42 könne. Ebenso sah Peter Kümmel hinter der öffentlichen Zurschaustellung der persönlichen Wunde die Evokation einer Teilhabe der Gemeinschaft der Rezipienten. Mit dem Bild der liturgischen communio initiierte Schlingensief, der im Rahmen der Inszenierung das Brot brach und den Wein trank, demnach eine Ritualisierung des Ichs und sprach damit nicht nur die eigene, sondern die existentielle Angst aller an:
Im Lauf des Abends begreift man seine Aktion immer weniger als den Akt eines wahnwitzigen Narzissten, der in unseren Blicken baden will. Man kommt dahin, Schlingensiefs Aktion auch als Akt der Großzügigkeit zu begreifen: Ein Mann vergesellschaftet seine Angst, er stellt sie uns wie einen Überschuss an Wärme zur Verfügung.43
Die vom Regisseur in einem Interview selbst als „Kampfsituation“44 bezeichnete kritische Reflexion über seinen Glauben rief schließlich auch eine katholische Tageszeitung auf den Plan. So kritisierte Johannes Seibel von Die Tagespost den Umstand, dass Schlingensief seine Krankheit nicht in stiller Kontemplation erdulde:
[I]m Prinzip tut Schlingensief genau das, was er angesichts der Wucht der Krankheit, an der er leidet, vorgibt, nicht länger tun zu wollen, nämlich ein simuliertes Leben zu leben. Er simuliert die Nichtsimulation seiner Krankheit, und das Denken an das Sterben wird schon wieder dramatisch, es wird inszeniert. Anstatt zu verstummen, sich zurückzuziehen, Gedanken zu fassen, was die angemessene Reaktion auf die angeblich von Schlingensief gewonnene Einsicht wäre, wie hinfällig doch das Leben sei, übernimmt er sofort wieder die Rolle, die nämlich des Leidensbeauftragten. Und schon wieder wird das Sterben öffentlich als Tragödie verhandelt, als heroische Kampfsituation, als Herausforderung für echte Berserker.45
Dem von katholischer Dogmatik durchdrungenen Kommentar Seibels, der die anthropologische Konstante von Selbstinszenierung ebenso verschweigt wie das im Ritual sich ereignende Moment des Offenen, der Transgression, steht das Abwägen einer Vielzahl von Rezensenten gegenüber, ob Schlingensief sich selbst in Anbetracht der konkreten Möglichkeit des Todes unmäßig wichtig genommen habe – wobei die Parallelisierung seines Leids mit der Passion Christi dem Eindruck der Hypertrophie Vorschub leistete – oder, ob gerade im schonungslosen Exhibitionismus nicht doch die unerhörte und brisante Qualität der Inszenierung lag. Diese Unentschlossenheit hatte ganz offensichtlich damit zu tun, dass das Ich selbst zum Träger einer dem Gesamtkunstwerksgedanken eingeschriebenen Überwältigungsstrategie und mithin einer Idee des Absoluten wurde. Auf das von Bazon Brock ausgeführte Dispositiv von „Totalkunst“46, dem in Radikalisierung des Gesamtkunstwerks die Absorption von Allem unausweichlich zugrunde liegt, rekurrierte implizit Egbert Tholl in der Süddeutschen Zeitung . Der Kritiker stand dem Abend zwar „bewundernd ob [seiner] Schonungslosigkeit“47 gegenüber, stellte letztlich jedoch irritiert fest, dass der Künstler keine offene Kommunikation über seine Ängste in Gang setzen konnte, da „[a]lles an diesem Abend […] Schlingensief und nur er“48 gewesen sei.
Die Einbettung des persönlichen Zustands in die liturgische Form evozierte letztlich höchst zwiespältige Reaktionen unter den Kritikern, die zwischen Bewunderung und Irritation changierten. In den Augen vieler Rezensenten war die schonungslose Thematisierung von Schlingensiefs Angst, die in erster Linie Anteilnahme provozierte, zumindest verantwortlich für die Unkritisierbarkeit des Abends. Da sich eine Messe nicht kritisch distanziert rezipieren, sondern lediglich feiern lasse, entzöge sich die kunstreligiöse Ritualisierung des Privatmenschen Schlingensief in Eine Kirche der Angst von vornherein des begrifflichen Inventars der Theaterkritik.49
Читать дальше