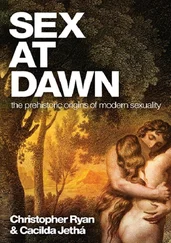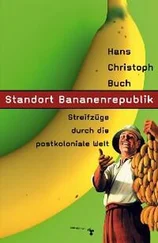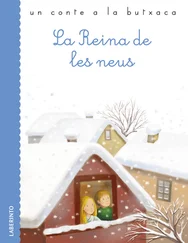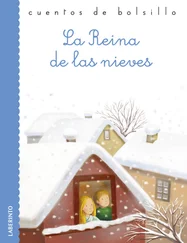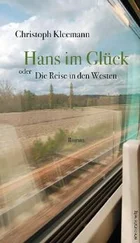Zentral sind in diesem Zusammenhang die Plausibilitäts- und Dispositionsfragen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters, die sie an die Erzählwelten stellen. Im Unterschied zu Plausibilitätsfragen von Zuhörer/innen, die sich auf den Ich-Fokus narrativer Identitäten richten, zielen Plausibilitätsfragen von Leser/innen auf den Fiktionsstatus von Romanen. Romane vergegenwärtigen Ereignisse poetisch im Erzählten. Ihr „Erkenntniswert (besteht) in einer Vergegenwärtigungsleistung“.27 Narrative Identitäten vergegenwärtigen ebenso. Mit zunehmendem Alter der Erzähler/innen werden sie bedeutungsvoller und intensiver. Lebenserfahrungen werden teleologisch und adressatenbezogen in linearer, temporaler und kausaler Verknüpfung, mit markiertem Anfangspunkt, auf einen sinnstiftenden Endpunkt hin erzählt.28 Aber mit einem wichtigen Unterschied gegenüber Romanen: Narrative Identitäten weisenteleologisch zurück und vergegenwärtigend hin. Sie weisen aufgemachte Erfahrungen und versuchen sie in den kohärenten Zusammenhang eines und dannzu bringen. Der Referenzcharakter narrativer Identitäten zielt auf Kohärenz und Plausibilität gemachterErfahrungen, die, wie juristische Plädoyers biografische Ereignisse geordnet und/oder assoziativ zusammenziehen und durch Dokumente belegen können, um außergewöhnliche Handlungen „von gängigen Normalitätserwartungen“ plausibel zu unterscheiden.29 Demgegenüber verzichten Romane auf „verweisende Bezugnahme“, auf Referenz.30 Romane stellenautoreferenziell darund ermöglichen eine Konfrontation mitfiktionalen Erfahrungen und damit eine „Richtungsänderung des Bedeutens“, die die reflektierende Urteilskraft der Rezipient/innen auf der Suche nach Deutung und Sinn aktiviert.31 Während Identität als narrative Konstruktion „stets von Brüchigkeit gekennzeichnet ist“32, sind Romane kontingenzästhetisch strukturiert und verweisen im Erzählen des Erzählens auf ein Spiel mit Brüchen in und mit der Fiktion – siehe z.B. Miguel Cervantes‘ Roman Don Quichote, Laurence Sternes‘ Roman Tristram Shandy,Virginia Woolfs Roman The Waves, JamesJoyces Roman Ulysses,Günter Grass‘ Roman Die Blechtrommel.Dieses Spiel macht ihre Gesinnung zur Totalität aus und lässt sie zur gegenweltlichen Zeitdiagnose für Rezipient/innen des dritten Lebensalters werden. Der Strukturunterschied, der Romane und narrative Identität voneinander unterscheidet, macht narrative Identität zu einer literarischen „Mischform“33, die das Erschließen fiktional erzählter Welten in ästhetischer Distanz ermöglicht. Plausibilitätsfragen sind also die von den Lebenserfahrungen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters bereitgestellten Bedingungen einer kreativen Auseinandersetzung mit den fiktiven Texturen erzählender Literatur. Literarische Texte werden im Lichte der riskierten Ganzheit der Lebenserwartungen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters zu bedeutsamen Möglichkeitsräumen, in denen sie sich als ganze Menschen wiedererkennen: als Individuen mit Ängsten und Hoffnungen, mit Widersprüchen, mit Abgründen und als Individuen, die kreativ und zerstörerisch sein, lieben und hassen können und Visionen haben. Zu symbolischen Gedächtnismedien werden Romane also dadurch, dass sie im Akt des Fingierens Elemente der drei Kulturdimensionen, mithin „Elemente der außerliterarischen Realität“, in andere imaginäre, diffuse Bedeutungen ohne Objektreferenz überführen.34 Damit irrealisieren sie empirische Wirklichkeitselemente und weisen ihnen fiktional den Status der Realität zu. Als Ausdrucksformen des kulturell Imaginären35 verdichten moderne Romane, durch Rückgriffe Vergessenes, Erinnertes und Zukunftsweisendes ihrer Kultur. Durch Neu- oder Umstrukturierungen temporaler und kausaler Ordnungen eröffnen sie im Rezeptionsakt Analogien, die, im Rahmen des kollektiven Gedächtnisses moderner Erfahrungen, kulturspezifische Schemata des 19. Jahrhunderts mit Schemata individuell kulturellen Erinnerns des 20. und 21. Jahrhunderts aktualisierend verknüpfen. Beide Formen des kollektiven Gedächtnisses, nämlich kulturelles Erinnern als individueller Akt und das Gedächtnis der Kultur in den ästhetischen Formen der Romane des Viktorianischen Zeitalters sowie der frühen Moderne, wirken durch ihre jeweilige narrative Struktur im Zusammenspiel von individueller und kollektiver Ebene im Rezeptionsakt zusammen.36 Mit Paul Ricoeur kann man diese Aktualisierung kultureller und biografischer Muster als Refiguration bezeichnen, in der die Dynamik der erzählten Welten an ihr Ziel kommt: „Erst inder Lektüre kommt die Dynamik der Konfiguration an ihr Ziel. Und erst jenseits der Lektüre, in der tatsächlichen Handlung, die bei den überkommenen Werken in die Lehre gegangen ist, verwandelt sich die Konfiguration des Textes in Refiguration.“37 Rezeptionsästhetisch bedeutet diese Aktivität der Leser/innen, dass ihr Selbst- und Weltbild, ihre Werte und Normen aufs Spiel gesetzt und Erfahrungen ihrer transitorischen Identität affiziert werden. Zudem öffnen sich ihnen Potenziale narrativer Identität und transgenerationaler Diskurse. 1.3 Die Refiguration des Paradigmas moderner Identität Der moderne Roman als offenes Genre, so wurde eingangs erläutert, spricht, indem er sie narrativ gestaltet, transitorische Identitätserfahrungen an und lässt sie in der Interaktion zwischen Text und Leser/innen thematisch werden. Die Grundstruktur dieser Interaktion besteht darin, dass der literarische Text nicht als ein Objekt begriffen wird, das sich von außen analysieren lässt, sondern als ein, wie oben gezeigt, subjektiver Weltentwurf, durch den Leser/innen zu kreativen Mitspielern werden. Die Welt des narrativen Textes entsteht in der Interaktion zwischen Text und Leser/innen. Das bedeutet, dass literarische Texte von den Erfahrungen her, die Leser/innen mit ihnen machen, verstanden werden müssen. Ästhetische Erfahrung wird zur transformativen Energie, die den Horizont der Rezipient/innen, unter Rückbezug auf das individuelle Vorverständnis, für Neues öffnet.1 Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne geben ihren Protagonistinnen und Protagonisten als Waise und Außenseiter Gestalt. Mit Helmut Plessner und Karl Jaspers formuliert, symbolisieren sie die exzentrische Positionalität des Menschen in Grenzsituationen. Auf der Suche nach dem Ich, die diese Romane als transitorisches Werden zu sich selbst gestalten, werden sie mit Erfahrungen des Leidens, der Krankheit, des Kampfes um Liebe, des Zufalls und des Todes konfrontiert. Hunger, Kälte und Illusionsverlust kommen hinzu. Nach Karl Jaspers sind dies keine philosophischen, sondern existenzerhellende Grenzsituationen des Menschen, denen man nicht ausweichen, die man aber mit dem Mut zum Neubeginn bewältigen kann.2 Das trifft auch auf den eigenen Tod zu: Der Tod ist nur als ein Faktum eine immer gleiche Tatsache, in der Grenzsituation hört er nicht auf zu sein, aber er ist in seiner Gestalt wandelbar, ist so, wie ich jeweils als Existenz bin. Er ist nicht endgültig, was er ist, sondern aufgenommen in die Geschichtlichkeit meiner sich erscheinenden Existenz.3 Grenzsituationen als lebendige Notwendigkeit erfahren, heißt folglich, sie zum Eigentlichen unserer Existenz werden lassen: „(…) wir werden wir selbst, wenn wir in die Grenzsituationen offenen Auges eintreten. Sie werden, dem Wissen nur äußerlich kennbar, als Wirklichkeit nur für Existenz fühlbar. Grenzsituationen erfahren und Existieren ist dasselbe. In der Hilflosigkeit des Daseins ist es der Aufschwung des Seins in mir.“4 Die Nicht-Endgültigkeit der Endgültigkeit des menschlichen Todes stellt ein Paradoxon dar: Zwar macht jeder Mensch die Erfahrung, dass andere Menschen sterben können, aber die Bedeutung von Tot-Sein kann man nicht erfahren.5 Jaspers bringt die Erfahrungen der Grenzen menschlichen Daseins, auch das Paradoxon der menschlichen Todeserfahrung, in den Zusammenhang der Fähigkeit des Menschen zur immanenten Transzendenz: Der Einzelne könne, so Jaspers, als Teil einer Gesamtheit, mit der er kommuniziere, seine Existenz verstehen.
Читать дальше