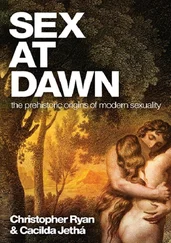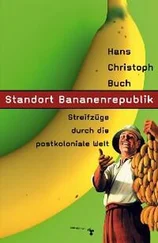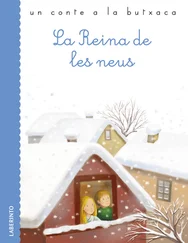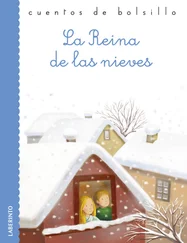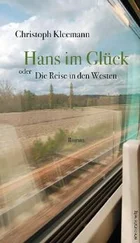68 Möglichkeiten einer „Verarbeitung eigener Verletzlichkeit“69 in Bezug auf diese Erfahrungen bieten Kunstwerke, die die Pathologien der reflexiven Moderne ästhetisch verfremdet zur sinnlichen Erfahrung und zur kultursemiotischen Reflexion anbieten, aber auch intergenerationelle Kommunikationsformen in Familien, Schulen, Gemeinden, Kulturinstitutionen. In der Auswertung von Interviews der Greontologie der Universität Heidelberg, die diesbezüglich im Blick auf die Generativität und Mitverantwortung im hohen und sehr hohen Lebensalter durchgeführt wurden, wurde deutlich, dass im Alter zwar die Intensität der Erinnerungen an Emigration, Lagerhaft und weitere Leiden an der Gesellschaft intensiver werden, dass es den interviewten Frauen und Männern „aber zugleich gelinge, diese belastenden Erinnerungen zu verarbeiten, da sie schon seit Jahren in einem intensiven Dialog mit Schülerinnen und Schülern stünden, in dem sie ihr kulturelles, historisches und politisches Wissen weitergeben und damit junge Menschen zusätzlich für die Bedeutung sensibilisieren könnten, die auch der persönliche Einsatz für Menschenrechte, Demokratie und Frieden für das friedliche Zusammenleben von Völkern und Ethnien besitze.“70 Diese Haltung gegenüber der inneren Bedrohtheit und die Öffnung auf Mitverantwortung und Zukunftsverantwortung erweist sich als Entschiedenheit einer persönlichen Autonomie, die flexibel unangepasst mit würdeverletzenden Vergangenheitserfahrungen und demokratischen Notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft umzugehen weiß. Vergleichbar Kathartisches geschieht in Rezeptionsprozessen, die sich mit Kunstwerken bzw. Literatur auseinandersetzen. Fiktionale Narrative regen Kreativität an, weil sie ein Gefühl für Kontinuität und Ganzheit erzeugen und zugleich – und dies gilt für die Romane des Viktorianischen Zeitalters wie auch für Werke der klassischen Moderne – ein Gefühl riskierter Ganzheit entstehen lassen. Moderne Romane spenden keinen Trost. Vor dem Hintergrund einer reflexiven Moderne evozieren sie beunruhigende Fragen, die an Erinnerungen des Vertrauens- und Autoritätsverlusts, an Krisen, Hunger und Kälte, Verlorenheit, Heimatlosigkeit und menschliche Mortalität rühren. Mit diesen ästhetischen Erfahrungen setzen die Rezipient/innen des dritten Lebensalters ihr Selbst- und Weltverständnis aufs Spiel setzen und initiieren komplexe Diskurse. 1.4 Transitorische Identität und die Bedeutung literarischer Texte in der ersten und zweiten Phase der Modernisierung Am Beispiel moderner Romane können Rezipient/innen des dritten Lebensalters erforschen, wie diese Leben und Kultur ihrer Zeit narrativ verdichtet konfrontieren. In der Interaktion mit den Texten und ihren komplexen emotionalen Situationen, deren Grundstruktur oben dargelegt wurde, können sie über erschließendes Lesen zunächst eigene Deutungen entwerfen und über die reflektierende Lektüre das ästhetische Fremde so refigurieren, dass die Epoche, in der die literarischen Texte als ihr ästhetisch Fremdes gestaltet wurden, nicht auf Bekanntes und Gegenwärtiges reduziert werden. In dieser rezeptionsästhetischen Situation schwingen kultursemiotisch persönliches und kulturelles Gedächtnis zusammen und gegeneinander; die Subjektivität der Rezipient/innen wird transzendiert.1 Dabei erproben und besprechen sie, wie man im Anschluss an die Auseinandersetzung mit Erzählwelten eine eigene Sprache für Verluste und Leid gegen das delegierte Schweigen der Eltern finden und narrativ Möglichkeiten individueller Mündigkeit in angstfreier Nähe mit anderen riskieren kann.2 Bürgerliche Romane wirkten seit dem 18. Jahrhundert kathartisch. Sie lösten Gefühlsstürme aus und forderten zeitgenössische Moralvorstellungen heraus, weil sie ästhetisch verfremdet das bürgerliche Selbst in seiner Widersprüchlichkeit, Bedürftigkeit, Habgier und Ganzheitssehnsucht bloßstellten. Franco Moretti hebt die heterogenen Eigenschaften des europäischen Bürgertums hervor, die seit dem 18. Jahrhundert die Koexistenz gegensätzlicher Wertvorstellungen ermöglichten und die Entschlusskraft des Bürgertums mit einem Unbehagen an der Gesellschaft verbanden. Diese für die Mittelschicht typische Selbstwidersprüchlichkeit, die Kompromisse zwischen unterschiedlichen ideologischen Systemen bilden konnte,3 enthielt durch „ selbstauferlegte Blindheit“,insbesondere der Viktorianer,4 Tendenzen zur Selbstverschleierung, die von den Romanen der Viktorianischen Zeit in den unterschiedlichen Varianten, wie sie beispielsweise Charles Dickens, Elizabeth Gaskell oder die Brontës vorlegten, gegen gesellschaftliches Nützlichkeitsdenken, thematisiert wurden. Da die Begriffe Moderne, Modernismus und Postmoderne weder als Ideologien, noch als rivalisierende Ästhetiken angemessen zu verstehen sind – „‘modernity‘ is an imprecise and contested term“5 –, eher als „sozio-linguistische Situationen“, im Rahmen „gesellschaftliche(r) und historische(r) Problematiken“6, lassen sich moderne Romane als ästhetisch Fremdes ihrer Kultur und als offen-komplexe narrative Strukturen verstehen und nicht auf begriffliche Aussagen reduzieren. Ihre Vieldeutigkeit macht ihren ästhetischen Charakter aus. Moderne Romane konfrontieren die instrumentelle Vernunft ihrer Zeit mit narrativen Unschärferelationen, in der die Negativität der Weltungesichertheit mit der Haltlosigkeit des Subjekts zu einer Metaphysik des Schwebens verknüpft ist. Mit Joshua Kavaloskis Forschungen zur klassischen Moderne kann man sagen: „In the nineteenth century, art’s primary function was presumably the portrayal of bourgeois self-understanding and thus it gradually evolved into a cultural form without a utilitarian role in society.“7 Einem Vorschlag Peter V. Zimas folgend, lässt sich die Metaphysik des Schwebens moderner Literatur und Romane kulturkritisch als Entwicklung „von der Ambiguität zur Ambivalenz und von der Ambivalenz zur Indifferenz“8 deuten. Die Ambiguitätliterarischer Texte verortet Zima im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Romane Jane Austens und die Balzacs vermochten, so Zima, „den wahren Charakter ihrer oft zweideutigen Gestalten (…) und mit Hegel das Wesen hinter den Erscheinungen (aufzudecken)“.9 Dass dies nicht für Dickens‘ Romane, auch nicht für Oliver Twist(1837) gilt – in Dickens‘ Romanen liegt das zentrale Problem in der Erforschung der Haltlosigkeit des modernen Subjekts, die den Warenwert der Menschen in Frage stellt – soll im dritten Teil gezeigt werden. Die Ambivalenz literarischer Texte – Ambivalenz, verstanden als Zusammenführung unvereinbarer Gegensätze oder Werte, ohne Synthese10 – sieht Zima im Zusammenhang von Friedrich Nietzsches Philosophie, Sigmund Freuds psychoanalytischen Forschungen und Karl Marx‘ Frühschriften. Der Ambivalenz liegt, so Zima, der Gedanke der Vertauschbarkeit z.B. von Herr und Knecht, Gott und Teufel, Mensch und Ding zugrunde. Michail Bachtins Verdienst sei es gewesen, Ambivalenz mit dem Zusammenbruch der Hierarchien und der Umwertung der Werte als Karnevalsgeschehen sowohl in der älteren, wie auch in der modernen Literatur verknüpft zu haben.11 Der moderne Roman, so folgert Zima, „(…) könnte als ein Text gelesen werden, in dem Nietzsches und Freuds Erkenntnisse über die Verknüpfung unvereinbarer Werte und das Zusammenwirken einander entgegengesetzter Regungen gebündelt und ins Fiktionale projiziert werden.“12 Subjektivität als Gestaltungsprinzip moderner Romane impliziert eine Abwendung von instrumenteller Vernunft und kalkulierendem Bewusstsein, so dass das Unterbewusstsein zum Impulsgeber der Romane wird und die Macht des Begehrens in narrativen Gestalten des Bösen Tendenzen zu Destruktion und Selbstzerstörung zeitigt.13 Ambivalenz als Mehrdeutigkeit der Moderne (Zygmunt Bauman) wird mit ihren divergierenden Deutungsmöglichkeiten zum Strukturprinzip moderner Romane. Romane des Viktorianischen Zeitalters, die die Ambivalenz als Paradoxie des poetischen Realismus gestalten und Romane des frühen 20. Jahrhunderts gehen, wie im dritten Teil zu zeigen ist, noch einen Schritt über das Paradigma der Ambivalenz, das sie gleichwohl auch zum Ausdruck bringen, hinaus: Die in kulturell sanktionierten Gegensätzen ästhetisch gestaltete Vertauschbarkeit zielt auf ihre Ähnlichkeit und damit auf „Vertauschbarkeit als Indifferenz“14, wobei sich in Dickens‘ Roman Oliver Twistund in Charlotte Brontës Roman Jane Eyredas Verhältnis von Subjektivität und Negation, von Mehrdeutigkeit subjektiver Weltbezüge und deren Undurchschaubarkeit, in einer Haltlosigkeit des Ichs zum Ausdruck bringt, die nicht selbstzerstörerisch angelegt ist, sondern trotz resignativer Tendenzen, Chancen zulassen, privates Glück erlangen zu können. Die Wunschvorstellung bleibt leitend, „daß der Mensch auf Erfüllung angelegt ist (…)“.15 In Emily Brontës Roman Wuthering Heightshingegen verdichtet sich unstillbares Begehren als Energie des Negativen, bzw. Destruktiven, für das es keine Erlösung gibt. In Virginia Woolfs Roman Mrs Dallowayschließlich wird die Metaphysik des Schwebens in einer Multiperspektivität gestaltet, die die Ambivalenz von Leben (Clarissa Dalloway) und Tod (Septimus Warren Smith) in der Haltlosigkeit moderner Subjektivität zum Ausdruck bringt, vor dem Hintergrund der Folgen des Ersten Weltkrieges, der Europa in einen Sog von Gewalt und Zerstörung hineinzog. Die im dritten Teil vorgestellten Romane enthalten in der Transzendierung des Gegebenen und Positiven metaphysische Reste der Moderne16 als Metaphysik des Schwebens, in der sich Schein und Sein, Anschauung und Reflexion verbinden. In Dickens‘ frühem Roman Oliver Twistbestehen metaphysische Reste der Moderne in der gegenläufigen, quasi schicksalhaften Handlungsführung und einer narrativ zwar vorbereiteten, dann aber im Sprung herbeigeführten märchenanalogen, schicksalsähnlichen Problemlösung, die die erzählerische Ordnung auf ihre Kontingenzen hin autoreferenziell aufleuchten lässt. In Charlotte Brontës Roman Jane Eyresind überirdische Klänge und Stimmen, für die Jane empfänglich ist, ihre Androgynität, und, im letzten Drittel des Romans, die Natur als schützende Gottheit, sowie Janes persönliches Gottesverhältnis, das sie in eine wirksame Kontrolle sich selbst und ihrem Alter-EgoRochester gegenüber umsetzt, sowie das Echo einer Absolution,17 das St John Rivers in den ihm vom Roman erteilten Worten als Abwesendem und Verstorbenen, in den Mund gelegt wird, als metaphysische Reste der Moderne anzusehen. In Emily Brontës Roman Wuthering Heightskommen in Folge der radikalen Absage des Romans an religiöse Erlösungsgewissheiten, eine konventionsüberschreitende Liebesbeziehung zwischen Catherine und Heathcliff (sofern man von einer Beziehung im konventionellen Sinne sprechen kann), eine unbezähmbare innere und äußere Natur, die zur Quelle von Vitalität und Transzendenz wird, eine dezentrierte narrative Struktur, die diese Transzendenz hervorbingt und in einen überpersönlichen Bereich der Mythologie oder des Todes überführt,18 als metaphysischen Reste der Moderne ins Spiel. In Virginia Woolfs Roman Mrs Dallowaywird die Metaphysik des Schwebens in der Harmonie der Gegensätze – ein Erbe der europäischen Romantik19 – gestaltet. Der Roman bringt die Verwandschaft der Gegensätze als immanente Transzendenz20 erzähldynamisch zum Ausdruck, ohne sie zur Synthese zu führen. Sieht man mit Georg Bollenbeck Kulturkritik als normativ aufgeladenen „Reflexionsmodus der Moderne“, der „(…) bestimmte Haltungen und Denkmuster (hervorruft), die nicht Wissen sind, sondern (…) die Verarbeitung und Produktion von Wissen ermöglichen (…)“21, dann antizipiert die Ambivalenzstruktur moderner Romane transitorische Identitätserfahrungen, die seit der Epoche der Revolutionen zwischen 1790 und 188022 moderne Subjektivitätserfahrungen bestimmen. In die Romane gehen kulturkritische Vorstellungen ein, für die „etwa zwischen 1760 und 1800“23in Großbritannien Grundlagen geschaffen werden, die ab 1780 „ihren Ausdruck in der Lyrik, im Versdrama, aber auch im Roman finden“.24 An dieser historischen Epochenschwelle, die am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt und sich während des 19. Jahrhunderts entfaltet,25 in der „die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zur Grunderfahrung aller Geschichte“ wurde,26 entwickelt sich die moderne bürgerliche Gesellschaft. Diese erste bürgerliche Moderne ist gekennzeichnet durch den „Antagonismus zwischen Rationalismus und Ästhetik“.27 Die bürgerliche Kunst entwickelte einen eigenen Autonomieanspruch, der sich am „Regelbruch“ orientiert und auf Gestaltung des „überraschend() Neuen“ setzt.28 In Literatur, Musik, Bildender Kunst und im Theater entsteht ein ästhetischer Reflexionsmodus, der „Gewinne und Verluste der Moderne“29 ästhetisch transformiert und in der Sensibilisierung für diese Transformationsprozesse kulturkritisch Verarbeitungsangebote macht. Im Verhältnis von Fiktion und geschichtlicher Wirklichkeit kommt dem Erzählen von Geschichten die antizipatorische Emphase zu, nicht „das, was geschehen ist und wie es sich zufällig traf“ historiografisch zu berichten, sondern das „was geschehen könnte“ begrifflos zu erzählen.30 Ästhetische Utopien bilden eine „ästhetische() Gegensphäre“31 zu gesellschaftlicher Rationalität und weisen voraus auf eine mögliche Vervollkomnung des Menschen. Das Feld des Ästhetischen wird zum anderen der Moderne und des rationalisierten Sozialen, es konzentriert sich auf „individuelle(s), psychisch-leibliche(s) Erleben“.32 Während in der Zeit um 1800 in den wissenschaftlichen, religiösen, natur- und sozialwissenschaftlichen Diskursen Prägemuster der Identität und des Weiblichen aufgrund der Sinnkrise entfaltet werden, die aus der ökonomischen und politischen Entwicklung des Bürgertums resultiert, erfolgt konsequenterweise „deren eigentliche Differenzierung und Problematisierung (…) erst in literarischen Texten“.33 Differenziert und problematisiert wird das Männlichkeitsideal des Paternalismus, dem Autonomie, Gleichheitsdenken, gesellschaftliche und künstlerische Identität, ein proteisches Ich in Werken der Kunst entgegengesetzt werden. Autorschaft bedeutet für weibliche und männliche Schriftsteller/innen um 1800 Gleichberechtigung, Zeitgenossenschaft und Aufhebung erzwungener Passivität für Frauen.34 Diese Signaturen emanzipierter Autorschaft schlagen sich in der Gestaltung künstlerischer Werke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, so bei Dickens, bei Charlotte und Emily Brontë und bei Virginia Woolf nieder. Peter Gay bezeichnet den Zeitraum der Ablösung der Künste vom Patronagesystem um 1800 als entscheidende Epoche, die die „cultural revolution“35 vorbereitet, die mit der Individualisierung der Künstler und ihrer Abhängigkeit von Marktmechanismen, neue Gestaltungsmittel hervorbringt. Die ästhetischen Revolution, die mit dem „epochale(n) Wandel“36 um 1800 beginnt, weist den Weg in die moderne Avantgardebewegung der Künste: Dickens, Charlotte und Emily Brontё werden zu erzählerischen Wegbereitern der Moderne. In dieser Zeit entwickelt sich der industrielle Kapitalismus, der sich durch technische Beschleunigung und die Beschleunigung des sozialen Wandels auszeichnet. Verlässliche Traditionen und Werte verändern sich immer schneller, Gewissheiten und Verlässlichkeiten nehmen ab, Unsicherheiten nehmen zu, wie oben gezeigt, steigt die Wählbarkeit der Identitätsoptionen ebenso, wie das Kontingenzbewusstsein der Individuen und Potenziale einer flexiblen transitorischen Identität. Die Moderne zwischen 1790 und 1880 ist eine Epoche der Revolutionen, die ein neues Zeitbewusstsein mit radikaler Öffnung auf Zukunft und das Gefühl hervorbringt ungleichzeitig mit der Vergangenheit zu leben.37 Diese „Kulturschwelle“38, die die persönliche Identitätsfrage nach dem Woherund Wohindes Subjekts und seiner erlebten Gegenwart evoziert, geht in die Romane Dickens‘ und die der Schwestern Brontë als erzählerisch gestaltete Subjektivitätserfahrung, als transitorische Identitätserfahrung ein. Moderne Identitätserfahrung, die in Werken der Literatur antizipiert wird, (…) schließt begriffslogisch weder Ambivalenz noch Bewegung und Wandel aus, wenn er nicht den Zustand der Person, sondern die Aspiration, die der Bewegung durchaus widersprüchliche Richtungen gibt, bezeichnet.39 In England spricht man zu Beginn der Moderne von einer Epoche der Krisen (1760–1815) und in der Weiterentwicklung zwischen 1815 und 1880 von einer Epoche der Industrialisierung, der Demokratisierung, des sich entwickelnden Empire, zu denen die industrielle Revolution, die Erschließung der Weltmärkte, Aufstände in Irland, politische Reformen und politischer Radikalismus, der Krieg mit Frankreich, Urbanisierung, Massenarmut, als gewaltige gesellschaftliche und kulturelle Transformationen mit einem neuen bürgerlichen Geschichtsbewusstsein einhergingen, das in der englischen Romantik Kontur gewann. Es war eine Epoche, in der feudale, statische Ordnungen endgültig aufgelöst wurden, das gesellschaftliche Leben sich im Zeichen eines raschen Wandels vollzog und die Literatur „jene unübersehbaren Sinnverluste und sozialen Verwerfungen, die der Moderniserungsprozess (…) mit sich brachte, zu erkunden, mitzuteilen, zu kritisieren und mithilfe schöner Gegenbilder auszugleichen “40versuchte. Diese erste Modernisierungsphase wurde von einer von 1880 bis 1930 bestimmten Umbruchspahse abgelöst,41 die durch ein radikal verändertes Zeitbewusstsein, hohes Tempo, eine Zunahme der Massengesellschaft, den Verlust von Orientierung und Werten gekennzeichnet war. Ulrich Beck spricht von einer Zweiten Moderne, Peter Wagner von einer erweiterten liberalen Moderne, Wolfgang Welsch von einer postmodernen Moderne.42 Krisensymptome dieser Epoche sind vor allem, dass Errungenschaften der Aufklärung, wie Rationalität, Autonomie des Individuums, Fortschritts- und Glücksstreben, sowie politische Ordnung und marktwirtschaftliches Handeln verstärkt in Zweifel gezogen und zu Symptomen einer kulturellen Sinnkrise wurden, die nach Neuorientierung auf allen Gebieten suchte.43 Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden beispielsweise durch Freud, Nietzsche und Mach Werte und Überzeugungen, die im 19. Jahrhundert bereits brüchig geworden waren, radikal in Frage gestellt. Für den amerikanischen Schriftsteller Henry Adams wurden auf der Weltausstellung von 1900 Dynamos zur Offenbarung. Er sah in ihnen „ein Symbol für den fundamentalen Umbruch in der Gesellschaft und für die neue Zeit“ .44Bis ins alltägliche Leben und in die Ängste der Menschen hinein änderte sich alles. Diese Ängste als Kehrseite des hohen Tempos bestanden aus „(…) Angst vor der Degenerierung, Angst vor dem Niedergang, Angst, vom allgemeinen Fortschritt abgehängt zu werden, und Angst davor, was dieser Fortschritt bringen würde.“45 Das Janusgesicht der Moderne, das gleichzeitig in die Vergangenheit und Zukunft blickt, wurde vor dem Ersten Weltkrieg in Großbritannien durch soziale und nationale Unruhen erfahrbar. Das Jahrhundert begann für Großbritannien mit dem Burenkrieg und dem Tod der Königin Victoria. Beide Ereignisse erschütterten das Empire. Dem Bürgertum „als neue(r) Herrscherklasse“46 fehlten Stabilität und Selbstbewusstsein einer langen Adelstradition. Die technische Beschleunigung vermittelte den Eindruck der Unkontrollierbarkeit; die Manufaktur wurde durch industrielle Produktion abgelöst. Es kam zu wachsenden Spannungen zwischen Arbeit und Kapital. Die irische Frage drohte sich zu einer irischen Revolte auszuwachsen. Die seit 1905 bestehende Frauenbewegung sagte den patriarchalen Strukturen den Kampf an; künstlerische Avantgarden in Europa – besonders auf dem Kontinent – gaben der Anonymität der Metropolen, der Diskrepanz und Grausamkeit des Kapitalismus und dem Bakrott kultureller Visionen neue ästhetische Gestalt.47 Der Erste Weltkrieg mit seinen katastrophalen Ereignissen und Folgen leitete ein bisher unvorstellbares Zerstörungswerk der modernen industriellen und finanziellen Welt und normativer Zusammenhänge ein. Dieser Great Warführte europaweit zu Folgen, die „die materiellen Lebensbedingungen, die sozialen und politischen Strukturen, die Wirtschaft und die Lebensformen etwa seit 1880 (…)“48 wandelten. In Großbritannien kam es zu einer kompletten Restrukturierung der Arbeitswelt. Mensch und Maschine gingen ein symmetrisches Bündnis ein, Europa verlor seine zentrale Stellung in der Politik; die menschliche Persönlichkeit, so Ernst Mach, wurde zur Fiktion: Destruction, loss and sorrow seemed to enter the world on a scale unknown before, the war creating ‚horrors that make the old tragedies seem no more than nursurey shows‘ as Rebecca West puts it in the Return of the Soldier(p. 63). Sigmund Freud worked out his principle of thanatos, the death wish, during the war and believed that his contemporaries might never see a joyous world.49 Stevensons Anspielung auf Freuds Kulturpessimismus, den Freud u.a. in seiner Schrift Das Unbehagen in der Kultur(i. d. F. von 1930) zum Ausdruck brachte, wird von den Künstlern der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geteilt: Subjektzerfall, Sprachkritik, Normen- und Wertezersetzung, Orientierungsverlust, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, Nostalgieskeptizismus, werden in eine narrative Ästhetik des Bruchs transformiert.50 Nostalgie wird narrativ eingesetzt, um im Rückblick „to recover in fiction what had vanished in fact.“51 Musiker komponieren gegen die Tonalität. Die Zersplitterung der Welt wird in der bildenden Kunst ebenso deutlich, wie die Auflösung des Ichs als Element der allgemeinen Denkstrukturen der Epoche nach dem Ersten Weltkrieg.52 Während Romane der Viktorianischen Ära ihre Geschichten zu einem oft positiven Ende bringen – sie enden in Heiraten, individuellem Glück oder in einem tragischen Tod –, enden Romane der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in einer ungewissen Offenheit, die, angesichts unlösbarer sozialer und historischer Turbulenzen, Romanfinale gestalten, „(which) are often forced to move altogether beyond it in one way or another towards vision rather than reality.“53 Instabile Erzählwelten als Deutungsangebote für Rezipient/innen des dritten Lebensalters Erfahrungen transitorischer Identität lassen sich auf konkrete historische Entwicklungen beziehen, weil Identitätserfahrungen als „historische Situierung“ in der Moderne sich im und am Subjekt abspielt, so dass „es historisch von einer Form von Identitätsbildung zu einer anderen kommt.“54 Transitorische Identität als Selbstgefühl widersprüchlicher Aspirationserfahrung wird in der gegenwärtigen Sozialpsychologie als offener Prozess gedacht, der im Gegensatz zu stabilen und fixierten Identitätszuschreibungen traditionaler Gesellschaften unabschließbar ist. Die Formen der Romane von Dickens und die der Brontës nimmt das transitorische Identitätsphänomen als Problem der Ambivalenz von „Kontinuität und Kohärenz gegen Wandel und Flexibilisierung“55 in der Paradoxie des poetischen Realismus erzählerisch auf. Dickens‘ Roman Oliver Twist„(…) is the first novel in the language with its true centre of focus on a child. Although it came after Sketches by Boz and Pickwick, in a sense it was Dickens’s first novel.”56 Charlotte Brontës Protagonistin „(…) Jane Eyre is perhaps the first heroine in English fiction to be given, chronologically at least, as a psychic whole. Nothing, in fact, quite like Jane Eyre had ever been attempted before.”57 Beide Romane plausibilisieren transgressives Erzählen als Entzug der Identitätsbildungsmöglichkeiten ihrer Protagonisten, als Legitimationsverlust ihrer Erzähler und als unmögliche Möglichkeit einen Roman zu Beginn und in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien plausiblen Lösungen zuzuführen. Beide Romane sind in ihrer jeweiligen Ausdrucksgestalt fragmentierte Universen, ästhetische Krisenphänomene des bürgerlichen Mittelstandes: The Victorian middle class never attained a period of stability equal to that in which, following the restauration, the aristocracy achieved the order of the eighteenth century. The problem of cultural transmission was bedeviled by sheer rate of social change. To take up a position at all was to pitch camp on a cultural landslide.58 Die von Peter Coveney gewählte Metapher eines aufgeschlagenen Lagers auf abstürzendem Abhang, die politische Positionen für den bürgerlichen Mittelstand impliziert, trifft die kulturelle und existenzielle Identitätsfrage des bürgerlichen Mittelstandes dieser Zeit. Zu einer vergleichbaren Diagnose des Sinn- und Orientierungsverlusts des bürgerlichen Mittelstandes kommt Franco Moretti in seiner Publikation Der Bourgeois.59 Ambivalenz prägt die Struktur der Werke Dickens‘, der Werke der Brontës und die der Werke Virginia Woolfs, deren Ausdrucksgestalten zwischen Dauer und Wandel, Stabilität und Instabilität erzählerisch zu vermitteln suchen, ästhetisch die Zirkularität des in den bürgerlichen Selbsttheorien reflektierten Selbstgefühls60 in Begrifflosigkeit fragmentarisch auflösen und ästhetisch transzendieren. Die Erzählwelten um die es im Folgenden geht sind instabil. Sie stellen sich den gesellschaftlichen und kulturellen Widersprüchen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und den damit in die Moderne weisenden Transformationsprozessen, die die „rasante(n) Veränderungen der Erfahrung von Raum und Zeit“ und die Folge in sich aufnehmen, dass sich das Wirklichkeitsverhältnis zeitlich transformiert, „die Zukunft den Charakter eines offenen Möglichkeitsraumes“61 erhält und das freie Spiel der Kräfte des Liberalismus im erzählerisch geformten Ausdruck, in der polyvalent-offenen Struktur, zum Ausdruck kommt. Die ökonomischen, politischen und ästhetischen Wirklichkeitssegmente der ersten Modernisierungsphase der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich die einer „Umstellung der Gesellschaft auf eine kapitalistische Produktionsweise“, das „Reflexivwerden des säkularisierten Selbstbewusstseins“, die „Befreiung der Künste aus religiösen und politischen Heteronomien“, die die „Konstitutionsbedingungen des modernen Subjekts und seiner Lebenswelten“ ins Leben rufen,62 werden von den Romanen des Viktorianischen Zeitalters narrativ transformiert und zum Erkenntnispotenzial ihrer neuen Wirklichkeitssicht zusammengezogen. Wie im Zuge der zweiten Modernisierungsphase bei Virginia Woolf, geht es Ihnen nicht um eine nachahmende Reproduktion kultureller Zusammenhänge, sondern um die erzählerisch experimentelle Aufdeckung von Fragen nach den Konstitutionsbedingungen des modernen Subjekts. Diese Aufdeckung macht literarische Verfahren erforderlich, die Lösungsansätze für die Diskrepanzen des Zeitalters anbieten. Die Suche nach Lösungsansätzen kollidiert in den Werken des Viktorianischen Zeitalters mit ihren affirmativen Ansprüchen, den Erwartungen ihrer Leser/innen entgegen zu kommen. In Werken der zweiten Moderne wird ein Entgegenkommen den Leser/innen gegenüber durch eine Ästhetik narrativer Brüche verweigert. Es geht im Rezeptionsprozess also nicht um die Aufdeckung einer geheimen Wahrheit hinter den Erzählwelten, es geht nicht um eine Erschließung einer ihr eingelagerten bewussten Intention. Es geht darum, das dynamische Kräftefeld zwischen Inhalts- und Ausdrucksebene, Inhalt und Form, als dynamische Spannung gegensätzlicher Kräfte zwischen episodischer Kohärenz auf der Inhaltsebene und fragmentarischer Kontingenz auf der Ausdrucksebene in Gestalt narrativer Ambivalenzen zu erschließen. Dieses Kräftefeld relationiert normative Dimensionen der Erzählwelt, lässt sie im Prozess des Erschließens der erzählten Welt fragwürdig und zum Diskursangebot werden. Daraus resultieren Einsichten der Rezipient/innen in die autoreferenzielle Reflexion der erzählten Welt, die „Fragen nach den spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten der Fiktion“63 zulässt, ferner: Einsichten in ihre „Dialogizität“, die narrative „konträre Auffassungen und Positionen unablässig aufeinander projiziert und in diesem Prozeß füreinander durchlässig werden“ lässt64 und Einsichten in die Fragmentierung ihrer Form. Dieses besondere „Form- und Sinnbildungsmuster“65 des bürgerlichen Romans in Großbritannien, das als Signatur des Sinnverfalls und der Kohärenzauflösung der Identitätsmöglichkeiten des Subjekts in der Moderne gelesen werden kann, wird zum Angebot für heutige Leser/innen des dritten Lebensalters, ihr oben umrissenes kulturelles und biografisches Vorverstehen im Lektüreprozess durch eine produktive Zusammenführung der narrativ unverbundenen Zusammenhänge zu problematisieren. Im Erschließungs- und Reflexionsprozess erhält die hermeneutische Progressionsmethode ihre dialogische Dynamik aus den Erwartungs- und Reflexionshaltungen ihrer Leser/innen. Die erzählerische Form als dialektisches Kräftefeld zwischen Inhalts- und Ausdrucksebene ist eine hermeneutische Formbestimmung, die die erzählerische Form nicht formalistisch als „Befreiung vom Inhalt“, sondern in ihrer Dialektik zur „unerlässlich(en)“66, dialogermöglichenden Bedingung der Erschließung der ästhetischen Differenz und damit des Verstehensprozesses werden lässt. Indem diese Romane in ihren narratologisch differenten Ausdrucksgestalten den Sinn- und Orientierungsentzug der reflexiven Moderne anschaulich werden lassen, bieten sie ihren Leser/innen Entfremdungs- und Unheilerfahrungen der modernen Welt und die mit ihr einhergehende Identitätsfrage als erzählerische Problemdiagnose und als Sinnangebot an: Autonomieansprüche der Protagonisten werden perspektivisch gegen patriarchale Hegemonialansprüche in Stellung gebracht und laufen narrativ auf eine tödliche Gefährdung ihrer Identitätsmöglichkeiten hinaus. Es entstehen narrative Strukturen einer reflektierten Vergeblichkeit, die die Sehnsucht nach erfüllter Ganzheit bzw. den Schrecken vor ihrer Nicht-Erfüllbarkeit erzählerisch zum Vorschein bringen. Die Rolle der Literatur in der Moderne wird vor dem Hintergrund der Beschleunigung, einer rasanten Veränderung von Zeit und Raum, der offenen und fortschrittsbezogenen Zukunftsorientierung, sozialer Verwerfungen, des Werteverfalls und Sinnvakuums, die der Modernisierungsprozess seit dem 18. Jahrhundert mit sich brachte, problematisch. Sie übernimmt die Rolle einer Konfrontation und Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen dieses ungeheuren Transformationsprozesses, indem sie ihn erforscht, in Bilder einer wiederverzauberten Welt zu kleiden sucht67 und narrativ kritisiert. Heute evozieren Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne Leselust, Neugier auf Handlungsentscheidungen und -verwicklungen in den Plots und kritisches Interesse an den kulturdiagnostischen Lösungen, die die Romane vorschlagen. Indem die reflektierende Urteilskraft der Rezipient/innen angeregt wird, kommen kathartische Moment ins Spiel, die verletzende Erinnerungen affizieren.68 1.5 Rezipient/innen des dritten Lebensalters – Die zweite Generation nach dem Zweiten Weltkrieg Im Rahmen von gelenkten Seminargesprächen, die durch eine Drei-Phasen-Methode strukturiert sind – wir gehen weiter unten darauf ein – kommen wissbegierige, neugierige und sprachsensible Teilnehmer/innen des dritten Lebensalters freiwillig und mit Interesse an Romanlektüren zusammen. Die Lebendigkeit der Interaktion zwischen den Rezipient/innen und den literarischen Texten, ihr Erschließen, Durchdenken und der kritische Diskurs, kommen durch Potenziale zustande, die in der Gerontologie unter dem Begriff der Alterskreativität zusammengefasst werden. Deren charakteristische Merkmale sind Offenheit und imaginative Möglichkeiten. Dazu gehört auch die Fähigkeit zur Gerotranszendenz, deren Schlüsselkompetenzen Weltinteresse und Spiritualität sind. In der Interaktion zwischen den literarischen Texten und den Rezipient/innen werden diese Fähigkeiten aktiviert und die heilende Kraft der Phantasie der Rezipient/innen wird kathartisch wirksam. Die kreativ heilende und politisch wirkende Kraft der Phantasie wird von dem Gerontologen Andreas Kruse in Bezug auf Johann Sebastian Bach,1 von dem Sozialphilosophen Axel Honneth in Bezug auf Bob Dylan,2 von dem Filmtheoretiker Burkhardt Lindner in Bezug auf Charlie Chaplin,3 von der Psychoanalytikerin Luise Reddemann4 und von Musikern, Kabarettisten und Lyrikern der Nachkriegszeit5 in Bezug auf kreative und produktive Potenziale und ihre kathartischen Wirkungen für die Nachkriegsgeneration, von Soziologen aus Experteninterviews mit Gerontologen und Medizinern,6 von den Philosophen Walter Benjamin7 und Christoph Menke8 in Bezug auf die politische Wirksamkeit der ästhetischen Urteilskraft herausgearbeitet. Am Beispiel der Erzählwelten von Charles Dickens, der Brontës und Virginia Woolfs kann deutlich werden, dass Literatur Imaginationsräume entstehen lässt, die die Kreativität im Alter anspricht und neue Freiräume mit einer Sensibilität für Fiktionalisierungen öffnet.9 Der Romantheoretiker und Anglist F.K. Stanzel spricht in Bezug auf das Erschließen und Verstehen von Romanen und damit auch in Bezug auf Potenziale narrativer Identität Alternder von „Affinitäten, Analogien und Ähnlichkeiten" mit Innovationen der modernen Poetik, die mit den Mitteln der erlebten Rede, des inneren Monologs und des Bewusstseinsstroms den veränderten Sichtweisen des Alters ideal entspreche.10 Auch Schriftsteller wie beispielsweise Charles Dickens, Elizabeth Gaskell und die Brontës trugen mit ihren herausfordernden gegenbildlichen Erzählwelten nicht nur zu Sozialreformen, sondern auch zur bis heute wirksamen Aktualität der Frauenfrage und zu Fragen nach der Bedeutsamkeit persönlicher Autonomie in der reflexiven Moderne bei. Altern als Werden zu sich selbst, so Thomas Rentsch, ist durch die Unwiederbringlichkeit des menschlichen Lebens, die Unvordenklichkeit seiner Anfänge, die Unvorhersehbarkeit seines Endes bestimmt, wobei diese Negativitätserfahrung der Begrenztheit keine abwertende Bedeutung impliziert. Sie ist in der Konzeption transitorischer Identität verankert: „Die Vorsilbe ‚Un-“, so Rentsch, „indiziert jeweils pragmatische Handlungsunmöglichkeiten, etwas, das wir aufgrund der Konstitution unseres endlichen Lebens nicht können.“11 Dieses Nicht-Können zeigt sich in den Grundzügen unseres Selbstverhältnisses: in der „ Verdecktheitder eigenen Vergangenheit“, in der „ständig mögliche(n) Selbstverfehlung“, schließlich in der Fragilität und Endlichkeit des menschlichen Lebens,12 Grundzüge, die Jürgen Straub als Momente der Selbstentzogenheit transitorischer Identität reflektiert. Im Alternsprozess tritt durch die kürzer werdende Lebenszeit die Erfahrung transitorischer Identität als Selbstentzug deutlicher als in jüngeren Jahren hervor. Der Alternsprozess in der Moderne ist, in der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, durch sein Gefährdungsbewusstsein und durch die Möglichkeit zur kreativen Gestaltung des eigenen Lebens geprägt. Angesichts der menschlichen Grundsituation eines Werdens zu sich selbst, spitzt sich die Paradoxie des Alternsprozesses auf die Erkenntnis zu, dass das Alter als „ein konstitutiv riskantes, gefährdetes und gebrochenes Werden zu sich selbst“ erfahren wird.13 Gerade Musik spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die Gerontologen Andreas Kruse und Hans-Werner Wahl führen dazu aus: Die Musik gibt uns zunächst die Möglichkeit, seelische und geistige Prozesse auszudrücken und auf dem Weg dieses Ausdrucks zu reflektieren. Durch die Reflexion werden erst Erlebnisse in Erfahrungenund Erkenntnissetransformiert. Sie bildet weiterhin eine bedeutende Grundlage für das Werden zu sich selbst – eine Entwicklungsaufgabe, die angesichts der Veränderungen, mit denen sich ältere Menschen in ihrer Lebens Situation konfrontiert sehen (…), von hervorgehobener Bedeutung ist.14 Das Werden zu sich selbst ist ein seelischer und körperlicher Entwicklungsprozess, der im Alter zu einer Durchlässigkeit für neue Erfahrungen, einem Persönlichkeitswachstum, einer psychischen Widerstandsfähigkeit, einer Flexibilität in Bezug auf positive soziale Beziehungen führt, die der oder dem Alternden ermöglicht, „im Einklang mit sich selbst zu stehen“.15 Musik, Kunst und Literatur lassen Altern zur Erfahrung eines „höchst dynamischen Prozess(es)“ werden.16 Vor diesem anthropologischen Hintergrund einer philosophischen Ethik der späten Lebenszeit lässt sich verstehen, dass flexible Autonomie bzw. integrierte Persönlichkeit im Alter „Plastizität (…) im gesellschaftlich-kulturellen Kontext“17 der Moderne mit ihren Umbruchzeiten bedeutet. Entgegen gesellschaftlicher Defizitdiskurse über das Alter entstehen im dritten Lebensalter Kreativitätspotenziale, die in Bezug auf die Ganzheit eines individuellen Lebens sowie auf die Generationenfolge und die Erhaltung der Natur, das eigene Leben in eine umfassende Ordnung stellen kann. Sieht man mit dem Philosophen Otfried Höffe, dass das reduktionistische Menschenbild, das westliche Gesellschaften von Alternden entwerfen, aus vier Problemfeldern besteht: „(1) Einschränkung des Handlungsspielraums; (2) Entmündigung im Alter; (3) Vernachlässigung; (4) Gewalt gegen die Älteren (…)“18, und setzt man das ganzheitliche Persönlichkeitsmodell des Gerontologen Andreas Kruse dagegen – dieser entwirft 5 Kategorien gelingenden Lebens: „1. Selbständigkeit, 2. Selbstverantwortung, 3. Bewusst angenommene Abhängigkeit, 4. Mitverantwortung (…). 5. Selbstaktualisierung“19, dann wird die Fähigkeit Alternder zur „Gerotranszendenz“20 einsichtig. Diese Fähigkeit ermöglicht einen Alternslernprozess auf den näher kommenden Abschied von einem langen Leben hin, der Lebenserfahrungen eines selbstbestimmten Lebens verbindet mit Potenzialen, die Resilienz und Resistenz im Gefühl einer „irreduziblen Würde“21 mit einander verbinden. Resilienz bezieht sich auf individuelle, Resistenz auf gesellschaftsbezogene Potenziale einer flexiblen Lebensgestaltung des Alterns in der reflexiven Moderne. Da im Alter, sei es aus gesundheitlichen, sozialen oder kulturellen Gründen, immer individuelle Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Selbständigkeit auf dem Spiel stehen, können Selbst- und Fremdbestimmung von außen und/oder von innen in ein prekäres Ungleichgewicht geraten. Es geht daher im Alternsprozess darum, „dem eigenen Leben (…) Form und Gestalt zu geben“.22 Im Rahmen neuer Forschungen zu Bedingungen eines guten Lebens im Alter beschreibt Harm-Peer Zimmermann wie es alternden Menschen gelingen kann ein zufriedenstellendes Leben angesichts von Einschränkungen und Belastungen zu führen. Zimmermann schlägt den Begriff einer Alters-Flexibilität vor, der sich nicht nach zentralen Verhaltensanforderungen in Gesellschaft und Medien richtet – diese Anpassung zöge eine marktorientierte, außengeleitete Lebensführung und Konformismus nach sich.23 Vielmehr führten von innen heraus gestaltete eigene Wege zu einer inneren Selbstfindung, die Alters-Flexibilität als Lebenshaltung und Halt im Leben der Älteren verspreche. Zu den Lebensinhalten käme die Lebensform als eine „Gefasstheit“ zum Zuge, die sich angesichts der „Miseren des Alters und (…) überhitzte(r) Leitartikel und Debattenreden“24, nicht irremachen lässt. Es geht bei dieser Haltung darum nach innen und nach außen Distanz durch eine Haltung kritischer Flexibilität zu bewahren.25 Diese Haltung nennt Zimmermann Alters-Coolness. Das kritische Potenzial dieser Coolness sieht Zimmermann darin, dass es mit gesellschaftlichen Flexibilitätsanforderungen auf gleicher Augenhöhe umgeht. Das bedeutet, dass Alters-Coolness nicht unter das Niveau von gesellschaftlichen Flexibilitätsanforderungen fällt: Ihre kritische Virulenz besteht gerade darin, dass sie den Flexibilitätsstandard des modernen Lebens nicht unterläuft, sondern ihn sogar überbietet. Coolness steigert die Flexibilitätsanforderungen noch. Aber gerade durch diese Steigerung lässt sie die Flexibilitätsforderung hinter sich beziehungsweise überführt sie in eine andere Form.26 Diese andere Form besteht darin, dass sie sich der Norm der Flexibilität bedient, um gesellschaftliche Flexibilitätsforderungen an ihren eigenen Standards zu messen. Alters-Flexibilität kann in Resistenz und Kritik umschlagen, sobald sie mit gesellschaftlichen Altersbildern und Altersrollen konfrontiert wird. Zimmermann folgert: „Coolness bestätigt und bekräftigt den Abstand von verbindlichen Altersbildern, aber sie hält ebenso Abstand von der Unverbindlichkeit des Flexibilitätsregimes selbst.“27 Diese reflektierte Distanz, die vergleichbar ist mit der von Kant analysierten persönlichen Autonomie als Selbstgesetzgebung der Vernunft, verleiht Alternden, so Zimmermann, „(…) die Konstitution der Gefasstheit und Fähigkeit zur Distanzierung, nämlich die Souveränität, auf Verhaltensanforderungen der Flexibilität flexibel zu reagieren.“28 Diese Souveränität bezieht sich selbstreflexiv auf die Alternden, soziale Kontexte, zukünftige Generationen und auf den Erhalt der Natur. Sie entspricht in ihrer Plastizität der von Axel Honneth entworfenen Theorie dezentrierter Autonomie, die „Dimensionen des individuellen Verhältnisses zur inneren Natur, zum eigenen Leben im Ganzen und (…) zur sozialen Welt umfasst.“29 Der Begriff der persönlichen Autonomie, so Honneth, lässt sich als eine „zwanglose und freie Selbstbestimmung denken“, die besondere Fähigkeiten „(…) im Umgang mit der Triebnatur, mit der Organisation des eigenen Lebens und den moralischen Ansprüchen der Umwelt“30 verlangt. Sie verbindet in der Haltung der individuell organisierten Flexibilität Lebenserfahrungen des bisherigen gesamten Lebenslaufs in der reflexiven Moderne mit einem intuitiven, verborgenen Wissen,31 das der Haltung der Alters-Flexibilität eine kontextsensible Richtung weist. Elemente dieses intuitiven Wissens ergeben sich aus Experteninterviews mit Medizinern, Pflegepersonal und Gerontologen zu Bedingungen eines guten Lebens im Alter und hohem Alter angesichts der Verletzlichkeit und Endlichkeit des Menschen.32 Zu den Elementen intuitiven Wissens gehören die Sensibilität für eigenes Leid und das Leid anderer, Selbstverantwortung und Bedürfnisorientierung, ein Gefühl und Verständnis für Grenzsituationen, denen „etwas Plötzliches, Propulsives oder Höheres“ anhaften kann,33 Erfahrungen mit Erlebnissen existenzieller Krisen und Einsamkeit, Erfahrungen von gemeinsamer oder individueller Trauer, Antizipation von Sterben und Transzendenz. In der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit spielen im Alter Phantasien und Tagträume, Daseinsthemen, wie sie in Literatur, Filmen und Kunst, in Theologie und Philosophie verhandelt werden, eine wesentliche Rolle.34 Dabei werden Resilienz und Anpassungsfähigkeit im Alter als wichtige Ressourcen anerkannt: Da sei eine Großräumigkeit im alten Menschen, das Alter wird verbunden mit dem Hervorbringen von Wunderbarem und der Fähigkeit, seine Lebensgeister wieder erwecken zu können. Dies führt (…) zum Transzendentalen und dem Überschreiten von Grenzen und Grenzsituationen. Spiritualität wird genannt und der Humor, die Fähigkeiten zu kleinen Dummheiten und Narreteien des Alters.35 Aus den Elementen des intuitiven Wissens im Alter resultieren sensible und flexible Verhaltensweisen alter Menschen in Alltag und Kultur. Diese Fähigkeit besitzen auch die zwischen 1940 und 1950 geborenen Rezipient/innen des dritten Lebensalters, die als zweite, als Nachkriegsgeneration, zwischen der ersten, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen und unter den Verbrechen der Nationalsozialisten gelitten hat und der dritten Generation, der im Frieden aufgewachsenen zwischen 1960 und 1985 geborenen Jahrgänge, zu situieren ist. Dokumentationen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland lesen sich wie Skripte antiker Tragödien, deren Zentren unauflösbare Dilemmata, Vertrauens- und Sinnverlust und die Fragwürdigkeit menschlicher Werte bilden. Die strukturellen Erfahrungen der Nachkriegszeit in Deutschland, die Familien auseinandergerissen, individuelle Biografien zerstört und traumatisierend bis in die dritte Generation der heutigen 30–40jährigen hinein wirken, haben eine eigene historische Struktur und eine je individuelle Gültigkeit, in der sich Resignation und Kreativität miteinander verbinden. „Jede seelische Realität“, so der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer 2014 im Zusammenhang mit Nachkriegserfahrungen von drei Generationen in Deutschland, „hat ihre eigene Struktur und Gültigkeit. Voreilige Wertungen lassen sich relativieren, zerrissene Beziehungsfäden neu knüpfen, wenn sich die Generationen mehr füreinander interessieren und weniger überzeugt sind, dass ihre typische Wahrheit auch für die ältere oder die jüngere Generation gilt.“36 In der Erfahrung der Altersgelassenheit werden für die Nachkriegsgeneration psychologische Haltungen wirksam, die sich zwar aus der transgenerationellen Erfahrung einer traumatisierten Kriegsgeneration entwickeln, im Alter jedoch selbstreflexiv bearbeitet, bewältigt oder aufgelöst werden können. Wolfgang Schmidbauer bezeichnet einen dieser Mechanismen, der die Generationenfolge von einer ersten, „verletzten“, über eine zweite, „überschätzten“ zur dritten, einer „entwerteten Generation“ strukturell vermittelt,37 in Bezug auf die überschätzte Generation, also in Bezug auf heutige Menschen des dritten Lebensalters, als „Protestidentifikation“.38 Nach Schmidbauer entsteht dieser psychische Mechanismus zwischen Eltern der Kriegszeit und ihren Kindern, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind (den heute 65- bis etwa 80jährigen) aus einer Gemengelage, die symbiotische Wünsche der Eltern mit Enttäuschungen der Kinder vermischt. In der Sozialisationstheorie spricht man von einem in den 1960er bis 1970er Jahren umstrittenen permissiven Erziehungsstil, dessen Anhänger vor dem Hintergrund der Frage nach der Angemessenheit der Ausübung von Autorität dafür plädierten, elterliche Eingriffe in die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu unterlassen.39 Daraus entwickelte sich familiär ein „symbiotisches Klima und dessen Abwehr“, das „kindlichen Aggressionsäußerungen wenig Raum“ gab, weil die Eltern auf die Kinder verwundbar und abhängig wirkten und die Kinder dazu neigten, den Eltern die Unselbständigkeit anzukreiden.40 Der Effekt in diesen Familien war, dass das Zusammenleben ohne Normsetzungen „zu Irritationen und Verwirrungen der Kinder“ führte und die Entwicklung der Selbstständigkeit der Kinder nicht gesichert war.41 Die „Doppelgesichtigkeit“ der Protestidentifikation, so Schmidbauer, in der ein heranwachsendes Kind sich „gleichzeitig mit den Werten der Eltern identifizierenund diese bekämpfen“ lässt,42 wird erst im Ablösungsprozess von den heranwachsenden Kindern bemerkt und kann sich zwischen den Generationen in Gestalt einer tiefsitzenden Leidabwehr festigen. Durch die „Pendelbewegung“ der paradoxen Autonomie, die die drei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Dialektik der adoleszenten Ablösung und der Geschwisteropposition strukturvermittelnd bis heute miteinander verknüpft,43 entsteht ein Beziehungsmuster „generationenübergreifender Übertragungen oder Antithesen“, die nicht nur Ängste aufgrund der modernen und zwischenzeitlich globalisierten Unübersichtlichkeit schürt, sondern zugleich ein brüchigen Selbstbewusstseins hervorbringt,44 dessen „Doppelgesichtigkeit der unbewussten Strukturfindung“ Nähe fordert und abwehrt45 und unter dem Mangel an Vorbildern, dem Mangel an äußeren wie inneren Wertstrukturen, an Sinndefizit, geschwächter Konfliktregulierung, ängstlicher Anpassung und innerer Leere leidet.46 Die Identifikation mit dem Aggressor hingegen, dies ist die andere psychosoziale Haltung der Nachkriegsgeneration, führt zu einer Selbstfremdheit, die bewirkt, dass die Betroffenen sich in inszeniertem Gehorsam dem Autoritätsdiktat anpassen, zu dessen Opfer werden, den verdrängten Schmerz der subjektiven Entwertung und Selbstentfremdung als Schwäche empfinden und die aufgestauten Aggressionen hasserfüllt und gewalttätig auf Fremde verschieben.47 Während die Identifikation mit dem Aggressor zu einem Verrat am Selbst, mit der politischen Konsequenz führt, kulturelle Gewaltverhältnisse zu stabilisieren, führt der psychische Mechanismus der Protestidentifikation in den 1960ger Jahren zu politischen Transformationsprozessen, in denen Persönlichkeitstypen, wie „ Künstler, Helfer, Aussteigerund Opfer“48 gesellschaftliche Veränderungswünsche mit Sehnsüchten nach Stabilisierung im Modus einer paradoxen Autonomie verknüpften. Festigt sich dieser Mechanismus, dann kann es zu posttraumatischen Beziehungsstörungen und der mit ihnen einhergehenden Gefährdung der persönlichen Autonomie kommen. Diese beruht auf einer verstörten Orientierung an Konventionen, gegen die die Betroffenen einst rebellierten und bringt Erfahrungen einer „ paradoxe(n) Autonomie“hervor, die auf einer „Balance (von) Abhängigkeiten“ basiert.49 Die Bedürftigkeit nach äußerem Halt geht mit der Furcht vor diesem Halt einher. Es entsteht ein prekäres Gleichgewicht in der Persönlichkeitsstruktur, das, wenn es an die nächste Generation, die zwischen 1960 und 1985 Geborenen weiter gegeben wird, deren Autonomiemöglichkeiten gefährdet.50 Die Wurzel dieser Gefährdung liegt, so Schmidbauer, in Erfahrungen der Generation des Zweiten Weltkrieges, die ihre „inneren Verwüstungen“51 bis in die dritte, die Enkelgeneration, unbewusst weiter gibt, die dann unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden kann. Sie weisen auf frühkindliche Vertrauenskrisen zurück. Da nach Erikson Vertrauenserfahrungen von Kindheit an in allen späteren Lebensphasen und psychosozialen Krisen enthalten sind, sind die psychosozialen Haltungen der Protestidentifikation und der Identifikation mit dem Aggressor Symptome einer Vertrauenskrise, die in späteren Lebensphasen des erwachsenen und hohen Alters in die Persönlichkeit integriert werden können.52 Die Phänomene der Leidabwehr oder der Protestidentifikation können sich, so die Traumatherapeutin Luise Reddemann, durch mitfühlende Reflexion, Freundlichkeit und Empathie zwischen den Generationen und einem „aktiven Bezug zur Vergangenheit“ lockern oder sogar lösen.53 Bestätigt wird dieser Befund von Arno Gruen, der unter Berufung auf Erich Fromm und den brasilianischen Pädagogen Paulo Freire die Überwindungsmöglichkeit des rebellischen Abhängigkeitsmechanismus in der Chance der inneren Aufhebung sieht, andere aus Protest zu beherrschen.54 Für die heutige Generation des dritten Lebensalters werden konsequenterweise, trotz altersbedingter Einschränkungen, Erfahrungen der paradoxen Autonomie positiv als Freiheit zur Selbstbestimmung gesehen, die sich mit Altern, Hinfälligkeit, Abhängigkeit selbst- und mitverantwortlich gerotranzendent auseinandersetzt und sich der Furcht vor der Freiheit stellt.55 So haben persönliche Haltungen der Leidabwehr, der Identifikation mit dem Aggressor, der Protestidentifikation nicht unbedingt spätere seelische Krankheitshäufigkeiten zur Folge, sind aber als Erfahrungen anzusehen, die das Vorverständnis der Rezipient/innen strukturieren, mit denen sie die Romane Dickens‘, der Brontës und Virginia Woolfs erschließen. Im Alternsprozess der Nachkriegsgeneration können Ressourcen gewachsen sein, die eine durch Unsicherheit geprägte Identität in ihren positiven Aspekten dann stärken,56 wenn „Erinnerungen an Widerstand und Großherzigkeit“ gepflegt werden und an einer „Entidealisierung der Eltern“ gearbeitet wird.57 Das dritte Lebensalter – so die Gerontologen Andreas Kruse und Hans-Werner Wahl – besitzt (…) eine ganz eigene Charakteristik, die sich vor allem in einer Sichtweise des Lebensphasenkontextualismus ergibt. Menschen in dieser Lebensphase sind entlastet von den Anforderungen des Berufs und verfügen aufgrund ihrer weiterhin hohen Kompetenzen sehr aktiv über die Ressource Zeit. Gleichzeitig stehen gerade in dieser Lebensphase Anforderungen der Hochaltrigkeit (‚Viertes Alter‘) vor der Tür.58 Die soziokulturelle Realität in den dreißig Jahren zwischen 1945 und 1975, in der Menschen des heutigen dritten Lebensalters aufwuchsen, zeichnete sich durch eine gesamtgesellschaftliche Verunsicherung aus, die für eine vermutete Zunahme von psychischen Symptomen oder Erkrankungen verantwortlich gemacht werden könnte. Nach Martin Dornes führte dieses Klima jedoch „(…) nicht zu einer Erhöhung der kindlichen oder erwachsenen Krankheitshäufigkeitenim Bereich des Seelischen (…)“59, weil kollektive Gefühle zwar Stimmungen von Müdigkeit oder Ängstlichkeit erzeugten, nicht aber Angsterkrankungen.60 Dieser Zeitabschnitt und der ihm folgende in den 1980er bis 1990er Jahren stellte kompensatorische Möglichkeiten bereit, Krisen und Krisenerfahrungen „hinsichtlich ihrer symptomerzeugenden Kraft“61 zu mindern und zu bewältigen. Der Rückgang eindeutiger Orientierungen, die Lockerung von Traditionen, Entraditionalisierung mit wachsenden Freiheits- und Autonomiemöglichkeiten, führten zu erhöhter Flexibilität und schufen Grundlagen für „(…) Fähigkeiten wie Kreativität, Initiative, Ambivalenztoleranz und Komplexitätsbewältigung, die unerlässlich sind für die erfolgreiche Bewältigung des modernen Familien- und Arbeitslebens.“62 Der Zugewinn an persönlicher Autonomie, den Erich Fromm Freiheit vonnennt, ließ „ Verdrängungen reversibler und weniger endgültig“63 werden, wodurch Freiheitsgewinne und Möglichkeiten entstanden, Gesellschaft und Kultur humaner und demokratischer zu gestalten. Beiträge zu diesen Prozessen leisteten auch die öffentliche Debatte um die erste Version der Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung zu den Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und die Debatten um die Umgangsweisen der Schriftsteller Martin Walser und Günter Grass mit ihrer NS-Vergangenheit.64 Mit Erfahrungen einer gefährdeten Autonomie,65 der die aus der Nachkriegszeit stammende Elementarspannung von Angst und Sicherheitsbedürfnisdurch durch das Auseinanderbrechen gültiger Ordnungsstrukturen und dem damit einhergehenden Wirklichkeitsverlust zugrunde liegt,66 kann durch den zeitlichen Abstand des Alternsprozesses bewirkt, eine Gelassenheit reifen, deren Grundstimmungen zwar Angst und die Suche nach Sicherheit ist, die aber der gesellschaftlichen Herabsetzung der Alten durch die Enkelgeneration und der „Misstrauenskultur gegenüber Älteren“67, mit kritischer Distanz, Humor, aktiver Imagination und einem durch Älterwerden gereiften Urteilsvermögen begegnen kann.68 Durch diese Fähigkeiten öffnen sich Altersgelassenheit und Gerotranszendenz gegenüber Kunst, Musik und Literatur mit problemorientierten, Gefühle affizierenden Inhalten. Rezipient/innen des dritten Lebensalters können durch ihre Krisenkompetenz gegen das Schweigen ihrer Eltern69 offen sein und bereit, transgenerationale Dialoge zu führen, die der eigenen Stimme dieser Generation, wie auch den Zeitzeugen, „eine Gestalt zu verleihen“ vermögen.70 Da aufgrund der prinzipiellen Veränderungs- und Wandlungsfähigkeit des Menschen die Offenheit Alternder neue Entwicklungsmöglichkeiten in den Blick nehmen kann, können im dritten Lebensalter jugendliche Krisenerfahrungen der Protestidentifikation bzw. der Identifikation mit dem Aggressor in Generativität und Gerotranszendenz transformiert werden. Im „originelle(n) Gebrauch von Wissen und Strategien“, die zu „neuartigen Lösung(en) eines Problems“ führen, kommt eine „bejahende Einstellung zu Welt und Mensch, als ein grundlegendes Interesse an Menschen wie auch an Prozessen der Welt“ bei Alternden zur Geltung.71 Zu dieser bejahenden Welteinstellung gehören unter anderem Neugier, Experimentierfreude, Offenheit, der Mut zum Neubeginn, der kreative Umgang mit schwierigen Entscheidungssituationen, Generativität als „höhere() Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen“72 und der kreative und kritische Umgang mit Kunst, Musik und Literatur, durch die im Alter erhöhte „Sensibilität für emotionale Inhalte“.73 Kreativität im Alter „(…) betrifft die Kunst der eigenen Lebensführung und das Eintreten für unsere spezifische Existenzform, aber auch die erfinderische Antwortsuche auf Lebensfragen, die spezifisch menschlich sind.“74 Diese kreative Lebensbejahung ist in die drei Dimensionen der Gerotranszendenz, die das Selbst, die Welt und den Kosmos betreffen, eingebettet. In der Verbindung von Bewusstem und Unbewusstem, befähigt sie zu „kosmischen und transzendenzbezogenen Welt- und Lebensperspektive(n)“.75 Werke der Kunst, Musik und Literatur lösen Potenziale einer mitfühlenden Reflexion aus. Sie stellen nicht nur „kreative Lösungen der Weitergabe an die nächste Generation“ bereit,76 sondern sprechen in der ästhetischen Transformation menschlicher, weltlicher und kosmischer Beziehungen gerotranszendete Fähigkeiten Alternder emotional an. Sie evozieren Perspektiven auf tragfähige Lebenseinstellungen, die angesichts der Verletzlichkeit des eigenen Lebens, dieses als eine „im Werden begriffene() Totalität“77 zu verstehen und anhand der auf Ganzheit zielenden ästhetischen Gestaltungen zu reflektieren vermag. Gerotranszendenz ist ein Vermögen, das sich als „positiv besetzte Aufmerksamkeitsleistung“78 ästhetischen Erfahrungen öffnet. Deren wesentliches Charakteristikum besteht in dem Anspruch, Aufmerksamkeit aufgrund neuer Erfahrungen zu erregen. Wolfgang Welsch sieht die Wirkung ästhetischer Ausdrucksformen in „Blitz, Störung, Sprengung, Fremdheit“79, die im „spezifischen Vollzug“80 ästhetischer Wahrnehmung erfahren wird. Im Unterschied zur sinnlichen Wahrnehmung im allgemeinen, zeichnet sich nach Martin Seel, ästhetische Wahrnehmung dadurch aus, dass sie „aus einer Fixierung auf eine theoretische oder praktische Verfügung über ihre Objekte heraus(tritt)“. Ästhetische Wahrnehmung, so Seel weiter, „(…) nimmt ihre Objekte unabhängig von solchen Funktionalisierungen in ihrer phänomenalen Gegenwärtigkeit wahr. Sie ist hier und jetzt für das Spiel der ihr zugänglichen Erscheinungen offen.“81 Die durch Gerotranszendenz aktivierte ästhetische Wahrnehmungssensibilität der Rezipient/innen des dritten Lebensalters erschließt in Werken der Kunst, Musik und Literatur Ausdrucksformen einer ästhetisch präsenten und verdichteten Lebendigkeit,82 die zu eigenständigen Erkenntnisleistungen führt. Da diese emotional, kognitiv und evaluativ an „das spezifische Erscheinen der künstlerischen Objekte gebunden“ ist, wird sie nicht primär zur begrifflichen Erkenntnisleistung.83 Vielmehr evoziert ästhetische Erkenntnis das reflexive Selbst- und Weltverhältnis der Rezipient/innen.84 In kultursemiotischer Sicht sind sich Romane des Viktorianischen Zeitalters und Romane der klassischen Moderne darin ähnlich, dass sie die Erforschung moderner Subjektivität narrativ multiperspektivisch, mit unzuverlässigen Erzählern, gestalten: Romane des Viktorianischen Zeitalters in den narrativen Paradoxien von grotesker Vorenthaltung persönlicher Autonomie und märchenanalogen Chancen subjektiver Selbstverwirklichung; experimentelle Romane der klassischen Moderne in der Simultaneität ungleichzeitiger Ereignisse. Narrativ gestalten diese Romane die transzendentale Obdachlosigkeit des modernen Subjekts,85 die die Erzählkunst des frühen 18. bis zum 21. Jahrhundert wie ein großer Phrasierungsbogen überspannt und Vergangenheit zukunftsbezogen in ästhetischer Präsenz verdichtet. Die Romane werden, wie oben dargelegt, zu Gedächtnismedien der Moderne.86 Die erzählerischen Verfahren narrativer Gedächtnismedien lassen sich im kultursemiotischen Rahmen in die Nähe biografischer Erfahrungen von Rezipient/innen des dritten Lebensalters rücken. In ihrer Komplexität lassen sie sich als produktive Illusionen, die wir zum Leben brauchen, erschließen und als narrative sowie kulturelle Antwortmöglichkeiten auf menschliche Lebensfragen reflektieren. Ins ästhetische Imaginationsspiel wird die Fähigkeit der Rezipient/innen des dritten Lebensalters zur aktiven Imagination gezogen. Verena Kast definiert diese Fähigkeit damit, „(…) daß das Ich aktiv in die Imagination eintritt, daß es ‚kontrollierend‘ und verändernd-verwandelnd ins imaginative Geschehen eintreten kann. Dadurch wird das Unbewußte dem Bewußtsein verbunden“.87 Im Alternsprozess steigt die Sensibilität für emotionale Inhalte wodurch die aktive Imaginationder Rezipient/innen des dritten Lebensalters in ihrer altersgemäßen Differenzierungsfähigkeit von der Dramaturgie der Erzählwelten, ihren kontrastreichen emotionalen Inhalten und ihren offenen Formen angesprochen wird. Da die aktive ImaginationUnbewusstes mit Bewusstem verbindet, öffnet sie sich grotesken, märchenanalogen, multiperspektivischen Varianten der Darstellung der literarischen Angst, die, typisch für den Roman der Moderne seit Mitte des 18. Jahrhunderts, mit der zentralen Thematik der Selbstfindung des Ich, „Zonen des Vor- und Unbewußten“ im erzählten Bewusstsein der Protagonisten situiert.88 Bei der Erschließung der Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne reflektieren Rezipient/innen des dritten Lebensalters mitfühlend auf diese Erfahrungen. Zwar können sie Ereignisse ihrer biografischen Situation nicht ändern, wohl aber „die Bilder davon in (ihrem) Kopf (…).“89 Die epochale und ästhetische Distanz zwischen ihnen und den Romanen eröffnet ihnen vom sicheren Ort der Lektüre aus eine selbstreflexive Beobachterposition, die die Bösewichter, Dämonen und Schurken dieser Romane – als Gestalten der Angst und des Hasses, oder auch der Komik und Satire – zu Gegenbildern innerer Feinde werden lässt: In unseren Bildern ist immer auch unser momentanes Verständnis von uns selbst und der Welt, das Verständnis unserer gegenwärtigen Beziehungsmöglichkeiten abgebildet (…). Außerdem kann Abstand genommen werden von sehr negativen Vorstellungen von sich selbst, allenfalls können Sehnsuchtsbilder wesentliche Aspekte der Persönlichkeit freilegen, die bisher zu wenig ins alltägliche Leben integriert wurden. Das Selbstgefühl verändert sich (…).90 In einer späteren Publikation ergänzt Verena Kast diesen Gedanken am Beispiel einer empirischen Studie zur Imagination, die im Vergleich real rudernder und imaginiert rudernder Sportler zu dem Ergebnis kommt, dass bei Klienten imaginative Ressourcen aktiviert werden können, wenn kinästhetische Wahrnehmungen das Wohlbefinden fördern: „Imagination bewirkt also nicht nur emotionale Veränderungen, sondern auch körperliche“91, die sich, so Kast weiter, im Alter durch aufmerksames sinnliches Wahrnehmen der Welt und ihrer Natur steigern: „Durch die Intensivierung der sinnlichen Wahrnehmung wird die Vorstellungskraft immer wieder neu angeregt (…)“ – wobei die Einbeziehung „(…) eine(r) wissenden Kreativität(…)“92 die selbstreflexive Rezeption von Kunstwerken stärkt und steuert.93 Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne können eine Veränderung des Selbst- und Weltgefühls der Rezipient/innen des dritten Lebensalters in dem Sinne bewirken, dass das „Leben schöpferisch gestaltet werden kann, schöpferisch im Sinne der Persönlichkeitsänderung“.94 Wissende Kreativität und transitorische Identitätserfahrungen gehen ineinander über. Im Rezeptionsakt entstehenden kreative Formen der „Konfliktfähigkeit“95, die Erfahrungsmöglichkeiten einer Alters-Coolness als lebenskluge Gefasstheit hervorrufen. Diese Gefasstheit ist als Dialektik gelingenden Lebens im Alter zu verstehen. Jean Améry bezeichnet sie als Bejahung einer zum Scheitern verurteilten Revolte. Diese setzt der „Ver-nichtung“ der Alternden „durch die Gesellschaft“ eine flexible Haltung entgegen, die seitens der Alternden „die Ver-nichtung an(nimmt) (…)“.96 Die Alternden wissen, dass sie sich nur dann selbst bestimmen und bewahren können, wenn sie sich dieser Unausweichlichkeit stellen. Nach Améry ist der Alternde „in der Anerkenntnis des Nichts-Seins noch ein Etwas. Er macht die Negation durch den Blick der Anderen zu seiner Sache und erhebt sich gegen sie.“97 Reife im Alter bedeutet, unangepasste Lebenswege zu gehen, die das Gefühl stärken, ein eigenes Leben in der Gesellschaft der Mitmenschen führen zu können, eine Lebenshaltung, die auch der Generation der Rezipient/innen des dritten Lebensalters entspricht. Literarische Werke, Märchen, Mythen, antike Dramen, Musik, Philosophie, die Paradoxie des poetischen Realismus, die dem bürgerlichen Roman des 19. Jahrhunderts Gestalt verleiht und die modernistische Erzählweise der Romane nach dem Ersten Weltkrieg, stellen für diese Identitätsproblematik kreative Lösungen bereit. Als ästhetische Analogieerfahrungen zur Dialektik des Alterns und den spezifischen Erfahrungen der Nachkriegsgeneration, der von ihnen erfahrenen elementaren Spannung zwischen Angst und Sicherheitsbedürfnis, lösen sie Empathiepotenziale aus, die Resilienz und Anpassungsfähigkeit im Alter als wichtige Ressourcen einer kritischen Selbst- und Weltbegegnung freisetzen können. In der Auseinandersetzung mit Romanen, die in der ersten und zweiten Moderne entstanden, erschließen Rezipient/innen des dritten Lebensalters ästhetische Gegenwelten, die komplexen Gefühlswelten ein Gesicht, dem Grauen und dem Glück einen Namen geben, die Gegenbilder zu traumatischen Erfahrungen entstehen lassen, die zu einer Aktivierung einer inneren Bühne anregen, auf der Krisenerfahrungen „reinszenier(t)“98 werden können. Die narrativen Strukturen dieser Romane affizieren „(t)rauma-assoziierte Gefühle“, zu denen „Ohnmacht, Todesangst, Panik, Ekel und Scham“ gehören und die im Individuum auf Gefühle treffen, die „der Verarbeitung“ traumatischer Erfahrungen durch „Empörung, Wut und Trauer“ dienen.99 Gleichzeitig wird die Fähigkeit dieser Gruppe von Rezipient/innen zur Gerotranszendenz aktiviert, die ebenfalls in der Verbindung von Bewusstem und Unbewusstem zu „kosmischen und transzendenzbezogenen Welt- und Lebensperspektive(n)“ befähigt.100 Die in den Romanen zu entziffernde unauflösbare Diskrepanz des Kapitalismus zwischen Gleichheitsversprechen und ihrem empirischen Gegenpol der Vorenthaltung von Humanität durch Pauperisierung und Sinnentzug wird zum erzählerischen Diskursangebot. Die Rezipient/innen werden zu ästhetisch entfernter Nähe angeregt, noch unentdeckte Dimensionen ihrer Subjektivität in den narrativ verfremdeten Erzählwelten der Moderne auf den drei Ebenen der Gerotranszendenz 101 zu erkunden. Humor, Ironie und Selbstreflexion Rezipient/innen des dritten Lebensalters, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit biografischen Erfahrungen aufgewachsen sind, die sie in ihren menschlichen Grundbedürfnissen nach Orientierung und Kontrolle102 verunsicherten und die deshalb Angst und Hilflosigkeitserfahrungen mit Sicherheitsbedürfnissen103 verknüpften, haben im Prozess des Erwachsenwerdens unterschiedliche Möglichkeiten, Erfahrungen des Scheiterns durch herausfordernde bzw. explorativ gesuchte Phasen des Neubeginns in positive oder kreative Erfahrungen zu transformieren. Diese Transformationserfahrungen führen zu einer gereiften und flexiblen „Altersidentität“.104 Wesentliche Bestandtteile dieser Identität sind Offenheit, Neugier, Humor und Ironie, wobei Ironie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu einer Grundstimmung in Deutschland wurde. Humor und Ironie, denen die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung eigen ist, kommen aus dem intuitiven Alterswissen. Ironie, so Odo Marquard in Anschluss an Kierkegaard, wurde „nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu einer Grundstimmung“, weil Ironie Selbstschutz bedeutet. Der „Ironiker will nicht mit der Wirklichkeit behelligt werden“.105 In Abgrenzung zum Humor will „Ironie das Absolute“.106 Indem Ironie „(…) die ganze Wirklichkeit relativiert, unverbindlich und unernst macht, wird sie zum Schutz vor der Wirklichkeit: sie flüchtet sich, indem sie selbst das Absolute scheint (…).“107 Demgegenüber bekräftigt der Humor das Endliche. Seine Distanz entsteht „(…) nicht durch Aufschwung ins Höhere, durch Auflösung ins Absolute (oder) Erhabene (…), sondern indem bekräftigt wird, dass es ist, was es ist: nämlich das Nichtabsolute, das Nichthöhere, das Endliche inmitten von Endlichem.“108 Aus diesem Befund folgert Marquard, dass der Humor „(…) das Endliche, das er selber ist, mit viel anderem Endlichen in Verbindung bring(t).“109 Da das Endliche sich, nach Marquard, als Menschliches dadurch zeigt, dass es nicht aufhört Endliches zu sein, sondern als Endliches bekräftigt wird, wird es „(…) durch anderes Endliche distanziert, und zwar durch möglichst vieles (als) geteilte Endlichkeit (, die) lebbare Endlichkeit (ist).“110Dieser Antireduktionismus, der hauptsächlich Nichtabsolutes wahrnimmt enthält das Geheimnis des Humors, „(…) mehr als Endlichkeit zu wagen und zu realisieren, wie es ist: dass die Quintessenz über die Wirklichkeit ist, dass das Leben kurz ist und wir sterben müssen.“111 Aus Ressourcen wie Humor, Lebenserfahrung, Gesprächsbereitschaft mit Jüngeren, Neugier, Kreativität, die Fähigkeit eigene Ängste wahrzunehmen und mitteilenzu können, entsteht das Potenzial einer „Akzeptanz des Alterns“112, die, im Unterschied zu jugendlichen Alternsphasen, „Simultaneität positiver und negativer Emotionen“ in ihrer Koexistenz zur „wichtige(n) Form von Ganzheitserleben“ im Alter werden und Verdrängungen reversibel werden lassen. Dieses Ganzheitserleben wird zudem durch die Erinnerungsarbeit Alternder verstärkt, die in Situationen des Lebensrückblicks „eine Schau auf das ganze Leben ermöglichen“, in der verschiedene Lebenserfahrungen in der Erinnerung zur narrativen Identität integriert und bewertet werden.113 Diese das mittlere und höhere Alter stabilisierende Individuation ruft nicht nur Erinnerungen an Werke der Kunst, an Begegnungen mit Musik und Literatur hervor, sie aktiviert auch die Sensibilität für das Erschließen und Reflektieren anspruchsvoller Erzählwelten, in deren narrativer Ästhetik das Dunkle mit dem Hellen des Lebens, Angst mit Freude, das Groteske mit märchenhaft Erhabenem, Krisen und Abgründe mit kathartischen Lösungen verwoben sind. Die Werke bieten Gelegenheit, in individueller Lektüre und im Diskurs, sich in ästhetischer Verfremdung mit dem eigenen „Schatten (…), das heißt mit denjenigen Aspekten der eigenen Persönlichkeit, die wir ablehnen“ 114 auseinanderzusetzen. Humor spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Affiziert werden in diesem Verstehensprozess zugleich Fähigkeiten, die bei Rezipient/innen des dritten Lebensalters ein therapeutisch wirkendes, „mitfühlendes Verstehen (ihrer) selbst“115, die Fähigkeit, sich mittels ästhetischer Distanz selbst in Frage zu stellen116, eröffnen. Da das dritte Lebensalter eine Lebensphase ist, in der Menschen dieser Altersgruppe sich nach innen wenden, Ausgespartes ihres Lebens aufnehmen und dadurch den Prozess des Werdens zu sich selbst reflektieren, wird die Frage nach der Bedeutsamkeit der eigenen inneren Welt im Zusammenhang der biografischen Entwicklung immer wichtiger. Es entstehen neue Entfaltungsmöglichkeiten, die Fragen nach dem Sinn des Lebens auch in der Hinwendung zu Träumen, Imaginationen und Werken der Kunst zu beantworten suchen.117 In dieser Phase des Individuationsprozesses entstehen in Bezug auf Werke der Kunst, Musik und Literatur Plausibilitätsfragen, die Fragen der künstlerischen Gestaltungsprozesse betreffen – z.B. „wie hat der junge Dickens, wie haben die jungen Schwestern Brontë, wie Virginia Woolf solche komplexen Romane, die sich mit Verletzlichkeit, Vergänglichkeit und Tod beschäftigen, entwerfen und schreiben können – wie sind diese Erzähluniversen gemacht“? Diese Plausibilitätsfragen, die Wertvorstellungen und Lebenserfahrungen der Rezipient/innen des dritten Lebensalters mitreflektieren, die zudem in den Diskurs um die narrativen Welten eingebracht werden, lassen sich in einer unten dargelegten kultursemiotisch fundierten Drei-Phasen-Methode erarbeiten. In der kreativen Erschließung von Romanen des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne, die Lösungen für die Abgründe der modernen Seele erforschen und vorschlagen, können Rezipient/innen des dritten Lebensalters wichtige Schritte „zur psychischen Stabilisierung“118, über die kreative Aktivierung ihrer Empathiefähigkeiten, ihrer evaluativen und kritischen kognitiven Vermögen vollziehen.119 Zugleich erarbeiten sie kulturhistorische Einsichten in die Entstehungszeit der reflexiven Moderne, ihre Macht der Verdinglichung, Krisen und Entwicklungswege, die uns heute noch betreffen. In kultursemiotischer Perspektive gestalten Romane des Viktorianischen Zeitalters und der klassischen Moderne in der Simultaneität kontrastierender Emotionen120 transitorische Identitätserfahrungen, die in ihren Zwischenstufen als Varianten der Liebe, des Liebesverrats, der Verachtung und des Hasses in positiven und negativen Beziehungsmustern durchgespielt werden und zwischen Außen- und Innenwelt, Fremd- und Selbstbestimmung oszillieren. Unter der rezeptionsästhetischen Bedingung ästhetischer Distanz lassen sich diese Erzählwelten erschließen und kultursemiotisch reflektieren. Teil 2 Aspekte transitorischer Identität als narrative Deutungsmuster von Romanen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts „Wie hat der junge Dickens es bloß geschafft einen so existenziellen Roman zu schreiben, in dem Diebe und Bürger beinahe gleich sind?“ Frage eines Teilnehmers am Seminar zu Charles Dickens‘ Roman Oliver Twist. „Eine so intelligente und sensible junge Frau liebt einen defizitären Mann – das geht gar nicht!“ Kommentar einer Teilnehmerin am Seminar zu Charlotte Brontës Roman Jane Eyre. „Ich habe Emily Brontës Roman Wuthering Heightsvor vierzig Jahren gelesen und nicht verstanden. Jetzt finde ich ihn atemberaubend.“ Kommentar einer Teilnehmerin am Seminar zu Emily Brontës Roman Wuthering Heights. 2.1 Die narrative Paradoxie der Romane des Viktorianischen Zeitalters Romane des Viktorianischen Zeitalters sind Wegbereiter modernen Erzählens. Sie zeichnen sich durch eine große Formenvielfalt aus, die jede Kategorisierung dogmatisch erscheinen lässt. Um drei Vertreter/innen dieser Gruppe von Romanen, Charles Dickens, Charlotte und Emily Brontë, wird es im dritten Teil gehen. Romane der klassischen Moderne Großbritanniens lassen zwei Entwicklungslinien erkennen. Zum einen die Linie traditionellen Erzählens, die allerdings mit der Prosa des viktorianischen Romans durch thematische Erneuerungen nicht mehr zu vergleichen ist. Vertreter dieser Linie sind D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Christopher Isherwood. Zum anderen experimentelles Erzählen, das sich durch Multiperspektivität, Hybridität, Fragmentarisierung und die Gestaltung des stream of consciousnessauszeichnet. Vertreter dieser Linie sind Joseph Conrad, Virginia Woolf und James Joyce.1 Um eine der Vertreterinnen dieser experimentellen Linie, Virginia Woolf, wird es im drittenTeil, im Anschluss an die Vertreter des Romans des Viktorianischen Zeitalters, gehen. Sie entwirft eine alternative Erzählkunst zu der des 19. Jahrhunderts. Das Viktorianische Zeitalter ist eine gesellschafts- und kulturverändernde Umbruchszeit. Mit der Regierungszeit Königin Victorias erstreckt es sich von 1837 bis 1901. 1837 erscheint Charles Dickens‘ erster großer Roman Oliver Twistund 1901 Rudyard Kiplings Roman Kim. Diese Romane liegen chronologisch und topografisch zwar weit auseinander, haben jedoch, obgleich sie der ersten und der zweiten Modernisierungsphase zuzuordnen sind, frappante narrative Ähnlichkeiten: Zwei junge Protagonisten wandern orientierungslos und sinnsuchend in einer komplexen und unüberschaubaren Welt umher. Romane des Viktorianischen Zeitalters sind entgegen gängiger Vorurteile nicht altmodisch und kitschig. Vielmehr entwickeln sie komplexe erzählerische Energien, deren Intensität und Einzigartigkeit zugleich affirmativ und zeitkritisch sind, Leser/innen auch heute noch mit Orientierungsverlust und Wertezerfall konfrontieren und als Wegweiser modernen Erzählens erschlossen werden können. Ihre enzyklopädischen Horizonte, die durch multiple Plots entfaltet werden, setzen sich nicht nur mit dem status quosozialer und moralischer Konventionen ihrer Zeit auseinander und stützen mit diesem Programm die neu entstandene industrielle und kapitalorientierte Mittelklasse, sind also Erzählwelten ihrer Zeit, sondern spielen mit affirmativen Lebenshaltungen, drehen sie um, stellen sie in ihren Kehrseiten dar. Zugleich mit ihrer affirmativ erscheinenden Konstruktion sind sie gegen die Zeitströmungen der Kapitalakkumulation, des Nützlichkeitsdenkens, des linearen Fortschritts und Zerfalls der Humanität verfasst. Weder waren sie zu ihrer Zeit bequeme Ratgeber, noch können sie heute so verstanden werden. Sie sind, in der Formulierung George Levines: „(…) exploratory and inquisitive as well as didactic und moralistic.”2 Die hier vorgelegte Auswahl von bekannten Romanen des Viktorianischen Zeitalters wird mit ihrer narrativen Verfremdungstechnik begründet, an der sich exemplarisch zeigen lässt, wie diese Romane die viktorianische Welt entdecken, erforschen, kritisieren und erzählerisch innovativ entwerfen. Dabei rückt ein zentrales Charakteristikum der Romane des Viktorianischen Zeitalters ins Zentrum: Das Paradox des poetischen Realismus, das sich bei jedem der Romane unterschiedlich auswirkt, in Varianten europäische Romane des 19. Jahrhunderts strukturiert und diese als moderne Romane auszeichnet. Das Paradox besteht in der nicht auflösbaren Ambivalenz des erzählerischen Anspruchs auf realistische Detailgenauigkeit, die wegen ihrer Komplexität unerfüllbar bleibt und dem Anspruch der narrativen Bündelung der Details in Perspektiven, die die Unerfüllbarkeit des Anspruchs als erfüllbar, mithin plausibel erscheinen lassen. Dieses Paradox, das sich mit Zima als strukturelle Ambivalenz bezeichnen lässt – Ambivalenz, verstanden als Zusammenführung unvereinbarer Gegensätze oder Werte, ohne Synthese3 – enthält die epistemologische Frage, ob ideelle, imaginative Entwürfe mehr Realität enthalten als Empirie, und wie Ideen und Imagination von äußeren Umständen abhängig sind? Romane des Viktorianischen Zeitalters lösen dieses Problem nicht, sie stellen es narrativ dar, indem sie es in die Innenwelt ihres jeweiligen Erzählkosmos transformieren – „throwing the drama inside“4 – und damit zum Problem ihrer Form machen: Das Innenleben der Protagonisten gerät in multiplen, sich durchkreuzenden Handlungssträngen in Konflikte mit der Empirie einer zur Prosa gewordenen Welt, wobei die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf Totalität der Romane ideelle Lösungsmöglichkeiten anbietet. Diese Romane kommentieren geradezu postmodern im Erzählen des Erzählens diese Ambivalenz bzw. Paradoxie einer imaginierten Empirie als Spiel mit dem Schein. Die Autoren heben in ihren Vorworten immer wieder hervor, dass realistisches Erzählen, ihr als ob, sich von Dichtern der bürgerlichen Moderne, nämlich der englischen Romantik, herleitet, „(…) which made the ‚ordinary‘ into the romantic, and made the true epic not warriors’ adventures around the world, but the growth of the mind.“5 Realistisches Erzählen als durch und durch literarisches Erzählen ist die Entdeckung, Erforschung und der imaginative Neuentwurf des modernen Selbst in einer neu zu entdeckenden, komplexen und unüberschaubar gewordenen Welt mit dem Anspruch, Bekanntes und Unsichtbares sichtbar werden zu lassen. Nicht mehr fantastische Götter, Zauberer und Dämonen geben dem modernen Roman seine narrative Form, sondern die „(…) Desillusionierung der Welt, wie sie die Neuzeit und Aufklärung bewirkt haben.“6 Desillusionierung der Welt heißt, die Dinge, wie sie sind, sichtbar machen, utilitaristische, religiöse, fortschrittsorientierte Ideologien zu entlarven und Leser/innen Denkanstöße über Sinnes- und Selbsttäuschungen zu geben, um die aus ihnen folgenden Krisen und Katastrophen, wie sie beispielsweise in Cervantes‘ Roman Don Quichotezum Ausdruck kommen, zu vermeiden.7 Es heißt aber auch, in Analogie zum Humor, dass narrative Erzählwelten zusätzliche, nicht sichtbare Wirklichkeiten zulassen, so dass „im offiziell Geltenden das Nichtige und im offiziell Nichtigen das Geltende sichtbar werden“ kann.8 Romane des bürgerlichen Zeitalters, moderne Romane, stellen Grenzphänomene der Vernunft bzw. die Kehrseite einer als vernünftig angesehenen Welt dar. Da bürgerliche Romane von Anbeginn an mit ihren Erzählfiguren experimentieren – ein imaginäres „experimentelles Ego“ entwerfen und der „existentiellen Problematik (der Figuren) auf den Grund“ gehen,9 kann die zur Altersgelassenheit werdende Lebenshaltung der Rezipient/innen des dritten Lebensalters eine ästhetische Wahrnehmungssensibilität entwickeln, die hinsichtlich der Fragilität der Erzählfiguren in einer komplexen Erzählwelt, diese als poetische Verdichtung der „Komplexität der Existenz in der modernen Welt“10 reflektieren und in Plausibilitätsfragen manifestieren kann. Auf dem Prüfstand der Romane und der Leser/innen steht der epistemologische Anspruch der Erzählwelten mit ihrem ethischen Anspruch realistisch zu erzählen, um die gesellschaftliche Realität zur Humanität zur verändern. Erich Auerbachs Studie Mimesis stellt für diesen Anspruch eine klassische Definition bereit. Die „(…) ernste Darstellung der zeitgenössischen alltäglichen gesellschaftlichen Wirklichkeit auf dem Grunde der ständigen geschichtlichen Bewegung“, bildet das Zentrum realistischen Darstellens.11 Da aber realistisches Darstellen epistemologisch mit dem Erzählen von Wahrheit verknüpft ist (wie es wirklich ist und war), entsteht durch den Wahrheitsanspruch das Paradox des poetischen Realismus mit anthropologischem und ethischem Anliegen. George Levine kommentiert: „Realism (…) is paradoxically an attenuated form of a distinctly non-realistic narrative practice.“12 Erich Auerbach, George Levine und Odo Marquard sehen die Auflösung der Paradoxie in den Romanen des poetischen Realismus selbst: Diese Romane gestalten Lebens- und Entscheidungssituationen als Welten der Ambivalenz und Relativität und sie gestalten narrative Universen, die mit dem Erzählen des Erzählens spielen, sich selbst kommentieren und in Details und Gesamtkonstruktion ihren Leser/innen anthropologische und ethische Sinnangebote machen.13 Die Refiguration der Romanwelten durch die Rezipient/innen des dritten Lebensalters, der Diskurs über ihre Lektüreerfahrungen und Plausibilitätsfragen im Literaturseminar, können diese kulturkritischen Erfahrungen und Selbsterfahrungen im Zusammenwirken von individuellem Erinnern und kollektivem Gedächtnis, wie sie in der ambivalent strukturierten Gedächtnismetaphorik der Romane des Viktorianischen Zeitalters zum Ausdruck kommen, ermöglichen. Wenn nun imaginative Entwürfe mehr Realität enthalten als Empirie, dann entwickeln moderne Romane narrative Programme, die die Realität imaginativ perspektivieren. Was heißt das? Romane des Viktorianischen Zeitalters entwickeln das Paradox ihres poetischen Realismus ambivalent aus zwei antagonistischen Energien heraus: einer anthropologischen und einer ethischen Energie, die antithetisch gegeneinander wirken und die Inkohärenz ihrer Form als Schein ihrer Kohärenz durchschauen lassen. Die anthropologische Perspektive rückt die Frage in den Mittelpunkt: Was ist der Mensch?Die komplexen und sich überkreuzenden Handlungsstränge und Plots der Romane des Viktorianischen Zeitalters beantworten diese Frage auf der inhaltlichen Ebene, also auf der Ebene erzählerischer Dynamik, kulturpessimistisch: Menschen sind unberechenbar, unbesonnen, machtbesessen, gierig, abgründig, nicht festzulegen, exzentrisch, heimatlos. Aus dieser kulturpessimistischen Sicht entfalten sich in den Romanwelten Zufälle, Erwartungsbrüche, Perspektivenwechsel, Stimmungsumschwünge in asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen problematischen Individuen und einer zur Prosa gewordenen Welt, die sowohl die Machthaber, als auch die von ihnen manipulierten Subjekte als problematische, zwiegespaltene Subjekte – jedes auf seine Weise – zum Ausdruck bringen. Diese Dramaturgie der Doppelkrisen findet man beispielsweise auch bei Shakespeare, Goethe, Schiller und in den Opern Verdis. Die Seite der Mächtigen zeigt sich im Zwiespalt zwischen dem Bestreben, ihre Macht zu erhalten, bei innerer Bedrohung ihrer Autonomiefähigkeit und die Seite der ohnmächtigen Figuren befindet sich im Zwiespalt zwischen ihrer Autonomiefähigkeit und der inneren Bedrohung ihrer Autonomiemöglichkeiten. Die Blickrichtung der Mächtigen ist rückwärtsgewandt, die der Ohnmächtigen zukunftsgerichtet. Diese doppelgesichtigen Gegenströmungen werden in den Romanen des 19. Jahrhunderts kontingenzästhetisch gestaltet. Es entsteht ein Perpetuum mobile, das in der Darstellung durchkreuzter Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Möglichkeitsraum der Fiktion visionär deren Gegenperspektive – versöhnte personale Autonomie – entwirft. Dieses kontingenzästhetische Erzählgewebe ist gesellschaftskritisch angelegt und eröffnet bei Rezipient/innen des dritten Lebensalters aufgrund ihrer Lebenserfahrungen komplexe imaginative Möglichkeits- und Spielräume, die sie mit kulturell differenten Erfahrungen konfrontieren, weil sich gesellschaftliche und kulturelle Diskrepanzen narrativ erschließen und durch Zusatzmaterialien kulturgeschichtlich in Augenschein nehmen lassen. Die ethische Perspektive rückt die Frage in den Mittelpunkt: Was ist angesichts der Korrumpierbarkeit des Menschen und seiner Handlungen zu tun?Romane des Viktorianischen Zeitalters stellen diese Frage heutigen Leser/innen anheim und laden sie zu Plausibilitätsfragen ein, auf die unten eingegangen wird. Die Romane beziehen eine autoreferenzielle Gegenperspektive zur Elastizität ihrer inhaltlichen Behauptung, der Mensch sei abgründig und heimatlos. Sie flechten intentional kulturoptimistische Perspektiven ins narrative Gewebe ein. Entgegen der Intention, der Mensch sei kontingenzanfällig, breitet sich innerhalb des kulturpessimistischen Erzählgewebe die humoristisch bzw. in romantischer Ironie gestaltete Sichtweise aus, Menschen seien, mit Ausnahme der unbelehrbaren abgründig Bösen, gut und sozial harmoniefähig, symmetrischer Beziehung fähig, die personale Autonomie intersubjektiv möglich werden lässt. Diese affirmative Sicht, die der Gefahr einer Ontologisierung personaler Autonomie nicht entgeht, durchwirkt das kulturpessimistische Perpetuum mobileder Romane als aussagekräftiger Teil ihrer Ganzheit und stellt es ideologienahe still. Heutige Rezipient/innen des dritten Lebensalters empfinden diese ideologienahe Stillstellung als Erwartungsenttäuschung, als Bruch und Zerbrechen der narrativen Ganzheit, als die strukturelle Ambivalenz, die sie ist, die den Plausibilitätstest aus ihrer Sicht hinsichtlich der anthropologischen Ebene nicht besteht, selbst wenn symmetrische Potenziale in den asymmetrischen Beziehungen vom Erzählbeginn an angelegt sind. Formuliert man diese rezeptionsästhetische Problematik unter der Fragestellung, welche narrativen Potenziale der Mündigkeit und Reife die Romane des Viktorianischen Zeitalters den Rezipient/innen des dritten Lebensalters bieten, so erhält die epistemologische Ambivalenz dieser Erzählwelten eine erweiterte Perspektive: Die komplexe Verflechtung von Problemen und Krisen, mit denen sich die problematischen Individuen auf der anthropologischen Ebene der Romane auseinandersetzen, weisen auf Möglichkeiten einer noch unerreichten Mündigkeit und Menschenwürde hin. Jedoch durchkreuzt und ergänzt die ethische Dimension der Romane mit der in ihr enthaltenen idealisierten Tugendethik des 19. Jahrhunderts diese Möglichkeit und setzt ihr zugleich eine oft märchenhafte Vision von Mündigkeit und Menschenwürde entgegen. Die ästhetische Paradoxie des Realismus der Romane des Viktorianischen Zeitalters besteht aus einer romantischen Weltsicht, die illusionslos die Abgründigkeit des modernen Menschen aufdeckt, weil sie sich erzählerisch von ihren empirischen und naturalistischen Erscheinungsweisen entfernt. Sie öffnet eine Tiefe der narrativen Welt, in der sich traumanalog Gegenwart und Geschichte, Erforschung des Selbst und Mythos begegnen. Diese Begegnung gibt den Erzählwelten jenseits politischer Umstände eine erweiterte, ihre Epoche transzendierende Zeitebene, die bis in die Gegenwart heutiger Leser/innen reicht. Rezipient/innen des dritten Lebensalters erkennen in dieser Ästhetik romantischer Illusionslosigkeit die fiktionale Forderung nach Mündigkeit, die im Zeitalter des technischen Fortschritts historisch unerfüllbar blieb. In dieser Erkenntniskritik, die Unmündigkeit ästhetisch reflektiert, so auch in den Opern Verdis, wie Rigoletto, Otello, Macbeth, werden die Romane des Viktorianischen Zeitalters zu Wegbereitern modernen Erzählens; sie sind moderne Romane. Die Ambivalenz der antithetischen Energien, der anthropologisch-kritischen und der ethisch- affirmativen evoziert kreative Dialoge zwischen den Romanwelten des Viktorianischen Zeitalters und Rezipient/innen des dritten Lebensalters. Die Entdeckung, dass Handlungsverwicklungen und die Gestaltung der jeweiligen Romane kolportagehaft zusammengehalten werden bzw. auseinanderbrechen, die potenzielle Kohärenz der narrativen Form epistemologisch auseinandergetrieben wird und heute nicht mehr plausibel erscheint, regt zu Reflexionen an, inwiefern die konflikterzeugende Doppelgesichtigkeit der Konstellation von problematischen Protagonisten und Antagonisten auf den Inhaltsebenen der Romanwelten und Brüchen auf der narrativ formalen Ebene, transitorische Identitätserfahrungen kultursemiotisch wiedererkennen lassen? Shakespeares Komödien und Tragödien stellen die Frage nach dem modernen Selbstverständnis ebenso, wie die Wegbereiter des modernen Romans. Zu nennen sind beispielsweise Miguel Cervantes Don Quichote(1605/1615), Laurence Sternes Tristram Shandy(1759), Charles Dickens‘ Oliver Twist(1837) und, doppelperspektivisch, Dickens‘ Bleak House(1852), Charlotte Brontës Jane Eyre(1847), Emily Brontës mehrfach perspektivierter Ich-Roman Wuthering Heights(1848), Flauberts L’Education Sentimentale(1869), um nur einige zu nennen. Gestaltet wird die Suche nach personaler Autonomie, aus der Sicht gesellschaftlicher Außenseiter oder außergewöhnlicher Individuen. Selbstbestimmung wird zum ästhetischen Problem. Dort, wo im Mittelalter der Glaube zentral war und zur Zeit der Aufklärung das autonome Selbst zur abstrakten Idee wurde, entstand in der frühen Neuzeit und in der Romantik ein – wie Peter Gay deutet – „bedrohliches Vakuum“ („a frightening vacuum“), das bei Künstlern und Schriftstellern eine verzweifelte Suche nach „geistiger Zuflucht“ hervorrief. „Zur Debatte“, so Peter Gay, „stand das Bild vom Selbst“; die Suche gestaltete sich als Suche nach plausiblen Gestalten des Schöpferischen, als Entfesselung eines inneren Sinns und einer poetisch narrativen Wiederverzauberung der Welt.14 In dieser Entwicklung der Moderne, die ein Sinnvakuum hervorrief, wird der kulturdiagnostische Ausdruck der Romane erkennbar: Ihre durch strukturelle Ambivalenzen fragmentarisierten Universen konfrontieren die Entfremdungserfahrungen und das Sinnvakuum ihrer Zeit. Die Paradoxie des poetischen Realismus ist ihr Wahrheits- und Wiederverzauberungsmoment. Sie ruft über Plausibilitätstests, die weiter unten erläutert werden, kreative Wahrnehmungs- und Selbstreflexionsmöglichkeiten der Rezipient/innen des dritten Lebensalters hervor, weil moderne Romane, wie die Moderne, keine adäquate Antwort auf das moderne Identitätsparadigma geben können: „In der Moderne ist keine ‚zeitgemäße‘ Antwort auf die Identitätsfrage ein letztes Wort oder ein Akt, der definitiv zeigen könnte, wer eine Person (geworden) ist und sein möchte.“15 Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше