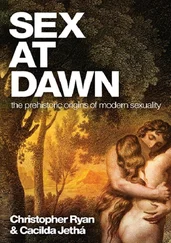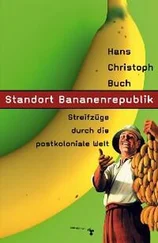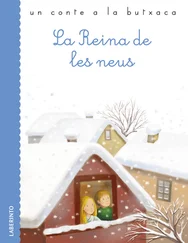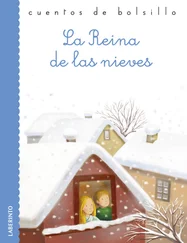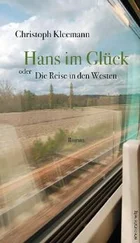“30 Baumans Buch stellt, wie auch das Werk Walter Schulz‘, die Moderne als vergeblichen Versuch dar, Ordnung und Eindeutigkeit herzustellen; vergeblich deshalb, weil die ineinander greifenden funktionalsierten Systeme Kontingenzen enthalten, die Ordnungsversuche immer wieder unterlaufen und Individuen in der funktionalen Differenzierung der Systeme sozial ortlos werden lassen. Das Individuum wird vieldeutig ambivalent, „ein partieller Fremder“31, oder, wie Walter Schulz formuliert, scheiternd und haltlos „bis zu den Erfahrungen der Selbstauflösung hin“32. Beide Autoren, der Soziologe und der Philosoph, verwenden u.a. Franz Kafkas Werke – Walter Schulz bezieht sich auch auf James Joyce – als Belege einer ästhetisch transzendenten Immanenz der Moderne. Der moderne Roman als offenes Genre – er ist „a mighty melting pot, a mongrel among literary thoroughbreds“33 – spricht, indem er sie narrativ gestaltet, die Ambivalenz der Moderne als Daseinsdiffusion und die aus ihr folgenden transitorischen Identitätserfahrungen der Rezipient/innen an. Er gestaltet als narrativer Kosmos Sinnfragen, er findet sie nicht. Rezipient/innen, insbesondere die des dritten Lebensalters, werden in ihren aspirierten imaginativen Identitätsmöglichkeiten von modernen Romanen affiziert. Fragen der Selbst- und Fremdbestimmung, des Selbstentzuges, der Autonomiebildungsmöglichkeiten, der Selbstranszendierung, der Gerotranszendenz, werden anhand der Konflikt- und Dilemmasituationen, in die die Erzählfiguren verstrickt sind, virulent. Immer geht es den Romanen um eine verdichtete Vergegenwärtigung von Vergangenheit, um eine an scheiternden Lebenserfüllungen orientierten Ganzheit,34 die transitorisch zukunftsoffen gestaltet ist: The novel presents us with a changing, concrete, open-ended history rather than a closed symbolic universe. Time and narrative are of its essence. In the modern era, fewer and fewer things are immutable, and every phenomenon, including the self, seems historical to its roots. The novel is the form in which history goes all the way down.35 Moderne Romane sind unterhaltsame, erkenntnisfördernde Gedächtnismedien, deren Erzählwirklichkeit als „ subjektiv entworfene Welt()“ in der „subjektiven Brechung“des Erzählers und der Romanfiguren entsteht.36 Diese subjektiven Erzählwirklichkeiten sind als moderne Gedächtnismedien zu verstehen: „The novel is the mythology of a civilization fascinated by its own everyday existence.“37 Die kulturgeschichtlich transitorische Offenheit moderner Romane öffnet ihren Protagonisten prekäre Freiheitsspielräume, in denen konstitutive Identitätserfahrungen des Selbstentzugs gestaltet werden: Modern subjects, like the heroes of modern novels, make themselves up as they go along. They are self-grounding, and self-determining, and in this lies the meaning of their freedom. It is, however, a fragile, negative kind of freedom, which lacks any warranty beyond itself.38 1.2 Kultursemiotischer Ansatz. Die Rezeption moderner Romane als kulturelle Gedächtnismedien Bei der Erschließung literarischer Texte sind diese nicht nur als Texte zu berücksichtigen, sondern auch als kulturelle Institutionen ihrer Entstehungszeit. Literarische Texte sind aufgrund ihrer spezifisch ästhetischen Differenz zwar Teile kultureller Ordnungen, aus denen sie hervorgehen, sie wirken aber auch auf diese zurück und sind zukünftig erschließbar. Geht man mit Ansgar Nünning und Roy Sommer von einem Kulturbegriff aus, der „semiotisch(), bedeutungsorientiert() und konstruktivistisch()“ ist,1 dann sind Kulturen, in Anlehnung an Roland Posners Kulturmodell, menschlich hergestellte Gebilde, die „nicht nur eine materiale Seite haben, sondern auch eine soziale und mentale“.2 Modellhaft formuliert lassen sich der sozialen Dimension Individuen, Institutionen und Gesellschaft, der mentalen Dimension Mentalitäten, Selbstbilder, Normen und Werte und der materialen Dimension Gemälde, Architektur, Gesetzestexte und literarische Texte zuordnen.3 In Bezug auf die Epoche der Moderne lassen sich demzufolge der sozialen Dimension Industrialisierung, Urbanisierung, Autoren und Leser, der mentalen Dimension Utilitarismus, Egoismus und patriarchalisches Tugendsystem und der materialen Dimension, in Bezug auf literarische Texte, beispielsweise Romane mit problemorientierten Handlungen und spezifischen Lösungsvorschlägen zuordnen. Nach Nünning und Sommer fasst dieser Kulturbegriff Kultur als den „von Menschen erzeugte(n) Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen auf(), der sich in Symbolsystemen materialisiert.“4 Nünning und Sommer schließen mit Posner, dass dem bedeutungsorientierten Kulturbegriff zufolge künstlerische Ausdrucksformen der materialen Dimension ebenso zuzuordnen sind, wie die mentalen Dispositionen und die sozialen Dimensionen, die diese Ausdrucksformen hervorbrachten bzw. prägten. Da zwischen diesen drei Dimensionen komplexe Wechselwirkungen bestehen, ergibt sich für das Erschließen literarischer Texte aus einer bestimmten Kultur, in Bezug auf ihre Gehalte und Formen, dass sie in verdichteter Form „Aufschluss über die mentalen Dispositionen der entsprechenden Epoche geben“.5 Literarische Texte sind also nicht nur künstlerischer Ausdruck zeitgenössischen Denkens, sondern geben Aufschluss über die Selbstwahrnehmung und das kulturelle Bewusstsein einer Epoche, wie sie sich selbstreflexiv kulturdiagnostisch in den Werken als ästhetisch Besonderes thematisieren. Nünning und Sommer ziehen aus dem von ihnen konzipierten Gegenstandsbereich einer kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft drei Konsequenzen: 1 Bei kulturellen Einheiten handelt es sich nicht um vorgefundene Objekte, sondern um menschliche Konstrukte. 2 Wenn Literaturwissenschaft als Teil der Kulturwissenschaft verstanden wird, dann ist von einem weiten Literaturbegriff – Literatur als Teil der Medienkultur – auszugehen. 3 Die Gegenstandskonstitution einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft ergibt sich aus den drei Dimensionen des Kulturbegriffs. Neben literarischen Texten berücksichtigt sie die mentale Dimension einer Kultur und die literarische Verarbeitung „gesellschaftlich dominanter Sinnkonstruktionen (…)“.6 Die von Nünning und Sommer konzipierte kultursemiotische Theorie bietet Anschlussmöglichkeiten an die zentralen Kategorien Literatur, Mentalität, kulturelles Gedächtnis.7 Sie bietet zudem Anschlussmöglichkeiten an die rezeptionsästhetisch kontroverse Erschließung moderner Romane als kulturelle Gedächtnismedien. Diese werden als „kulturelle Ausdrucksträger“8 verstanden, die nicht Objekte, sondern „Formen der kulturellen Selbstwahrnehmung und Selbstthematisierung“9 einer Epoche sind. Sie können in der Interaktion mit Rezipient/innen kultursemiotisch reflektiert werden. Romane sind fiktionale Welten, Erzählwelten.10 Als das Andere der Realität entwerfen sie Möglichkeitswelten, die die kognitiven, imaginativen und affektiven Fähigkeiten ihrer Leser/innen ansprechen. Literarische Texte regen im Lektüreprozess ihre Leser/innen an, sich mit dem Selbst- und Weltverständnis der Figuren, ihren Gedanken, Gefühlen und Entscheidungen auseinanderzusetzen und damit „die Gefühle und Gedanken anderer zu erschließen“.11 Im Lektüreprozess baut sich die erzählerische Form der Selbst- und Weltbilder der Figuren und ihrer Interaktionen als Gegenentwurf zu ideologischen Mustern und begrifflichen Vereinnahmungen auf.12 Dieser Gegenentwurf zeichnet sich als Möglichkeitsraum aus, dessen Rätsel- und Fragecharakter die Erfahrungswirklichkeit seiner Leser/innen durch die Nähe zu ihrer Erfahrungswelt und durch die ästhetische Distanz seiner erzählerischen Gestalt, die diese Nähe ermöglicht, zum Ausdruck bringt. Die ästhetische Erfahrung „(…) gewährt den Leserinnen und Lesern auf dem Weg der Lektüre Anteil an anderen, entfernten oder fremden Welten und Denkvorstellungen und macht ihnen zugleich das Angebot, bisher ungewohnte oder, im wörtlichen Sinne, befremdliche Erfahrungen und Wahrnehmungen in ihr eigenes Denken und Handeln zu integrieren.
Читать дальше