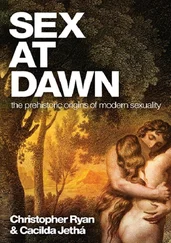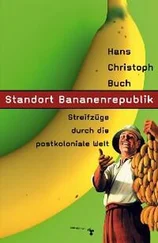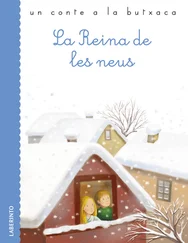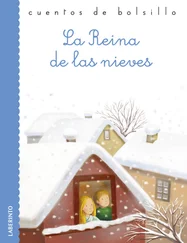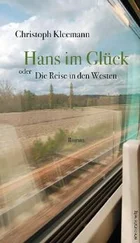Dickens‘ Werk Oliver Twistund Charlotte Brontës Roman Jane Eyre(1847), der in Gestalt einer fiktiven Autobiografie die Zeit des Hochkapitalismus und den Auflösungsprozess des Patriarchats in Großbritannien narrativ konfrontiert, werden einem eigenem Abschnitt zugeteilt. Unter dem leitenden Aspekt transitorischer Identitätserfahrungen in der Moderne kann einsichtig werden, dass beide Romane, trotz ihrer unterschiedlichen Entstehungszeiten und gesellschaftlichen Hintergründe, in Gestalt der Paradoxie des poetischen Realismus ihre Protagonisten scheitern lassen und in die Grundauffassung einer auf Erfüllung angelegten Subjektivität einbetten. In der kulturgeschichtlichen Terminologie Erich von Kahlers bestehen beide Romane aus Mischformen eines individualpsychologischen und, wie oben dargelegt, existenzialistischen Erzählens. Der Abschnitt zu Charles Dickens‘ Frühwerk Oliver Twist, mit dem der dritte Teil beginnt, fällt etwas umfangreicher als die dann folgenden Abschnitte zu den Romanen der Brontës und zu dem Virginia Woolfs aus. Das liegt daran, dass – entgegen älterer Forschung zu diesem Roman – Dickens‘ Oliver Twistinnovative Erzählstrategien an den Tag legt, die ihn in den Deutungen der neueren Forschung zum Wegbereiter des modernen Romans bzw. zum modernen Roman werden lassen (Fludernik, Bowen, Cheadle beispielsweise). Diesen Deutungen, die den Roman als Ganzen in den Blick nehmen, gehen die Ausführungen im dritten Teil nach. Begleitet von eigenen Beobachtungen werden sie zu innovativen rezeptionsästhetischen Erschließungspotenzialen. Der zweite Abschnitt des dritten Teils wird durch Deutungen von Emily Brontës Roman Wuthering Heights(1847) und Virginia Woolfs Roman Mrs Dalloway(1925) beschlossen. Emily Brontës Roman antizipiert durch seine raffiniert gestaffelten dezentrierten Ich-Erzähler die Multiperspektivität der durch innere Monologe ineinandergreifenden, chiastischen Textstruktur von Mrs Dalloway, der exemplarisch für experimentelle Romane der klassischen Moderne anzusehen ist. Unter dem leitenden Aspekt transitorischer Identitätserfahrungen in der Moderne erkennt man, dass beide Romane, trotz der unterschiedlichen Epochen, in denen sie entstanden sind, durch die narrative Auflösung der Paradoxie des poetischen Realismus, die Nicht-Erfüllbarkeit privaten Glücks und subjektiver Chancengestalten. Die Mehrdimensionalität moderner Subjektivität und die Undurchschaubarkeit ihres Weltbezuges40 verdichten narrativ die Orientierungs- und Haltlosigkeit von Subjekterfahrungen in der modernen Welt. In der kulturgeschichtlichen Terminologie Erich von Kahlers bestehen beide Romane aus Mischformen des im oben dargelegten Sinne existenzialistischen und innerweltlich transzendenten Erzählens. Die vier Romane stellen zusammen mit der Frage nach Herkunft und Zukunft moderner Identitätserfahrungen auch die Frage nach dem Sinn romanhaften Erzählens in der Moderne. Sie gestalten gegensätzliche Figuren und Erzählsituationen mit spiegelsymmetrisch geheimen Verwandtschaften. Multiperspektivisch erforschen sie Facetten der modernen transitorischen Identitätsproblematik, die angesichts signifikant Anderer virulent wird, und sie regen über diese strukturellen Ambivalenzen zum hermeneutisch-kritischen Diskurs an. Der abschließende Teil dieser Arbeit zieht ein Fazit und gibt Hinweise auf Forschungsdesiderate, deren Bearbeitung einen Paradigmenwechsel in der kultursemiotisch orientierten Literaturwissenschaft herbei führen könnte. Teil 1 Moderne Romane als Möglichkeitsräume des transitorischen Identitätsparadigmas 1.1 Romane lesen. Die Ambivalenz der Moderne Warum Romane lesen, die in Großbritannien im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden – ausgewählte Romane von Charles Dickens, Charlotte und Emily Brontë und von Virginia Woolf? Was bieten diese Romane Rezipient/innen, die an der Goethe-Universität des 3. Lebensalters zu Frankfurt/M Literaturseminare im Fachbereich Anglistik freiwillig und aus Interesse besuchen? Zum einen eröffnen die Erzählwelten Einblicke in eine zurückliegende Kultur, die bis in die Gegenwart hinein wirkt. Zugleich setzen sie eine selbstreflexive, kritische Auseinandersetzung in Gang, in der die Rezipient/innen, im Erschließen dieser Erzählwelten, ihre Werte und Normen aufs Spiel setzen. Sieht man mit Jürgen Straub persönliche Identität als normativen und sozialen Anspruch, den Individuen zwar an sich selbst stellen, aber auch wissen, dass sie ihn nicht erfüllen können,1 so kommen im Erschließen der Erzählwelten Fragen der Selbst- und Fremdbestimmung, der Autonomiebildungsmöglichkeiten und ihrer Vorenthaltungen oder Verhinderungen ins Spiel, die im Horizont eines Sich-in-der Zeit-Verstehens, anhand komplexer Erzählfiguren und ihrer Einbindung in die jeweilige Gestalt der Erzählwelten erarbeitet und ästhetisch erfahren werden können. Wie alle modernen Romane gestalten auch Romane, die seit Beginn der Moderne um 1750 in Großbritannien entstanden, Erforschungen des Ich, in die das Paradoxon persönlicher Identitätserfahrung in der Moderne eingelassen ist. Der Psychoanalytiker Donald W. Winnicott fasst dieses Paradoxon als Kommunikation des sozialen Selbst mit einer nicht-kommunizierbaren Energie des persönlichen Selbst. Diese Energie muss sich der Mensch bewahren, will er nicht zum außengelenkten, falschen Selbst werden. Sie macht seine Menschlichkeit aus, die die Gesellschaft als sein Heiligtum unangetastet lassen sollte: Im Zentrum jeder Person ist ein Element des ‚incommunicado‘, das heilig und höchst bewahrenswert ist (…). (Ich) glaube, daß dieser Kern niemals mit der Welt wahrgenommener Objekte kommuniziert, und daß der Einzelmensch weiß, daß dieser Kern niemals mit der äußeren Realität kommunizieren oder von ihr beeinflußt werden darf (…). (Jedes Individuum ist) in ständiger Nicht-Kommunikation, ständig unbekannt, tatsächlich ungefunden.2 Das von Winnicott formulierte Paradox persönlicher Identitätserfahrung besteht demnach darin, dass im individuellen Allein-sein-Können „eine außerhalb des einzelnen liegende Bedingung (…), eine soziale Bedingung“3, zur Geltung kommt, die im Zusammenspiel von Selbstakzeptanz, Verhandelbarkeit persönlicher Identität und selbstorganisertem Leben, den potenziellen Raum des Selbst zwischen sich und signifikanten Anderen öffnet. Nach Jürgen Straub besteht das Paradox persönlicher Identität in sozialpsychologischer Weiterführung darin, dass es die Erfahrung „(…) einer Einheit (ist), die unabschließbar, entzweit, unangreifbar und vor allem zugleich dauerhaft angestrebt und fortwährend unerreichbar bleibt.“4 Im Laufe eines Entwicklungs- und Bildungsweges entstehen individuelle Handlungspotenziale, die, weil sie sich in Interaktionen mit signifikanten Anderen entwickeln, komplexe und reiche Identitätsbildungsmöglichkeiten entstehen lassen, die Konstrukte einer tautologischen Identität als Sich-Selbst-Gleichheit nicht ermöglichen. Persönliche Identität, so Straub, „meint aspirierte, angestrebte, imaginierte Identität“, die die Handlungspotenziale einer Person konstituiert und ihre Verhaltensweisen motiviert.5 Mit Erikson grenzt Straub eine für Erfahrungen offene persönliche Identität von einer Identitätsdeutung ab, die Identität als totalitär strukturiertes Zwangs- und Gewaltverhältnis sieht.6 Aus der Unterscheidung von Totalität und Identität gewinnt Straub das Konzept „transitorische(r) Identität“7, dessen konstitutives Elemen ein „unhintergehbare(r) Selbstentzug“ ist,8 der in diachroner und synchroner Differenzierung zur Grundlage einer offenen und kreativen Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur Selbsttranszendierung wird.9 Aus dieser resultiert ein Weltinteresse, das menschliches Leben nicht als funktionales Teilelement eines übergreifenden Zusammenhanges sieht, sondern als Sinn-Ganzes entwirft: Jedes menschliche Leben ist (…) ein Sinn-Ganzes. Der einzelne hat selbst seine Handlung in einem unbedingten Sinne zu verantworten.
Читать дальше