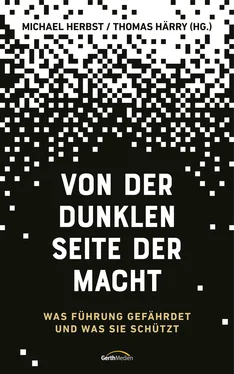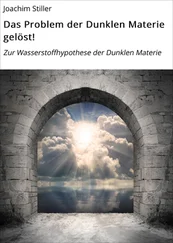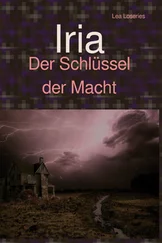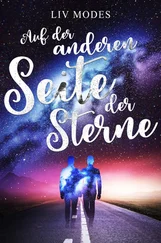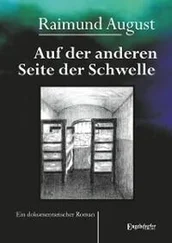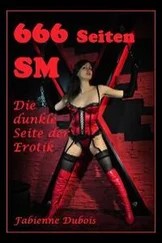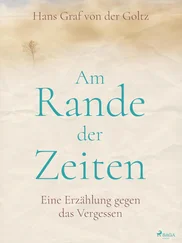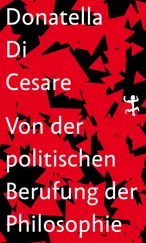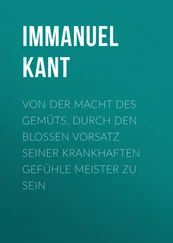Im Blick auf geistliche Führung und Leitung möchte ich einen Aspekt hervorheben: Mit ihren Entscheidungen kümmert sich die Führungskraft darum, dass die Gemeinde ihrem „Why“ treu bleibt. Sie sind die Hüter des „Why“. So zugänglich, beweglich, lernbereit sie auch sonst sind: Wenn es um das gemeinsam erkannte „Why“ geht, führen geistliche Führungskräfte robust. Sie lehren das „Why“. Sie erklären das „Why“. Sie erinnern an das „Why“. Wenn nötig, verteidigen sie das „Why“. Und mit ihren Entscheidungen setzen sie das „Why“ in konkretes Handeln um. Das ist ihre Aufgabe. Das ist Führung und Leitung. Es ist mehr als Moderation. Und es ist heute nicht weniger notwendig als früher.
Freilich können wir nach allen Skandalen und Enttäuschungen nicht mehr naiv über diese Seite geistlicher Führung und Leitung sprechen. Darum muss es zum Schluss um Schutzfaktoren gegen Missbrauch von Führung und Leitung gehen.
Vier Schutzfaktoren:
Plural – vielfältig – geteilt – auf Zeit gewählt
Gefragt, was ich selbst in den letzten Jahren hinsichtlich guter Führung in der Gemeinde gelernt habe, wäre dies meine Antwort: Es gibt „Schutzfaktoren“ gegen Missbrauch, die wir in den christlichen Gemeinden höher achten sollten. Manche dieser Schutzfaktoren gehören zu den Prinzipien moderner Demokratien. Und da kann man schon sagen, dass die „Kinder der Welt“ zuweilen klüger sind als die Kinder Gottes. Manche entsprechen Einsichten, die in den letzten Jahrzehnten auch in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nach vorne getreten sind. Meiner Einsicht nach haben wir Grund, hier einiges zu lernen und nicht hochmütig über den „Zeitgeist“ zu spotten.
In aller Kürze sind es vier Schutzfaktoren, die wir brauchen:
1. Pluralität: Peter Böhlemann zeigt in seinem Beitrag zu diesem Buch, wie schon in der Bibel Leitung von mehreren wahrgenommen wird. Am Beispiel des Mose wird deutlich, wie unklug und überlastend es ist, die gesamte Last allein tragen zu wollen. In der ersten Gemeinde in Jerusalem muss die Vollzahl der zwölf apostolischen Leiter wiederhergestellt werden. In Eph 4,11 f. begegnen uns gleich fünf Leitungsdienste.
2. Vielfalt: Pluralität bedeutet eine Mehrzahl von Führungspersonen, Vielfalt bedeutet eine Mehrzahl von Führungspersönlichkeiten. Divers aufgestellte Leitungsteams sind sicher „anspruchsvoller“ als uniforme Ältestenkreise. Unterschiedlichkeit soll ja gelegentlich anstrengend sein. Wenn aber die Mannschaft auf der Brücke die Vielfalt in der Gemeinde widerspiegelt, wenn also Frauen und Männer leiten, jüngere und ältere Führungskräfte sich einbringen, Menschen, die immer schon hier waren, mit solchen, die zugewandert sind, führen, Introvertierte neben Extrovertierten dienen, missionarisch Leidenschaftliche neben seelsorglichen Kümmerern mitsprechen, von Tradition Begeisterte und Aufbruchswillige um den rechten Kurs ringen, und wenn sie einigermaßen beziehungsfähige Wesen sind, dann mag es anstrengend werden, aber die Prozesse, die zu Entscheidungen führen, beachten mehr Aspekte als bei uniformen Leitungsgruppen. Es gerät mehr und anderes in den Blick. Es werden Probleme erkannt, aber auch Möglichkeiten gesichtet, die sonst verborgen geblieben wären. Es gibt Konflikte, aber gute Führungsteams begrüßen Konflikte als das nötige Ringen um den besten Weg.
Mit Peter Böhlemann zusammen habe ich vor Jahren einen kleinen Selbsttest entwickelt, mit dem Leitende ihrem eigenen Leitungsstil auf die Spur kommen können.7 Ähnlich wie in säkularen Organisationen bewegt sich unser Leitungscharisma zwischen drei Polen, die wir mit Farben versehen haben: dem roten Pol (Leitung, die vorangeht und mit Visionen begeistert), dem grünen Pol (beziehungsstarke Leitung, die gute Teams aufbaut und niemanden unterwegs verloren gibt) und dem blauen Pol (fachlich kundige und theologisch kluge Leitung, die auf die Lehre achtet und die gemeindlichen Abläufe gut beherrscht). Nur ist niemand vollständig „rot“ oder „blau“ oder „grün“; vielmehr sind wir alle eine je eigene Mischung von „rot“, „blau“ und „grün“. Eine Farbe kann dabei dominant sein, aber niemandem fehlt eine Farbe vollständig. Im Ergebnis hat jeder in der Leitung damit seine spezifische Stärke, aber auch seine Schwäche und seinen „Schatten“. Und die Gemeinde – das war und ist unsere Pointe – braucht Menschen mit unterschiedlichen Mischungen und Schwerpunkten. Darum kann (!) im Grunde die Führung in der Gemeinde nicht von einem allein geleistet werden. Es täte der Gemeinde nicht gut; und es überforderte auch den, der mit seiner Teilbegabung nun doch das Ganze bewältigen soll. Besser geht es im Team!
3. Geteilte Leitung: Das klingt zunächst wie eine schlichte Wiederholung der ersten beiden Punkte; hier aber geht es um Begrenzung von Macht: Niemand sollte allein die gesamte Verantwortung tragen. Und niemand sollte über alle Macht in der Führung einer Gemeinde verfügen. Das ist nun wirklich eine der Lehren aus den Ereignissen in der Willow-Creek-Gemeinde: Das Risiko sinkt, wenn mehrere Verantwortung tragen und wenn jeder noch jemanden hat, vor dem er Rechenschaft leistet. Checks and balances mögen wiederum anstrengend sein und auch Zeit kosten. Aber diese „Kosten“ geteilter Leitung werden mehr als aufgewogen durch die Vorteile. Jeder, der leitet, sollte die Teilung der Zuständigkeiten und des Einflusses geradezu begrüßen, wenn nicht einfordern: Diese Teilung schützt ihn bzw. sie (auch vor sich selbst) und die Gemeinde vor „ungebremster“ Machtausübung.
4. Befristete und gewählte Leitung: Auch das klingt fast wie eine Wiederholung. Aber es zieht die Folgerungen aus dem bisher Gesagten, nun aber „auf dem Zeitstrahl“: Niemand sollte ohne Begrenzung Verantwortung tragen müssen und Macht in Händen halten. Die Gemeinschaft beruft Einzelne auf Zeit und vertraut ihnen für eine bestimmte Wegstrecke Macht und Mittel an, um leitend und führend zu gestalten. Auf Zeit! Die Abwechslung tut der Gemeinde gut, und jeder, der führt, weiß auch, dass der Tag kommt, an dem er wieder „ins Glied“ zurückmuss – und darf! Amerikanische Präsidenten dürfen nur zweimal gewählt werden und nach acht Jahren ist ihre Amtszeit definitiv vorüber. Befristung der Amtszeit und Begrenzung der Wiederwahlen sind u. E. auch für Gemeinden eine kluge Regel. Wir sagen auch: Die Gemeinschaft vertraut Einzelnen Macht und Mittel auf Zeit an. Manchmal gibt es unter Christinnen und Christen auch Vorbehalte dagegen, die Spielregeln der Demokratie (auch wenn sie diese für den Staat bejahen) auf die Gemeinde zu übertragen. Die Gemeinde sei doch keine politische Größe, hier gelten doch andere Regeln – und der Heilige Geist soll doch Menschen zum Dienst aussondern (Apg 13,2). Wenn man aber genauer hinschaut, finden wir gerade in der Apostelgeschichte mehrere Episoden, in denen die Vollversammlung der Gemeinde zu Entschlüssen kommt (Apg 15,22), Kandidaten nominiert und Diakone wählt (Apg 6,5) usw. Es ist sowieso ein Fehlschluss, das Handeln Gottes nur dort zu suchen, wo Menschen möglichst wenig beteiligt sind. Wer sagt denn, dass durch menschliche Wahlprozesse hindurch nicht der Geist sein Wählen und Rufen durchsetzt? Jedenfalls erscheint es uns nicht gerade geistlicher, diese Entscheidungen auf wenige zu beschränken, sodass die, die jetzt schon leiten, ihren Kreis immer nur selbst ergänzen und/oder ihre eigenen Nachfolger bestimmen.
Jedenfalls erscheinen Pluralität und Vielfalt wie auch geteilte Leitung und befristete Wahlperioden als gute Schutzmechanismen für christliche Gemeinden, die aus den hier verhandelten Ereignissen Schlussfolgerungen ziehen möchten.
Fragen zum Nach-Weiter-Selber-Denken 
Читать дальше