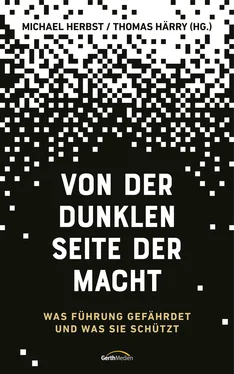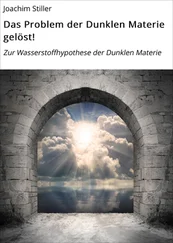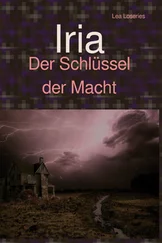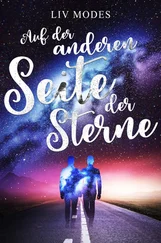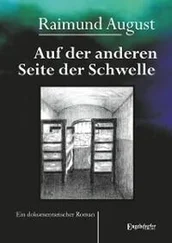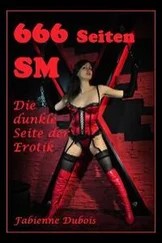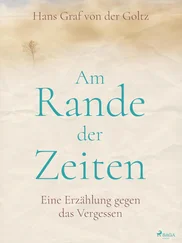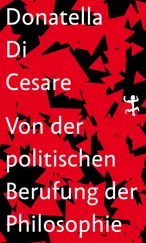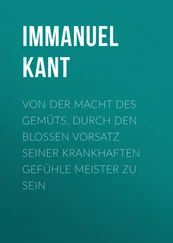Was ist zu tun?
Führung ist also immer gefährdet. Das liegt in der Natur dieser großartigen Tätigkeit. Was ist zu tun? Sie finden dazu viel Gutes in weiteren Kapiteln dieses Buches. Deshalb fasse ich mich kurz: Diese Gefährdungen zu bejahen ist die halbe Miete. Noch besser ist, wenn ich weiß, welchen dieser Neigungen ich besonders leicht nachgebe. Wenn ich bejahe, dass ich wie jede Führungskraft auch dysfunktionale Anteile in mir habe – manche in milder, andere in stärkerer Ausprägung.12 Ich bejahe die Selbstführungsaufgabe, meinen damit verbundenen Appetit zu zügeln.13 Schließlich hilft immer auch ein Blick in die eigene Vergangenheit, besonders in die Herkunftsfamilie. Meistens wurzeln meine größten Gefährdungen in dort gemachten Erfahrungen. In dort entstandenen Wunden, Mangelgefühlen und Denkmustern. „You have to go home!“ – „Du musst nach Hause gehen!“, heißt ein Slogan in der Familiensystemtherapie Murray Bowens, deren Grundsätze vermehrt im Führungskontext Anwendung finden.14 „Nach Hause gehen“ heißt: lernen zu verstehen, was mich in meiner Entwicklung geprägt hat. Welche Spuren des Segens und welche Zumutungen mich aufgrund meiner familiären, sozialen und kirchlichen Prägung begleiten. An welcher Stelle ich als Erwachsener ein gezieltes Nachreifen15 brauche.
Lautes und leises Scheitern
Beim Thema Führungsversagen denken wir rasch an krasse Geschichten. An Fehltritte, wie sie in der Einführung dieses Buches erwähnt wurden. Wären sie selten, müsste es dieses Buch nicht geben. Doch das ist nur eine Form des Scheiterns. Ich nenne es das „laute Scheitern“. Es ist weithin sichtbar und verbunden mit allen entsprechenden Schäden und Konsequenzen. Daneben gibt es eine andere, viel öfter vorkommende Form von Führungsversagen. Ich nenne es das „leise Scheitern“. Darunter verstehe ich Verhaltensweisen von Führungspersonen, die nur selten zum großen Knall führen, in letzter Konsequenz aber genauso großen Schaden anrichten wie lautes Scheitern. Es kann sein, dass das „leises Scheitern“ einer Führungsperson nie benannt, nie aufgedeckt, nie geahndet wird – weil es eben leise und unauffällig geschieht. Es wird gerne übersehen und verharmlost. Es gibt in unseren Kirchen und Organisationen Hunderte, ja Tausende Fälle von leisem, unentdecktem Leitungsversagen. Der damit verbundene Schaden ist immens. Wovon spreche ich? Leises Scheitern geschieht dort …
wo Führungskräfte ihre Leitungsaufgabe halbherzig wahrnehmen und fundamentale Führungsgrundsätze missachten.
wo Leitende ihre Zeit vertrödeln, stundenlang unnötig am Handy hängen, anstatt die strategischen und geistlichen Schritte in die Wege zu leiten, die ihre Organisation nach vorne bringen würden.
wo sich Geistliche in ihrem Arbeitszimmer verschanzen und tagelang kaum erreichbar sind, statt sich um die Menschen zu kümmern, die ihren Rat und ihre spirituelle Führung brauchen.
wo Pastorinnen und Pastoren sich nicht mehr die Zeit nehmen, vor Gott still zu werden, die Bibel zu lesen, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu hören und daraus ihr Wirken zu gestalten.
wo Leitende sich nicht um ihre Mitarbeitenden kümmern, keine Fördergespräche führen, kaum Anerkennung und Wertschätzung für deren Engagement ausdrücken.
wo sich Leitende in Konkurrenzdenken und belanglosen Grabenkämpfen erschöpfen, überall das Haar in der Suppe suchen, sich erlauben, zynisch und lieblos zu werden, und der Gemeinde in ihren Predigten immer wieder zu verstehen geben, wie unzufrieden sie mit ihr sind.
wo Menschen in Verantwortung an ihren Führungssesseln kleben, sich nicht weiterbilden, ihren Leitungsmuskel nicht mehr trainieren, nichts Neues mehr lernen und stattdessen vor sich hin wursteln, mal dies, mal jenes Modell kopieren, alles ausprobieren und nichts wirklich zu Ende bringen.
wo Pfarrerinnen und Pfarrer sich einreden, sie seien richtig gute Verkündigerinnen und Verkündiger – oder würden vorbildlich leiten, obwohl die Mehrheit in ihrem Umfeld dies ganz anders sieht, es aber nicht laut sagen darf.
wenn Leitende jede Rückfrage und Kritik zu ihrem Führungsverhalten als inkompetentes Laiengeblök oder diabolische Anfechtung abtun und nicht willig sind, sich ernst gemeinten Anfragen zu stellen.
Leises Scheitern hat viele Gesichter. Dies sind nur einige davon. Sie führen zu den leisen Dramen vernachlässigter, nicht wirklich ernst genommener Führung. Meiner Meinung nach leiden Kirchengemeinden und Organisationen weit mehr an diesen stillen, kaum je wirklich öffentlich werdenden Katastrophen als an den großen, medialen Skandalen. Wohlverstanden: Beides sind Katastrophen, die dem Leib Christi schaden. Aber es ist eben nicht nur die Sünde des Machtmissbrauchs, des sexuellen Übergriffs oder der Veruntreuung von Geldern – sondern genauso die Sünde der Faulheit, der Oberflächlichkeit und der stillen Verweigerung. Erstere werden zu Recht geahndet. Letztere viel zu oft und zu Unrecht geduldet.
Zwei besondere Minenfelder
Mit der Thematik des leisen Führungsversagens haben wir uns Gefährdungen angenähert, die nicht primär in der Natur der Führungsarbeit liegen. Sie haben stärker mit der einzelnen Führungsperson selbst zu tun, mit ihren Einseitigkeiten und Defiziten. Die Grenzen zwischen potenziellen, im Wesen einer Führungsarbeit liegenden Risiken und solchen, die in der einzelnen Führungsperson schlummern, sind fließend. Manchmal aber sind es die persönlichen Defizite der Person, die den Ausschlag geben. Dazu gehören auch fachliche Defizite, wobei diese am leichtesten zu beheben sind.16 Komplizierter ist es bei charakterlichen, spirituellen und psychischen Defiziten. Das meiste Scheitern geht auf ihr Konto. Die damit verbundenen Ursachen werden besonders dort leicht übersehen, wo eine Führungsperson ihre Aufgaben kompetent anpackt, viel bewegt und eine gewinnende Ausstrahlung hat. Schauen wir zwei dieser Risiken näher an: die Dynamik des Verdrängens und das Phänomen des Narzissmus. Manchmal wirkt beides ineinander, verstärkt sich gegenseitig und führt so zu besonders schwerwiegendem Führungsversagen.
Verdrängung und Selbsttäuschung
Verdrängung und Negierung bilden den Hintergrund vieler Fälle von leisem oder lautem Scheitern. In den 1950er-Jahren entwickelten die Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham das Konzept des „Johari-Fensters“17. Darin sprechen sie vom sogenannten „blinden Fleck“ im Selbstbild einer Person. Zum blinden Fleck gehört alles, was jemand an sich selbst nicht wahrhaben will.
Ein Beispiel: Das Umfeld einer Leiterin erlebt diese in vielerlei Hinsicht als selbstbezogen. Zudem kommuniziert sie schlecht und sorgt ständig für Missverständnisse. Die Leiterin selbst aber versteht sich als empfindsame, hingebungsvolle und kommunikative Person.
Die Psychologin und Traumaberaterin Diane Langberg hat sich intensiv mit Missbrauchsfällen im kirchlichen Kontext auseinandergesetzt und kommt zum Schluss, dass sowohl die involvierten Täter, aber auch viele ihrer Anhänger zur Selbsttäuschung neigen: Da kommt ans Licht, dass ein Leiter über Jahre hinweg andere sexuell missbraucht hat. Weshalb hat das so lange keiner bemerkt? Antwort: Es wollte keiner wahrhaben. Alle dachten, dieser Leiter sei einfach nur toll, integer, glaubwürdig. Davon fest überzeugt, haben selbst Mitarbeitende im nahen Umfeld des Leiters sämtliche vorhandenen Warnlichter ignoriert, verdrängt und verschwiegen. Auch der Täter selbst unterlag der Täuschung, indem er sich selbst vergewisserte, wie sehr er sich für Gottes Sache engagiert. Dass er für andere doch nur das Gute will. Dass es legitim ist, sich da und dort eine kleine Ausnahme zu erlauben. Und so rechtfertigte er sein fragwürdiges Handeln vor sich selbst, hielt es für richtig oder zumindest für harmlos.18 Langberg weist darauf hin, dass sich die Neigung zur Selbsttäuschung und das Vorhandensein großer Stärken vielfach in die Hände spielen: „Täuschung spielt oft gerade dort eine große Rolle, wo jemand über eine hohe Stellung verfügt, ein enormes theologisches Wissen hat, sich auf faszinierende Weise sprachlich ausdrücken kann und sich eloquent in der Öffentlichkeit zu bewegen vermag. Dies alles sind Instrumente der Macht, die es einem Menschen ermöglichen, andere zu täuschen und diese Täuschung geschickt zu verbergen.“19 Ein Phänomen, das sich in der Aufarbeitung vieler Leitungsskandale der jüngeren Geschichte bestätigt.
Читать дальше