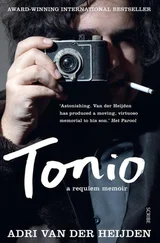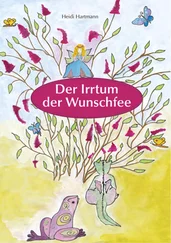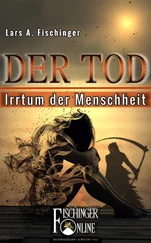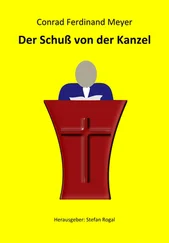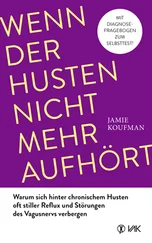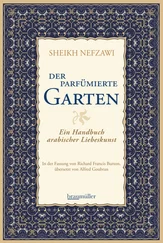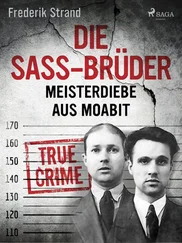Mastozytosen
Die Mastozytosen sind eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen sich die Mastzellen unkontrolliert vermehren, atypische Formen annehmen und auch oft in ihrer Aktivität erhöht sind. Bei 80 Prozent der Betroffenen lässt sich eine Punktmutation im c-KIT-Gen nachweisen. Dies hat eine erhöhte Aktivität und einen verzögerten natürlichen Zelltod von Mastzellen zur Folge sowie eine ständige oder schubweise nicht zielgerichtete Freisetzung von Mastzellmediatoren, auch Histamin, zur Folge. Die Mastozytosen werden mit einer Krankheitshäufigkeit von 1 zu 300.000 beschrieben und zählen damit zu den seltenen Erkrankungen.
Am häufigsten sind die kutanen Mastozytosen (Urticaria pigmentosa), die im Kindesalter auftreten und auch spontan ausheilen können. Hierbei treten in der Regel schubförmig typische Hautveränderungen mit erhabenen rötlichen, oft zusammenlaufenden Flecken, Juckreiz und Quaddelbildung auf.
Daneben gibt es auch die systemische Mastozytose, bei denen sich in Gewebe- und Organzellen, wie Leber und Milz, Mastzellen vermehren und es dadurch zu einem Anstieg von Histamin und anderen Mediatoren kommt. Es gibt noch zahlreiche Unter- und Sonderformen, auf die wir hier aber nicht näher eingehen können.
Die Symptome der systemischen Mastozytose sind sehr vielfältig und können auch in ihrem Erscheinungsbild und ihrer Ausprägung stark variieren, was diese Erkrankung so schwer abgrenzen lässt:
• Quaddelbildung auf der Haut
• starke Allergien mit Anaphylaxie, typischerweise auch Wespenallergie
• Magen- und Darmbeschwerden
• Knochen- und Muskelschmerzen
• Erschöpfung und Abgeschlagenheit
Im Jahr 2000 hat die WHO die Mastozytosen in den ICD-10 Katalog, die internationale statistische Klassifikation von Krankheiten und dazugehörigen Beschwerden, (Englisch: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) aufgenommen und somit als Krankheit offiziell anerkannt. Zur Sicherung der Diagnose sind Gentests und Biopsien von Organen sowie vom Knochenmark erforderlich. Diese werden von spezialisierten Zentren, wie zum Beispiel an der Universität Leipzig oder an der Charité in Berlin, vorgenommen. Die WHO-Kriterien für die systemische Mastozytose werden in Haupt- und Nebenkriterien eingeteilt. Für die Diagnose einer systemischen Mastozytose müssen entweder das Hauptkriterium und mindestens ein Nebenkriterium oder mindestens drei der Nebenkriterien erfüllt sein.
Hauptkriterium:
• der Nachweis von multifokalen, dichten Mastzelleninfiltraten durch eine Knochenmarkbiopsie oder durch Biopsien aus anderen Organen außer der Haut
Nebenkriterien:
• ein Anteil atypischer Mastzellen von mehr als 25 Prozent der Mastzellen im Knochenmarkausstrich oder in anderen Organen
• eine c-Kit-D816 Punktmutation in Mastzellen aus dem Knochenmark oder anderen Organen als der Haut
• eine Exprimierung der Antigene CD2 oder CD25 durch Mastzellen aus dem Knochenmark oder anderen Organen als der Haut
• ein dauerhaft erhöhter Spiegel der Serum-Tryptase von mehr als 20 ng/ml im Blutserum
Systemische Mastozytosen gelten derzeit als noch nicht heilbar, aber gut behandelbar.
Das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)
Im Gegensatz zur Mastozytose finden wir beim Mastzellaktivierungssyndrom (engl. Mast Cell Activation Syndrome) in der Regel keine Veränderung der Mastzellen selbst, sondern hochsensible, hyperreagible Mastzellen. Auf viele alltägliche Reize wie Wärme, Kälte, Stress kann es zu einer nicht zielgerichteten, chaotischen Freisetzung von Histamin und anderen Mediatoren aus diesen Mastzellen kommen.
Die Symptome der MCAS (sprich: Em-Kas) sind sehr vielfältig und können den gesamten Organismus betreffen. Manchmal treten sie aber auch nur in bestimmten Organen auf, etwa im zentralen Nervensystem (ZNS). Zudem sind die Symptome stark schwankend in ihrer Intensität und ihrem zeitlichen Auftreten. So kann es sein, dass Betroffenen monatelang symptomfrei sind und plötzlich anfallsartig eine Vielzahl von Symptomen haben, die scheinbar ohne Zusammenhang auftreten und denen der systemischen Mastozytose sehr ähneln:
• Blutdruckabfall
• Herzrasen
• Schwindel
• Synkopen (Kollaps)
• Hauterscheinungen (Urtikaria)
• Atemnot
• starke Erschöpfung
• unspezifische Schmerzen
• Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe
• Angst- und Panikattacken
 DOMS
DOMS
Wir alle kennen Muskelkater. Oft tritt er am selben oder spätestens am Tag nach der Sporteinheit auf. MCAS-Patienten hingegen haben oft einen verzögerten Schmerz nach Belastungen, der bis zu drei Tagen später auftreten kann und als DOM (Delayed Onset Muscle Soreness) bekannt ist. Wissenschaftler vermuten, dass eine Entzündungskaskade von zu viel Histamin und anderen Mediatoren in der Muskulatur zu diesem Phänomen führt.
Wir haben in unserer Praxis schon viele Fälle behandelt und sind davon überzeugt, dass MCAS eine sehr häufige Erkrankung ist, die einfach nur sehr selten diagnostiziert wird.
Die meisten Ärzte und Heilpraktiker kennen MCAS nicht. Das ist ein Drama für die Betroffenen, die sich oftmals alleine mit ihrer Erkrankung durchschlagen müssen und statt einer vernünftigen Diagnostik und Therapie einige dieser Diagnosen erhalten:
• Endogene Depression
• Allergie
• Generalisierte Angststörung
• Somatisierungsstörung
• Erschöpfungssyndrom
• Erschöpfungsdepression
• Ein- und Durchschlafstörung
• Zwangsstörung
• Panikstörung
• Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom
• Fibromyalgie
• Interstitielle Zystitis
• Reizdarm-Syndrom
Professor Dr. Gerhard J. Molderings von der Universität Bonn ist einer der weltweit führenden Forscher für Mastzellenerkrankungen. Im Jahr 2014 hat er einen umfassenden Diagnose-Fragekatalog für die systemische MCAS vorgestellt, der Ärzten die Einschätzung von Symptomen erleichtern und unnötige aufwändige Untersuchungen vermeiden soll.
Der Fragebogen kann hier heruntergeladen werden:
www.humangenetics.uni-bonn.de/de/forschung/forschungsprojekte/mastzellerkrankungen/checklistepatientenversion
Wenn sich anhand des Fragebogens die Verdachtsdiagnose erhärtet, muss diese anhand weiterer Untersuchungen gesichert werden. Die Kriterien, die die Diagnose MCAS festigen, sind von Professor Dr. Molderings und Kollegen zusammengestellt worden und lauten wie folgt:
Hauptkriterien:
• Vermehrung der Mastzellen an verschiedenen Stellen im Körper. Der Nachweis erfolgt durch eine Knochenmarkbiopsie und bzw. oder durch Biopsien aus anderen Organen mit Ausnahme der Haut.
• Typische Beschwerden, die eindeutig als Folge einer Mastzellüberaktivität einzuordnen sind.
Nebenkriterien:
• Nachweis einer pathologisch vermehrten Freisetzung von Mastzellmediatoren durch Bestimmung der Konzentration von Tryptase im Blut (entweder absolute Erhöhung über den assayspezifischen Referenzwert oder Anstieg von > 20 % + 2 ng/ml innerhalb von 4 Stunden gegenüber einem Ausgangswert vor Beginn der akuten Erkrankungsverschlimmerung), Heparin im Blut, N-Methyl-Histamin im Sammelurin oder von anderen relativ mastzellspezifischen Mediatoren (Leukotriene, Prostaglandin).
• Nachweis von genetischen Veränderungen in Mastzellen aus dem Blut, Knochenmark oder aus einem anderen Organ (außer der Haut), für die eine Auswirkung auf den Aktivitätszustand der betroffenen Mastzelle im Sinne einer gesteigerten Aktivität belegt ist.
• Besserung oder Verschwinden von Beschwerden unter einer spezifisch gegen Mastzellmediatoren gerichteten Therapie, zum Beispiel mit Antihistaminika oder Mastzellstabilisatoren.
Читать дальше
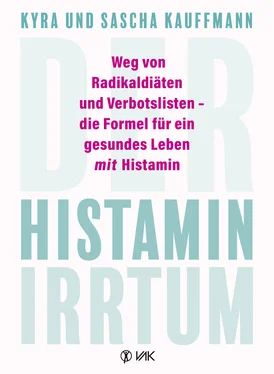
 DOMS
DOMS