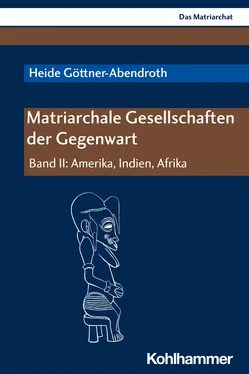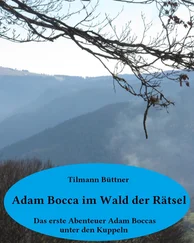Noch einmal danke ich meiner damaligen Übersetzerin Karen Smith, die vom Deutschen ins Englische übersetzte und mich als Kennerin der Gesichtspunkte von indigenen Menschen als Erste beriet; es kam der englischen Version sehr zugute. Besonders wertvoll waren dann die Vorträge und Werke der indigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus matriarchalen Kulturen selbst, die während der drei »Weltkongresse für Matriarchatsforschung« (2003, 2005, 2011) zu hören waren. Was sie mich durch ihre Vorträge, Bücher und auch durch persönliche Informationen wissen ließen, ist, wie schon in den ersten Band, auch in dieses Buch eingeflossen. Dafür danke ich ausdrücklich: Usria Dhavida (Minangkabau, Sumatra, Indonesien), Wilhelmina J. Donkoh (Asante, Ghana, Westafrika), Fatimata Oualet Halatine (Targia/Tuareg, Zentral-Sahara), Hengde Danschilacuo (Mosuo, Südwest-China), Lamu Gatusa (Mosuo, Südwest-China), Makilam (Kabylin, Algerien, Nordafrika), Barbara Alice Mann (Seneca-Irokesin, Ohio, USA), Marina Meneses (Juchiteca, Mexiko), Patricia Mukhim (Khasi, Meghalaya, Nordindien), Bernedette Muthien (Khoe San, Südafrika), Gad Asyako Osafo (Akan, Ghana, Westafrika), Valentina Pakyntein (Khasi-Pnar, Meghalaya, Nordindien), Taimalie Kiwi Tamasese (Samoa, Polynesien), Savithri Shanker de Tourreil (Nayar, Südindien).
Ebenso danke ich den nicht-indigenen Wissenschaftlerinnen, die matriarchale Völker besuchten und dort wertvolle Forschungen unternahmen. Auch ihnen begegnete ich während der Weltkongresse und wiederholt danach und verdanke ihrem Wissen viel: Veronika Bennholdt-Thomsen (Deutschland), Susan Gail Carter (USA), Hélène Claudot-Hawad (Frankreich), Shanshan Du (China), Carolyn Heath (Großbritannien), Antje Olowaili (Deutschland), Peggy Reeves Sanday (USA), Ruxian Yan (China).
Besonders danke ich Christina Schlatter für ihre jahrzehntelange, unermüdliche Unterstützung beim Recherchieren von oft schwer zugänglicher, wissenschaftlicher Literatur und beim Ergänzen von Daten zum Zitieren. Sie ist die Gründerin des »MatriArchivs« in der Kantonsbibliothek St. Gallen (Schweiz) und hat dort mein Gesamtwerk gesammelt.
Sehr herzlich danke ich den Spenderinnen und Spendern in den »Fonds für Matriarchatsforschung«, der vom Förderverein der Akademie HAGIA e.V. verwaltet wird. Alle ihre Beiträge stellen eine große Hilfe für mich als unabhängige, »freie« Wissenschaftlerin dar, damit die umfangreiche Forschung zum Thema Matriarchat von mir geleistet und publiziert werden konnte und weiterhin kann.
Einleitung zu diesem Buch
Das vorliegende Buch: Matriarchale Gesellschaften der Gegenwart. Band II: Amerika, Indien, Afrika, setzt das matriarchale Paradigma und damit die Matriarchatstheorie fort. In der philosophischen und methodologischen Einleitung von Band I, die auch für diesen zweiten Band gilt, habe ich die Schritte des matriarchalen Paradigmas genannt, die mit diesen beiden Bänden verwirklicht werden. Denn die ethnologischen Analysen, in denen konkrete, heute noch lebendige matriarchale Gesellschaften vorgestellt werden, sind der systematische Ort, um aus ihrer Fülle die vollständige strukturelle Definition von »Matriarchat« zu entwickeln. Diese fehlt sonst überall in der traditionellen Matriarchatsforschung, was Tür und Tor für Vorurteile geöffnet hat, und genau darin unterscheidet sich die moderne Matriarchatsforschung von der älteren. Diese Definition ist das Ergebnis meiner Forschung zu den lebenden matriarchalen Gesellschaften und wurde ihr nicht vorausgesetzt. Denn die Definition wird induktiv und sukzessive aus meinen Analysen gewonnen, ein Vorgang, der für jede Leserin und jeden Leser nachvollziehbar ist. Das wurde bereits in Band I hinsichtlich der Völker in Ostasien, Indonesien und dem Pazifischen Raum begonnen und wird in diesem Band II für die Kontinente Amerika, Afrika und den indischen Subkontinent fortgesetzt. Durch die Zusammenfassungen eines jeden Kapitels werden nicht nur die Grundprinzipien matriarchaler Gesellschaften sichtbar gemacht, sondern auch der Reichtum an Lebensweisen, den sie umfassen.
Ebenso führe ich die Hypothesen über Wanderungen und Ausbreitung von matriarchalen Gesellschaften in diesen Weltgegenden fort, um weiträumige kulturelle Zusammenhänge sichtbar zu machen, die es einst gegeben hat. Das verhindert, dass die dargestellten einzelnen Gesellschaften als isolierte Inseln wahrgenommen werden, wie es in der heutigen Ethnologie meist üblich ist. Das macht es nötig, auch die kulturgeschichtliche Perspektive einfließen zu lassen, doch ich bin mir dessen bewusst, dass sie hier noch rudimentär bleibt. Es ist der Weiterentwicklung meines Werkes vorbehalten, sie auszuführen und aus den entsprechenden wissenschaftlichen Fachgebieten gründlich zu belegen.
Außerdem möchte ich noch einmal daran erinnern, wenn ich von »Gegenwart« spreche, dass darunter nicht nur das unmittelbare Hier und Heute verstanden wird, sondern der Zeitraum der ethnologischen Berichterstattung über solche Gesellschaften, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Obwohl alle diese Berichte von patriarchal geprägten Wissenschaftlern westlicher oder östlicher Herkunft ideologische Verzerrungen aufweisen, sind sie doch Augenzeugenberichte. Das meine ich mit »gegenwärtig«, denn mit Augenzeugenberichten begann die Phase der empirischen Ethnologie.
Der thematische Schwerpunkt in Band I lag auf der Analyse der inneren Strukturen matriarchaler Gesellschaften, den Mikrostrukturen, das heißt, den Regeln und Bräuchen, welche die Sozialordnung und die Gemeinschaften konstituieren, ebenso ihre Ökonomie, Politik und Religion. Die Ergebnisse fasse ich hier nochmals stichwortartig zusammen.
Die ökonomischen Muster matriarchaler Gesellschaften sind: Subsistenzwirtschaft, die meistens, aber nicht immer auf Garten- und Ackerbau beruht; Land und Häuser sind Eigentum des Clans, Privatbesitz ist unbekannt; die Frauen sind die Hüterinnen der wesentlichen Lebensgüter: Felder, Häuser, Nahrungsmittel, und verteilen sie gerecht (Verteilungsmacht statt Besitz). Durch lebhaften Kreislauf der Güter bei Festen in der Gemeinschaft wird ein ständiger Ausgleich bezüglich des Reichtums hergestellt. Ich nenne sie deshalb auf der ökonomischen Ebene Ausgleichsgesellschaften .
Die sozialen Muster matriarchaler Gesellschaften sind: Bildung von Clans, die durch Matrilinearität (Mutterlinie) und Matrilokalität (Wohnsitz bei der Mutter) zusammengehalten werden; Wechselheirat zwischen je zwei Sippen mit »Besuchsehe« aufseiten der Gatten oder anderen offenen Eheformen; sexuelle Freiheit für beide Geschlechter; »soziale Vaterschaft« des Mannes, die sich auf seine Schwesterkinder bezieht, denn biologische Vaterschaft ist unbekannt oder unbedeutend; das Heiratssystem dient der verwandtschaftlichen Vernetzung der ganzen Gesellschaft. Ich nenne sie deshalb auf der sozialen Ebene nicht-hierarchische, horizontale Verwandtschaftsgesellschaften .
Sehr wichtig ist dabei, die große Bedeutung der Matrilinearität als Grundregel zur Bildung dieser Verwandtschaftsgesellschaften zu erkennen. Sie ist deshalb weitaus mehr als die meist zitierte »Benennung von Verwandtschaft und Vererbung in der Mutterlinie«, denn sie ist das gesellschaftsformende Prinzip. Wenn die Verteilungsmacht der Frauen über die Lebensgüter hinzukommt, also ihre starke Stellung in der Ökonomie, handelt es sich nicht mehr um »nur matrilineare« Gesellschaften, sondern um matriarchale. Diese Unterscheidung zwischen matrilinearen und matriarchalen Gesellschaften wird in der Ethnologie nicht gemacht, was der Anlass für viel Verwirrung ist.
Die politischen Muster matriarchaler Gesellschaften sind: Entscheidungsfindung nach dem Konsensprinzip auf allen Ebenen: im Rat des Clanhauses, im Rat des Dorfes oder der Stadt (lokal), im Rat des ganzen Volkes (regional); Männer als Delegierte der Clans für die umfassenderen Ratsversammlungen; sie sind jedoch nur Kommunikations- und keine Entscheidungsträger; Abwesenheit von Herrschaftsmustern und Klassen. Ich nenne sie deshalb auf der politischen Ebene egalitäre Konsens-Gesellschaften.
Читать дальше