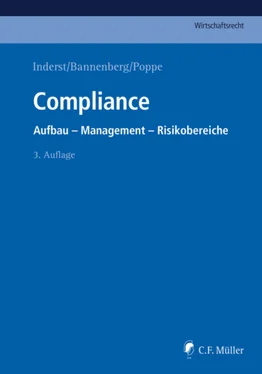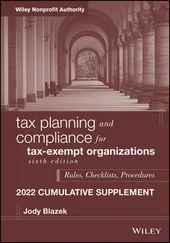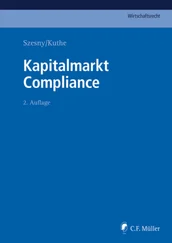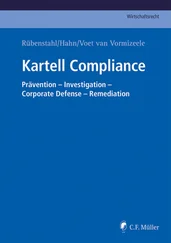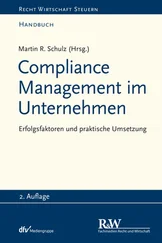V.Compliance-Programm als dynamisches Strategieelement
1. Risiko „Restrisiko“
2. Notfallstrategie
3. Optimierbarkeit von Compliance-Systemen
B.Die Prüfung von Compliance Management-Systemen nach IDW PS 980
I. Einleitung
II. Was – der Prüfungsgegenstand
III. Wer – potenzielle Prüfer
IV. Wie – Ziel und Vorgehen bei der Prüfung
1. Konzeptionsprüfung
2. Angemessenheitsprüfung
3. Wirksamkeitsprüfung
4. Grenzen der Wirksamkeitsprüfung
V. Warum – Gründe für eine Prüfung
VI. Rechtliche Bedeutung des IDW PS 980 für das Haftungsrecht
VII.Prüfbereitschaft
1. Die CMS-Beschreibung als Prüfungsgrundlage
2. Herstellen der operativen Prüfbereitschaft
3. Festlegung des Prüfungsumfangs
VIII.Die Prüfung der Grundelemente eines CMS
1.Compliance-Kultur
1.1 Definition
1.2 Prüfung
2.Compliance-Risiken
2.1 Definition
2.2 Prüfung
3.Compliance-Ziele
3.1 Definition
3.2 Prüfung
4.Compliance-Programm
4.1 Definition
4.2 Prüfung
5.Compliance-Organisation
5.1 Definition
5.2 Prüfung
6.Compliance-Kommunikation
6.1 Definition
6.2 Prüfung
7.Compliance-Überwachung und Verbesserung
7.1 Definition
7.2 Prüfung
C.Corporate Responsibility als Schlüssel für Compliance
I. Einführung
II. Schnelle Veränderung und Unsicherheit erzeugen Handlungsbedarf
III. Management als Vorbild
IV. Dezentralität bereitet die strukturelle Grundlage für Vertrauen
1. Fokussierung
2. Marktnähe
3. Motivation
4. Transparenz und Ergebnisverantwortung
5. Anpassungskraft
V. Corporate Responsibility (CR) und Compliance können zusammen zusätzliche Werte schaffen
VI. Handlungsansätze aus der Unternehmenspraxis
1. Initiative „Responsible Care“
2. „Business in the Community“ – Initiative der Wirtschaft in Großbritannien
3. Schulprogramme von GE und IBM
4. Gemeinsam Korruption bekämpfen
D.Risikomanagement im Kontext Compliance – Grundlagen, Prozesse, Verantwortlichkeiten und Methoden
I. Einführung
II. Die Entstehung des modernen Risikobegriffs
III. Risiko ist ein Konstrukt unserer Wahrnehmungen
IV. Grundlagen des Risikomanagements
1. Definition und Abgrenzung des Risikobegriffs
2. Die Risikolandkarte im Unternehmen
3. Drei Verteidigungslinien in der Praxis
4. Der Risikomanagement-Prozess in der Praxis
4.1 Strategisches Risikomanagement
4.2 Risikoidentifikation
4.3 Risikobewertung
4.4 Risikosteuerung
V.Standards im Risikomanagement
1. Überblick
2. Der Risiko-Management-Prozess als PDCA-Zyklus basierend auf der ISO 31000
3. COSO ERM
VI. Regulatorische und gesetzliche Grundlagen
VII. Fazit und Ausblick
4. Kapitel Risikobereiche
A. Kartellrecht
I. Einleitung
II. Pflicht zur Gesetzestreue und zur Durchführung von kartellrechtlichen Compliance-Maßnahmen
III. Kartellrechtlicher Sanktionskanon und Compliance
IV.Grundlagen des Kartellrechts
1. Überblick über das europäische und deutsche Kartellverbot
2. Die Freistellung vom Kartellverbot
3. Missbrauchsaufsicht
4. Fusionskontrolle
V. Legal Management und Legal Judgement im Kartellrecht
1. Einführung eines Kartellrechts-Compliance-Programms
1.1 Kartellrechtliche Risikoanalyse
1.2 Implementierung geeigneter Compliance-Maßnahmen
1.2.1 Compliance-Organisation
1.2.2 Kartellrechtliche Compliance-Schulungen
1.2.3 Beratung
1.2.4 Compliance-Regelwerk
1.2.5 Kontrollmaßnahmen
2. Maßnahmen bei Identifizierung kartellrechtsrelevanter Vorgänge
2.1 Absehen von Maßnahmen infolge einer rechtlichen Prüfung
2.2 Abhilfemaßnahmen
2.3 Klärung der Rechtslage mit Kartellbehörden
2.4 Kronzeugenantrag
2.5 Disziplinarische Maßnahmen gegen Verstoßverantwortliche
VI. Ausblick
B.„Dawn Raids“ – Verhaltensregeln in kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren
I. Einführung
II. Befugnisse und Grenzen in kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren
III. „Dawn Raids Legal Risk Management“
IV. Verhaltensregeln bei Nachprüfung und Durchsuchung
1. Ankunft der Ermittler
2. Durchführung der Untersuchung
2.1 Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen
2.2 Mündliche Erklärungen
2.3 Checkliste: Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen im Bußgeldverfahren
3. Abschluss
4. Nach Beendigung der Untersuchung
V. Muster
C.Korruption
I. Einführung
II. Compliance-Anforderungen – Abgrenzung von legaler Kundenpflege und Korruption
1. Umgang mit Amtsträgern im Inland
2. Umgang mit Amtsträgern im Ausland
3. Umgang mit privaten Geschäftspartnern im In- und Ausland
4. Sonderbereich Gesundheitswesen
5. Sonderbereich Organisierter Sport
D.Geldwäsche
I. Einleitung
1.Begriffsbestimmungen
1.1 Geldwäsche
1.2 Terrorismusfinanzierung
2.Internationale Vorgaben
2.1 Financial Action Task Force on Money Laundering
2.2 Europäische Union
3.Nationale Vorschriften
3.1 Gesetze
3.2 Rundschreiben der BaFin
3.3 Auslegungs- und Anwendungshinweise
II. Pflichten für Institute und Versicherungsunternehmen
1. Risikomanagement
1.1. Risikoanalyse
1.2 Interne Sicherungsmaßnahmen
1.2.1 Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
1.2.2 Geldwäschebeauftragter
1.2.3 Gruppenweite Umsetzung
1.2.4 Neue Produkte und Technologien
1.2.5 Zuverlässigkeitsprüfung
1.2.6 Schulung
1.2.7 Überprüfung durch die Interne Revision
2. Besondere Vorgaben für Kreditinstitute
3.Kundensorgfaltspflichten
3.1 Allgemeine Sorgfaltspflichten
3.2 Vereinfachte Sorgfaltspflichten
3.3 Verstärkte Sorgfaltspflichten
3.4 Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte
3.5 Auslagerung
4. Verdachtsmeldewesen
5. Geldbußen und persönliche Haftbarkeit
III. Vorgaben für weitere Verpflichtete
1. Interne Sicherungsmaßnahmen
2. Kundensorgfaltspflichten
3. Besondere Anforderungen an einzelne Verpflichtete
3.1 Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
3.2 Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
3.3 Güterhändler
E.Arbeitsrecht
I. Einführung
II.Inhalte und Grenzen eines Verhaltenskodex bzw. eines Compliance Management Systems
1. Inhalte
2. Grenzen
2.1 Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit Art. 1 Abs. 1 GG
2.2 Betriebliche Mitbestimmung, § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
3. Einhaltung von Compliance-Regeln
3.1 Überwachung der E-Mail- und Internetnutzung
3.1.1 Kontrolle dienstlicher E-Mail- und Internetnutzung
3.1.2 Kontrolle gestatteter privater E-Mail- und Internetnutzung
3.1.3 Gesetzeskonforme E-Mail-Kontrolle
3.1.4 Kollektivrechtliche Regelungen
3.2 Telefonüberwachung
3.2.1 Telefonüberwachung nur bei dienstlich gestatteter Nutzung
3.2.2 Telefonüberwachung bei gestatteter Privatnutzung
3.2.3 Kollektivrechtliche Regelungen
3.3 Systematischer Datenabgleich („Screening“)
3.4 Repressive Maßnahmen
III. Implementierung eines Verhaltenskodex
1. Direktionsrecht
2. Arbeitsvertrag
3. Betriebsvereinbarung/Dienstvereinbarung/Regelungsabrede/Tarifvertrag
IV.Arbeitsrechtliche Stellung des Compliance Officers
1. Position des Compliance Officers
2. Kündigungsschutz des Compliance Officers
3. Haftung des Compliance Officers
3.1 Arbeitsrechtliche Haftungsgrundsätze
3.2 Strafrechtliche Haftung
Читать дальше