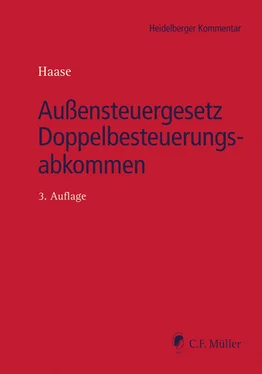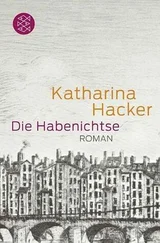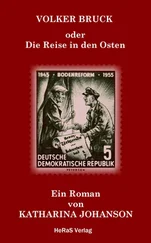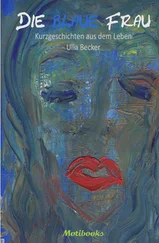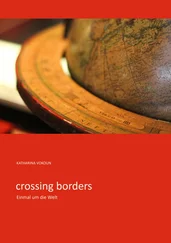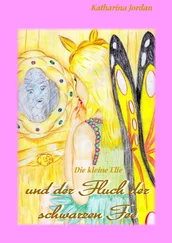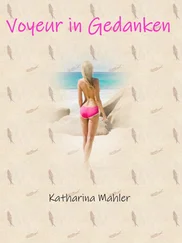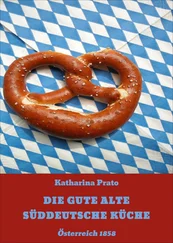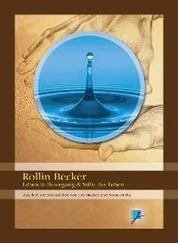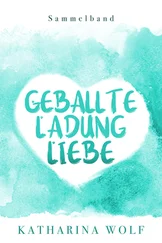36
Wie das Spannungsfeld zwischen AStG und Gemeinschaftsrecht vor dem Hintergrund der jüngeren EuGH-Rspr (insb Rs Cadbury Schweppes[44] und Rs Columbus Container Services[45]) aufzulösen ist, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Dies gilt insb im Hinblick auf die Problematik der Steuerverlagerung und von rechtsmissbräuchlichen Gestaltungen. Nach der inzwischen gefestigten Rspr des EuGH begründet die Abwehr von Steuerumgehungeneinen anerkannten Rechtfertigungsgrund[46] für die Beeinträchtigung der Europäischen Grundfreiheiten.
37
Jedoch ist zu beachten, dass an den Tatbestand der Steuerumgehung seitens des Gerichtshofs hohe Anforderungen gestellt werden. Die Ausübung einer Grundfreiheit (Beispiel: Gründung einer TochterGes in einem anderen Mitgliedsstaat: Niederlassungsfreiheit, Art 49 und 54 EAUV) führt noch nicht für sich genommen zu der Annahme einer Steuerumgehung. Es gilt der an sich selbstverständliche Grundsatz, dass aufgrund der bloßen Ausübung einer Grundfreiheit kein Missbrauch derselben vorliegen kann, zumal sich der StPfl nach der grenzüberschreitenden Betätigung regelmäßig dem Steuerregime eines anderen Mitgliedsstaates unterworfen sieht. Insb führt insoweit auch allein die Tatsache, dass der StPfl in einem anderen Mitgliedsstaat ggf einen niedrig(er)en Steuersatz zu zahlen hat, nicht zur Annahme eine Steuerumgehung, mag der StPfl auch subjektiv die Steuerersparnis anstreben.[47]
38
Der Rechtfertigungsgrundder Abwehr von Steuerumgehungen weist noch Unschärfen auf, die der weiteren Präzisierung durch die Rspr bedürfen. So existiert bereits kein allg anerkannter Begriff der „Steuerumgehung“. Der EuGH versteht darunter – generalklauselartig – in einem sehr weiten Verständnis „künstlich geschaffene, der Umgehung des Steuerrechts dienende Sachverhalte“[48] und misst hieran den zu beurteilenden Einzelfall. Auf den Einzelfall stellt der Gerichtshof auch bei der allg Verhältnismäßigkeitsprüfungab. So hat er bislang in vielen Fällen die Rechtfertigung über den Rechtfertigungsgrund der Abwehr von Steuerumgehungen daran scheitern lassen, dass es sich bei den in Rede stehenden Missbrauchsvermeidungsvorschriften um typisierte Regelungen handelte.[49]
39
Wichtig ist daher für die Beratungspraxisdie Erkenntnis, dass allg Missbrauchsvermeidungsvorschriften, die nicht auf den konkreten Einzelfall rekurrieren und nicht den Missbrauch im konkreten Fall erfassen wollen, vom EuGH nicht als für eine Rechtfertigung für die Beeinträchtigung der Europäischen Grundfreiheiten hinreichend angesehen werden.[50] Eine genauere Ausformung eines originär europäischen Missbrauchsbegriffsdurch den EuGH steht insoweit noch aus und dürfte den EuGH angesichts seiner eigenen Rspr an anderer Stelle noch vor dogmatische Probleme stellen:[51]
40
Da die Steuerrechte der Mitgliedsstaaten sich als gleichrangige Regelungswerke gegenüber stehen, obliegen sie weiterhin der Regelungshoheit der Mitgliedsstaaten und bleiben mangels einer umfassenden Ermächtigungsgrundlagezur Harmonisierung unterschiedlich ausgestaltet und damit unvereinheitlicht, sofern der EG-Vertrag nichts anderes bestimmt. Eine häufig wiederholte Formulierung des EuGH lautet dementsprechend, dass „zwar der Bereich der direkten Steuern als solcher beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt, die Mitgliedsstaaten die ihnen verbleibenden Befugnisse jedoch unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts ausüben müssen.“[52] Es wird abzuwarten bleiben, wie der EuGH das Spannungsfeld zwischen hinzunehmenden, aus der mangelnden Harmonisierung resultierenden Friktionen und dem berechtigten Interesse der Mitgliedsstaaten nach einer Sicherung der Besteuerungsgrundlagen austarieren wird. Auch wenn in Kreisen der FinVerw jüngst häufiger kolportiert wird, der EuGH neige inzwischen vermehrt einer profiskalischen Haltung zu und nehme auf die Haushaltslage der EU-Mitgliedsstaaten zunehmend Rücksicht, so lässt sich dieser Befund mE aus der bisher vorliegenden Rspr gleichwohl nicht ableiten.
41
Die Wirksamkeit der Steueraufsichthat der EuGH ebenfalls in mehreren Entsch als Rechtfertigungsgrund für eine Beeinträchtigung von Grundfreiheiten anerkannt.[53] Wie bei der Abwehr von Steuerumgehungen sind die Konturen des Begriffs der „Steueraufsicht“ unscharf. Aus der Rspr des EuGH lässt sich jedoch ableiten, dass der Gerichtshof hierzu sämtliche Maßnahmen zählt, die im Zuständigkeitsbereich der Finanzbehörden liegen und die dazu dienen, den durch das materielle Steuerrecht begründeten Besteuerungsanspruch sicherzustellen.
42
Insoweit sind bislang zB die Verpflichtung zur Buchführung und zur Erfüllung von Aufzeichnungspflichten,[54] bes Nachweispflichten,[55] das Verfahren der Besteuerung an der Quelle[56] und auch die Verhinderung von Steuerhinterziehungen[57] als Maßnahmen der Steueraufsicht angesehen worden. Auch im Anwendungsbereich des Rechtfertigungsgrunds der Wirksamkeit der Steueraufsicht wendet der EuGH eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung an. So hat er bislang häufig das Eingreifen des Rechtfertigungsgrundes verneint, wenn das mit einer nationalen (steuerlichen) Norm verfolgte Ziel mit weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden konnte. Was die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen anbelangt, hat der Gerichtshof ein milderes Mittel vielfach in der Nutzung der EG-Amtshilfe-Richtlinie(dazu Art 26 MA Rn 6) gesehen,[58] ohne indes weiter auf den zugrunde liegenden Einzelfall einzugehen.[59]
43
Für die Beratungspraxiswird man mE für die Mehrheit der täglichen Steuerfälle sagen müssen, dass eine Beratung auf Basis der potenziellen Gemeinschaftsrechtswidrigkeit bestimmter Normen des AStG weder ratsam ist, noch von den Mandanten akzeptiert wird. Dies gilt insb für den Bereich der Gestaltungsberatung, wenn und soweit – wie zumeist – der EuGH nicht bereits explizit diejenige nationale Norm, auf die es bei der Beratung entscheidend ankommt, für mit dem Europarecht unvereinbar erklärt hat. Schon aus Haftungsgründen wird man dem Mandanten offenbaren müssen, dass allein das Vorliegen eines „vergleichbaren Falles“ noch nicht zwingend ein Einsehen des FA nach sich zieht. Selbst bei materiell eindeutiger Rechtslage nämlich wird der Mandant nicht ohne einen Rechtsstreit auskommen, weil die FinVerw – jedenfalls bislang – nicht in „vorauseilendem Gehorsam“ die nationalen Vorschriften an gemeinschaftsrechtliche Vorgaben anpasst und erfahrungsgemäß auch selten bereit ist, eine bereits ergangene EuGH-Entsch auf „vergleichbare Fälle“ zu übertragen. Dieser zuweilen anzutreffende Unwille zur Transferleistung – mag er auch profiskalischen Interessen geschuldet und daher ehrenhaft sein – erfordert häufig einen langen (auch finanziellen) Atem des Mandanten und führt iE dazu, dass eine Argumentation auf der Ebene des EU-Rechts meist allenfalls iRd Abwehrberatung zielführend sein kann.
III. Jüngste Entwicklungen
44
Bzgl der Verrechnungspreise steht nach wie vor § 1 AStGin Bezug auf ausl Betriebsstätten inländischer Steuerpflichtiger im Fokus des Gesetzgebers (s Abs 5). Durch das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie v 26.6.2013 erfolgte entspr die Überführung der Regelungen der OECD zur Gewinnabgrenzung bei Betriebsstätten (OECD Betriebsstättenbericht 2010) in das dt Recht. Zur Konkretisierung dieser Regelung wurde auf Basis des § 1 Abs 6 AStGvom BMF die sog Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (kurz BsGaV) formuliert. Die BsGaV trat mit Wirkung v 18.10.2014 in Kraft und soll erstmals für Wirtschaftsjahre anwendbar sein, die nach dem 31.12.2014 beginnen. Die Auswirkungen auf die Praxis sind immens, aber immer noch nicht im Detail absehbar. Sowohl auf Seiten der Steuerpflichtigen, als auch auf Seiten der FinVerw fehlen bislang entsprechende Erfahrungen.
Читать дальше