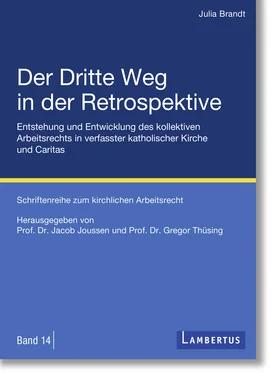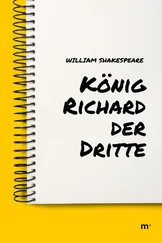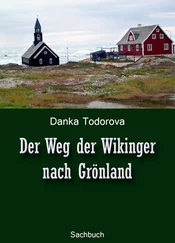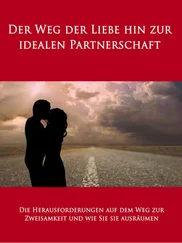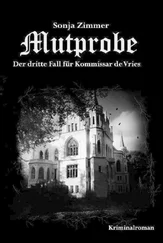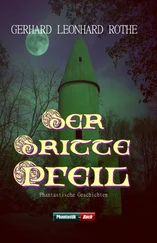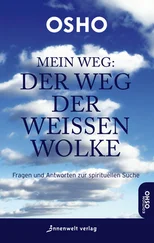Der Zentralverband blieb auch während der Herrschaft der Nationalsozialisten bestehen und es gelang, seine Gleichschaltung und sein Aufgehen in der Deutschen Arbeitsfront zu vermeiden. Durch einen Erlass der deutschen Bischöfe wurde er 1934 zum „Reichsverband der deutschen katholischen Kirchenangestellten“ erweitert, ihm sollten alle kirchlichen Laienangestellten beitreten. Dazu zählten: Küster, Organisten, Küster-Organisten, Chorleiter, hauptamtliche Rendanten und sonstige an den Kirchen hauptamtlich tätige männliche Personen, ferner Laienangestellte bei den Bischöflichen Ordinariaten, den Gesamt- und Gemeindeverbänden und den kirchlichen Instituten sowie die hauptamtlich im Kirchendienst tätigen Musiker. Für die Anstellung im Kirchendienst sollte ab dem 1. Januar 1937 die Mitgliedschaft im Reichsverband Voraussetzung sein, sie war Gegenstand des Arbeitsvertrages. 252In Zusammenarbeit mit dem Reichsverband erarbeiteten einige Diözesen Rechtsgrundlagen für Anstellung und Altersversorgung, die zur Regelung der Dienstverhältnisse der Kirchenangestellten dienten. In der Zentrale des damaligen Reichsverbandes in Essen waren die Formblätter für die Verträge zu erwerben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte der Reichsverband seinen Namen in „Zentralverband katholischer Kirchenangestellter Deutschlands (ZKD)“ und blieb als Berufsverband aktiv. So nahm er insbesondere in Nordrhein-Westfalen Einfluss auf die Anfang der 1970er Jahre von den Bistümern Aachen, Köln, Münster, Paderborn und Essen beschlossene Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). 2531971 schlossen der Arbeitskreis der Diözesen in NRW (Vorgänger der Personalwesenkommission) und der ZKD einen Vertrag zur Bildung des „Arbeitskreises für berufliche und arbeitsrechtliche Belange der Kirchenangestellten“. 2541975 bildeten der ZKD und die Diözesen NRW eine „Ständige Kommission für berufliche und arbeitsrechtliche Belange der Kirchenangestellten“, welche in Fragen der KAVO und Fragen sonstiger vergütungs-, arbeits-, und sozialrechtlicher Art verhandelte. 255Bis heute besteht der Verband und ist am Dritten Weg im Bereich der Diözesen in Nordrhein-Westfalen durch das Entsendungsrecht von Mitgliedern unmittelbar am Verfahren der Regional-KODA beteiligt. 256
Kollektive arbeitsrechtliche Instrumente entstanden außerhalb der Kirche zu einer Zeit, als die Kirchen erst in geringem Umfang mittels privatrechtlicher Arbeitsverträge Mitarbeiter rekrutierten und einstellten. 257Bis auf den Angestelltenausschuss und den Betriebsrat beim Caritasverband sowie einzelne Versuche, Tarifverträge in der verfassten katholischen Kirche durchzusetzen, sind bei beiden Akteuren keine weiteren, insbesondere flächendeckenden Maßnahmen und Initiativen im Hinblick auf die Etablierung kollektiver arbeitsrechtlicher Elemente während der Zeit der Weimarer Republik bekannt. Trotz der Etablierung kollektiver arbeitsrechtlicher Instrumente im weltlichen Bereich blieb es in katholischer Kirche und Caritas bei der einseitigen Festsetzung der Arbeitsbedingungen durch den jeweiligen Arbeitgeber.
Sofern hier vereinzelte Mitbestimmungsmaßnahmen aufgezeigt werden konnten, so hat sich zur Zeit der Weimarer Republik, weder im weltlichen noch im kirchlichen Bereich, eine kollektive Regelungsfindung im Arbeitsrecht flächendeckend durchgesetzt. So schreibt Löhr Anfang der 1930er Jahre: „…es ist eben seit unvordenklicher Zeit Brauch, daß der Kirchenvorstand oder der Pfarrer diese Gebühren der Kirchendiener festsetzt. Das erkennt der Kirchendiener an und unterwirft sich dem, wenn er mit dem Kirchenvorstande den Anstellungsvertrag schließt“. 258Da die neu geschaffenen staatlichen Regelungen unstreitig auch auf die Kirchen und ihre Einrichtungen Anwendung finden sollten, wurden zu dieser Zeit auch keine eigenen Regelungen zum kollektiven Arbeitsrecht von Caritas und verfasster katholischer Kirche geschaffen, an denen man sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs hätte orientieren können. Auch das in der Weimarer Reichsverfassung verankerte Selbstbestimmungsrecht ist zu diesem Zeitpunkt nicht als Grundlage für die Entscheidung, welche Dienste es in kirchlichen und caritativen Einrichtungen in welcher Rechtsform geben soll, interpretiert worden. Erst viel später entwickelte sich dieses Argument. 259
168§ 147 PKV: [1] Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen. [2] Keine Religionsgesellschaft genießt vor andern Vorrechte durch den Staat; es besteht fernerhin keine Staatskirche. [3] Neue Religionsgesellschaften dürfen sich bilden; eine Anerkennung ihres Bekenntnisses durch den Staat bedarf es nicht.
169 Unruh in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art.137 WRV, Rn. 2.
170 Gusy , 100 Jahre Weimarer Verfassung, S. 24; zu den einzelnen Landesverfassungen Wittreck , Weimarer Landesverfassungen.
171Dazu näher Wittreck , Weimarer Landesverfassungen, Einl. S. 23 f.
172 Gusy , 100 Jahre Weimarer Verfassung, S. 24.
173 Arleth , Das Recht kirchlicher Arbeitnehmer auf Streik, S. 73; Heinig , Prekäre Ordnungen, S. 35 ff.
174 Hillgruber , KuR 2018, 4 m.w.N.
175Art. 137 Abs. 5 WRV; Hillgruber , KuR 2018, 4 mwN; Mikat , Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Bundesrepublik, S.3 f.
176 Hillgruber , Kur 2018, 4 m.w.N.
177 Jeand`Heur/Korioth , Grundzüge des Staatskirchenrechts, § 3, Rn. 30.
178 Jeand`Heur/Korioth , Grundzüge des Staatskirchenrechts, § 3, Rn. 30; Classen , Religionsrecht, § 2 Rn. 24 beide mit Verweis auf Stutz , bei Jeand`Heur/Korioth zitiert § 3 Rn. 31, Fn. 3.
179 Unruh in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art.137 WRV, Rn. 22 m.w.N.
180Dazu etwa: Arleth , das Recht kirchlicher Arbeitnehmer auf Streik, S. 101; von Campenhausen/deWall , Staatskirchenrecht, § 14, S. 99; Korioth , Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in Deutschland seit der Reformation, in: Heinig/Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 39 ff. (S. 48 ff.); Unruh in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 137 WRV, Rn. 22.
181 Unruh in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 137 WRV, Rn. 27.
182Zusammenfassend: Hesse , HdbStKirchR 1995, Bd. I, S. 538 m.w.N.; dazu auch Arleth , Das Recht kirchlicher Arbeitnehmer auf Streik, S. 86. Arleth geht hier, wie auch Wieland , DB 1987, 1633, 1636auf die Auffassungen von Anschütz und Ebers ein.
183 Hesse , HdbStKirchR 1995, Bd. I, S. 544; Unruh beschreibt das Verständnis des Schrankenvorbehalts in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 137 WRV, Rn. 39 ff.; eine weitergehende Skizzierung der Auslegungen zu den Merkmalen des Art. 137 Abs. 3 WRV soll hier nicht erfolgen. Dieser Überblick über die Neuordnungen des Staatskirchenrechts in Weimar soll genügen, um den Ursprung der heute für das kirchliche Arbeitsrecht relevanten staatskirchenrechtlichen Bestimmungen zu erkennen.
184 Düwell , RdA 2010, 129, 135.
185 Düwell , RdA 2010, 129, 130.
186Siehe B. III. 3. a).
187So kritisiert auch Schatz , Arbeitswelt Kirche, S. 25, 29, in ihrer Untersuchung über die Arbeitsbeziehungen im evangelischen Bereich, „ob die Masse [der Mitarbeiter] wirklich Gradmesser für die Relevanz der Fragestellung sein kann“ und betont, dass die Zeit der Weimarer Republik für das spätere Verständnis der Entstehung des Dritten Weges durchaus Relevanz haben könnte.
188So weist Hromadka zutreffend darauf hin, dass bereits „in der Besatzungszeit, erst recht dann in der Bundesrepublik, wieder da angeknüpft wurde, wo die Nazis 1933/34 die Entwicklung unterbrochen hatten.“ Zu Recht habe man „den Gedanken der sozialen Geborgenheit, der sich in Sozialpartnerschaft und Betriebsverfassung äußert, als entscheidenden deut-schen Beitrag zum Staatstyp der westlichen Demokratie bezeichnet“, Hromadka , AuA (Arbeit und Arbeitsrecht) 2019, 132.
Читать дальше