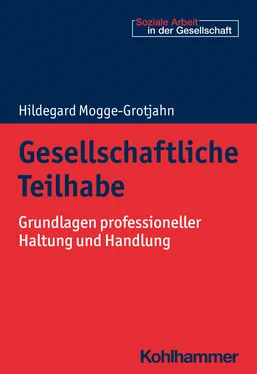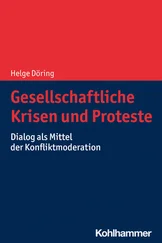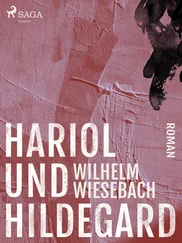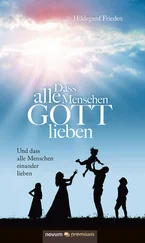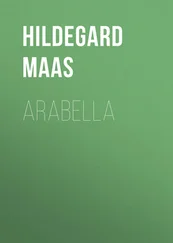Das markanteste Stichwort in diesem Zusammenhang ist die Rede vom »aktivierenden Sozialstaat«, der die Adressat_innen sozialstaatlicher und auch sozialarbeiterischer Leistungen »fördern und fordern« soll. Dieses Begriffspaar wurde 2005 mit der so genannten Hartz-IV-Gesetzgebung als Leitlinie sozialstaatlichen Handelns, zunächst vor allem mit Blick auf Erwerbslose, etabliert. Gemeint ist, dass die Unterstützung durch Transferleistungen daran geknüpft ist, dass die Einzelnen umfassende Mitwirkungspflichten erfüllen und ihre »Arbeitswilligkeit« unter Beweis stellen müssen (vgl. Böhmer 2013, S. 249ff). 3
Noch umfassender als das Verständnis von Teilhabe im rechtlichen und sozialstaatlichen Kontext ist die Definition von Teilhabe als einem Menschenrecht. Lob-Hüdepohl spricht in diesem Zusammenhang von der »Hochform moderner politischer Herrschaft« (Lob-Hüdepohl 2013, S. 89). In der bereits erwähnten Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wird der Gedanke von Teilhabe als einem Menschenrecht konkretisiert. Demnach ist der Staat verpflichtet, den Bürger_innen nicht nur das erwähnte Mindestmaß an materieller und immaterieller Teilhabe zu gewährleisten, sondern für die politischen Rahmenbedingungen zu sorgen, die es allen Menschen ermöglichen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten, Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu erhalten und sich an allen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen beteiligen zu können. »Teilhabe als Menschenrecht bedeutet, einen individuellen Anspruch darauf zu haben, aber nicht dazu verpflichtet zu sein, an allen Lebensbereichen teilzuhaben« (Wesselmann 2019, S. 98). – Um dieses Menschenrecht für alle Menschen verwirklichen zu können, müssen strukturelle Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen abgebaut werden.
»Partizipation« und »Teilhabe« weisen eine enge inhaltliche Verwandtschaft zum Thema »Inklusion« auf. Begriff und Verständnis von Inklusion (und ihrem Gegensatz, der Exklusion) wurden lange in zwei verschiedenen wissenschaftlichen und politischen Kontexten diskutiert, die erst in den letzten Jahren systematisch miteinander verknüpft wurden. Der eine Kontext ist geprägt von der Behindertenrechtsbewegung, durch die die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) vorangetrieben und politisch durchgesetzt wurde. Der Behinderungsdiskurs ist wiederum eingebettet in den größeren Zusammenhang der Diversity-Thematik 4 . Den anderen Kontext bilden die Armutsforschung und die politische Bekämpfung von Armut, im größeren Zusammenhang mit Fragen von Gesundheit, Bildung und Migration (zu beiden Diskursen und ihrem Zusammenhang vgl. Degener, Mogge-Grotjahn 2012).
In der UN-BRK wird Inklusion als Menschenrecht verstanden, das auf die Überwindung aller in Blick auf Behinderungen 5 diskriminierenden Sichtweisen und ausschließenden Strukturen zielt. Dabei geht es um den barrierefreien Zugang zu Ämtern und Behörden und Einrichtungen des Gesundheitswesens ebenso wie um das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen – sei es im Schul- und Bildungssystem, auf dem Arbeits- oder dem Wohnungsmarkt, im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport.
Im Kontext der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit geht es um die strukturellen Mechanismen, die bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen und sie von der Verfügung über materielle und immaterielle Ressourcen ausschließen oder ihnen zumindest den Zugang zu den allgemeinen Ressourcen erschweren.
Das Verbindende beider Stränge der Inklusionsbewegung ist das Ziel, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu gestalten, dass die sehr unterschiedlichen und vielfältigen Lebenslagen aller Menschen berücksichtigt und die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe geschaffen werden (vgl. Bleck, van Rießen, Deinet 2017, S. 92).
Inklusion ist deshalb eine zentrale Forderung zur Überwindung einer Vielzahl von sozialen Problemen. Diese sind dadurch verursacht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, und/oder Menschen, die in Armut leben, und/oder Menschen, deren Lebenslagen von Krankheit oder Erwerbslosigkeit oder Migration oder Flucht gekennzeichnet sind, strukturell benachteiligt werden. Deshalb geht es bei der Umsetzung von Inklusion darum, über die Möglichkeiten zur Teilhabe hinaus diese Strukturen zu überwinden und dafür zu sorgen, dass »möglichst alle Menschen in einer Gesellschaft das eigene Leben aktiv gestalten und ein ›gutes Leben‹ führen können« (Kuhlmann, Mogge-Grotjahn, Balz 2018, S. 12).
Soziale Zugehörigkeit wird in modernen Gesellschaften vor allem durch die Teilhabe an (Erwerbs-)Arbeit, durch verfügbares Einkommen, durch Bildung, durch verwandtschaftliche Beziehungen, durch Freundschaften und soziale Netzwerke und auch durch die Gewährleistung aller Bürgerrechte hergestellt. So scheint es zur Verwirklichung von Inklusion zunächst einmal naheliegend und wünschenswert, den Zugang zum Bildungssystem, zur Erwerbsarbeit und zum Wohnungsmarkt sowie alle weiteren Institutionen für alle gesellschaftlichen Gruppen zu gewährleisten. Dadurch sollen auch soziale Netzwerke gestärkt und die Chancen, Bürgerrechte wahrzunehmen, erweitert werden. Tatsächlich entspricht die Wirklichkeit auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt oder im Bildungswesen aber nicht immer den Wünschen und Vorstellungen der Menschen vom »guten Leben«, sodass der Zugang zu diesen Bereichen allein noch nichts über die tatsächliche Qualität der gesellschaftlichen Verhältnisse aussagt. Wenn die Forderung nach Inklusion nicht zur Anpassung an durchaus kritikwürdige Ist-Zustände verkürzt werden soll, muss sie über die soziale Zugehörigkeit zum Bestehenden hinaus auch auf die demokratischen und sozialen Qualitäten einer Gesellschaft zielen (vgl. Kronauer 2010, S. 17). Ein inhaltlich qualifiziertes Verständnis von Inklusion führt deshalb in eine gesellschaftskritische Perspektive und erfordert entsprechende Positionierungen. Ein solches Verständnis zielt über die soziale Zugehörigkeit zum Bestehenden hinaus und in umfassender Weise auch auf die demokratischen und sozialen Qualitäten einer Gesellschaft (vgl. Kronauer 2010, S. 17).
Im weiteren Verlauf dieses Buches kann die Unterscheidung zwischen »Partizipation«, »Teilhabe« und »Inklusion« nicht immer eingehalten werden. Viele der herangezogenen Quellen verwenden diese Begriffe mehr oder weniger synonym oder akzentuieren sie recht unterschiedlich. Insgesamt muss man sich damit abfinden, dass die Begriffe Partizipation, Teilhabe und Inklusion nicht ganz trennscharf sind, und dass alle drei sich auf schwer überschaubare Weise auf alle Ebenen der Gesellschaft beziehen. Sie werden in großen gesellschafts- und demokratietheoretischen Zusammenhängen ebenso verwendet wie in Bezug auf konkrete Handlungbereiche, z. B. denen der Bildung, der Sozialen Arbeit oder der Medienpädagogik.
Die Ausführungen dieses Buches orientieren sich möglichst konsequent an einem umfassenden Teilhabe-Begriff. Dieser umfasst neben der Teilhabe an Entscheidungsprozessen aller Art auch den Zugang der Individuen zu den verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten der Gesellschaft, um die eigenen Lebensentwürfe realisieren zu können (vgl. Wesselmann 2019, S. 99, unter Bezug auf Schnurr 2018, S. 634),
Wo eine Verwendung dieses Teilhabe-Begriffes wegen der Quellenlage nicht möglich ist, werden die Begriffe so verwendet wie in den jeweils herangezogenen Quellen.
Das Thema »Teilhabe« erfordert eine intensive Beschäftigung mit historischen Entwicklungen, ohne deren Kenntnis sich die gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen von Teilhabe nicht verstehen lassen. Die Teilhabe-Orientierung in der Sozialen Arbeit ist zudem mit vielen weitergehenden Fragen zum Selbstverständnis und zu den Methoden der Sozialen Arbeit verknüpft. Damit die Leser_innen sich in dem komplexen Geflecht der verschiedenen historischen, theoretischen und praktischen Aspekte des Themas orientieren können, werden an vielen Stellen Querverweise zu vorausgegangenen oder noch kommenden Abschnitten gegeben.
Читать дальше