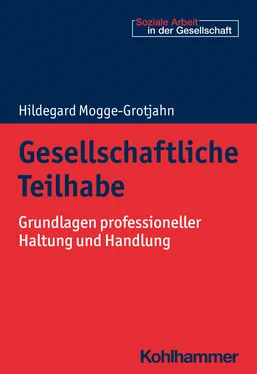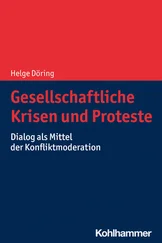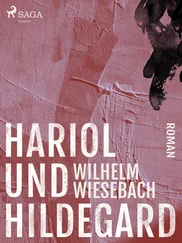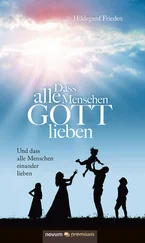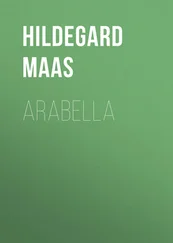Seit der Zeit, in der ich die Schule beendete und anfing zu studieren, also seit etwa 50 Jahren, gehört es zu meinem Selbstverständnis, mich politisch und sozial zu engagieren. Als ich mit den Vorarbeiten für dieses Buch begann, beschäftigten mich viele Aspekte der Teilhabe-Thematik ganz persönlich – allen voran der Klimawandel, die Verletzung der Menschenwürde von geflüchteten Menschen und der (wieder) erstarkende politische Populismus. Während der Arbeit am Manuskript brach die Corona-Pandemie über die Menschheit herein, und ihr Ende ist jetzt, zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Buches, noch nicht abzusehen. Oft habe ich mich gefragt, wozu ich in solchen Zeiten ausgerechnet ein Buch über »Teilhabe« schreiben sollte – schließlich ist es eine prägende Erfahrung, die diese Pandemie mit sich bringt, dass die Möglichkeiten politischer Teilhabe erschwert sind und viele Menschen sich in radikaler Weise in der Gestaltung eines »guten Lebens« für sich, ihre Familien und ihre Mitmenschen einschränken müssen. In besonderer Weise gilt dies für Menschen, die in Pflegeheimen und anderen stationären Einrichtungen leben und arbeiten sowie ihre Angehörigen. Den extremsten Ausschluss von Teilhabe erfahren diejenigen, die ohne Beistand durch ihre Nächsten sterben.
Inzwischen bin ich der Auffassung, dass gerade in diesen Zeiten das Thema »Teilhabe« von zentraler Bedeutung ist. Denn die Erfahrungen der Pandemie nötigen uns zur Besinnung auf die Grundwerte von Demokratie und Menschenrechten. Es muss immer wieder neu darüber nachgedacht und diskutiert werden, in welchem Verhältnis persönliche Freiheiten und die solidarische Rücksichtnahme zueinanderstehen. Warum und wie lange ist es gerechtfertigt, persönliche Freiheitsrechte einzuschränken, um die Menschen vor den gesundheitlichen Risiken der Pandemie und das Gesundheitswesen vor dem Kollaps zu bewahren? Über Jahrzehnte bewährte politische Strukturen wie der Föderalismus offenbaren ihre Schwachstellen. Die Bekämpfung populistischer Kampagnen in den Sozialen Medien mit ihrer Verleugnung von Realitäten einerseits, das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie der Schutz freier und unabhängiger Medien andererseits müssen neu miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der globale Kapitalismus beweist einmal mehr, dass die ökonomischen Prozesse politisch gesteuert werden müssen und dass ›starke‹ und ›schwache‹ Interessen nicht nur ein Thema der Sozialen Arbeit sind, sondern ein Zukunftsthema für die Staaten der Welt.
Nicht zuletzt hat es mich erschreckt, wie schnell für mich persönlich ebenso wie für die politische Öffentlichkeit die Themen des Klimawandels und der Flüchtlingspolitik aus dem Fokus der Aufmerksamkeit geraten können.
Die Antworten auf alle diese Fragen können nur mit Hilfe von Demokratie und nicht etwa gegen demokratische Grundrechte und Prinzipien gefunden werden. Das hat die Erstürmung des Weißen Hauses, dem Regierungssitz der Vereinigten Staaten von Amerika, durch gewalttätige Verächter und Verächterinnen der Demokratie Anfang Januar 2021 – den so genannten »Trumpisten« – überdeutlich gemacht.
»Teilhabe« ist auch und gerade in Zeiten der Pandemie und der globalen ökonomischen und politischen Verwerfungen kein Luxusthema, sondern von existenzieller Bedeutung für die Einzelnen wie für die Gesellschaften insgesamt. Soziale Arbeit kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Teilhabe auch denjenigen Personen und Gruppen ermöglicht wird, die nicht von vorneherein dazu privilegiert und motiviert sind. Und vielleicht, so ist meine Hoffnung, kann dieses Buch etwas dazu beitragen, die Teilhabe-Orientierung in der und für die Soziale Arbeit zu stärken.
Von der ›Rohfassung‹ bis zur hier vorliegenden Druckfassung ist das vorliegende Buch umfassend überarbeitet worden. Wesentliche Impulse und zahlreiche Anregungen hierfür verdanke ich Carola Kuhlmann und Kerstin Walther.
Weitere wichtige Hinweise kamen von Benjamin Benz, Vera Dittmar, Lilo Dorschky und Kristin Sonnenberg.
Euch allen gilt mein großer Dank!
Bochum, im März 2021
Hildegard Mogge-Grotjahn
1 Einführung
Kapitelüberblick
In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe »Partizipation«, »Teilhabe« und »Inklusion« sowie ihre jeweiligen Entstehungsgeschichten erläutert. Da die Abgrenzung dieser Begriffe nicht immer eindeutig ist, wird auch auf ihre Schnittmengen eingegangen. Daran anschließend werden die inhaltlichen Schwerpunkte der folgenden Kapitel vorgestellt.
1.1 Zu den Begriffen Partizipation, Teilhabe und Inklusion
Auch wenn »Teilhabe« das zentrale Thema dieses Buches ist, beginnt die Darstellung mit dem Begriff der Partizipation. Der Teilhabe-Begriff wird erst danach erläutert, und es folgt der Begriff der Inklusion. Diese Reihenfolge orientiert sich an der Abfolge, in der die Begriffe in der fachlichen und politischen Öffentlichkeit besonders intensiv diskutiert wurden.
Allerdings werden die Begriffe »Teilhabe« und »Partizipation« im alltäglichen, politischen und auch im wissenschaftlichen Bereich oft synonym verwendet oder auch mit dem Begriff »Inklusion« gleichgesetzt. Häufig wird bei der Übersetzung von internationalen Dokumenten – z. B. der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) (Vereinte Nationen 2008) – der englische Begriff »participation« mit dem deutschen Begriff »Teilhabe« übersetzt. »Teilhabe« wiederum wird in vielen Veröffentlichungen als »zentrale(r) Anspruch von ›Inklusion‹« verstanden (vgl. Spatschek, Thiessen 2017, S. 11).
Weitere verwandte, aber nicht in gleichem Maße gehaltvolle Begriffe sind die der »Teilnahme«, »Mitbestimmung« oder »Mitsprache«. Auch der Begriff »Engagement« wird häufig in ähnlichen Zusammenhängen verwendet.
Trotz der Überschneidungen in der Bedeutung der Begriffe Partizipation, Teilhabe und Inklusion können und sollten sie unterschieden werden. Denn zum einen haben sie unterschiedliche theoretische Herkünfte, und zum anderen sind sie in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten entstanden. Dieses Buch geht davon aus, dass der Begriff der Teilhabe am umfassendsten ist und deshalb als Bezeichnung für eine generelle Ausrichtung der Sozialen Arbeit an den Bedürfnissen und Interessen ihrer Adressat_innen gewählt werden sollte.
Um den vielfältigen Aspekten des Themas gerecht werden zu können, wird nicht nur auf soziologische, sondern auch auf politikwissenschaftliche sowie sozialarbeitswissenschaftliche und sozialpädagogische Quellen zurückgegriffen. Auch das Spezialgebiet der politischen Soziologie trägt zur fundierten Auseinandersetzung mit dem Thema Teilhabe bei. Ferner gibt es inhaltliche Schnittmengen mit den Gesundheitswissenschaften und der Psychologie.
In den folgenden Abschnitten werden die Begriffe »Partizipation«, »Teilhabe« und »Inklusion« ausführlich dargestellt und miteinander in Beziehung gesetzt.
Der Begriff der Partizipation wird in erster Linie in der Politikwissenschaft, der politischen Soziologie und in politischen Zusammenhängen verwendet. Dabei geht es zunächst ganz allgemein um die Möglichkeiten von Bürger_innen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Mit dem Hinweis auf die Entscheidungen ist der Begriff Partizipation bereits abgegrenzt von anderen Formen von Beteiligung, »bei denen die Meinung der Mitwirkenden keine Auswirkung auf das Ergebnis hat oder bei denen nicht sicher ist, dass ihre Meinung in den Entscheidungsprozess einfließt« (Straßburger, Rieger 2014c, S. 230).
Formen politischer Partizipation sind zum einen die Mitarbeit in politischen Parteien oder die Teilnahme an Wahlen auf allen politischen Ebenen (vgl. Wimmer 2014, S. 56). Zum anderen gilt auch die aktive Beteiligung an Bürgerinitiativen, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen oder Online-Petitionen zu politischen Entscheidungen als politische Partizipation (vgl. Steinbrecher 2016, S. 313).
Читать дальше