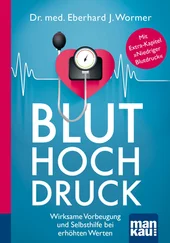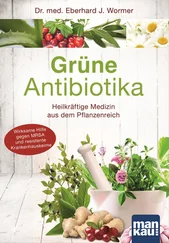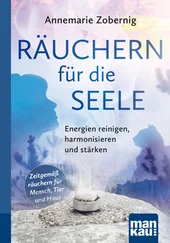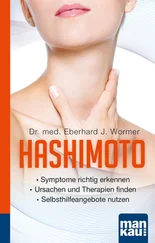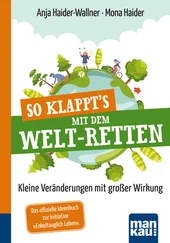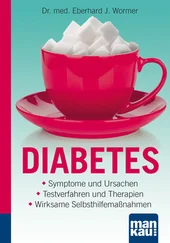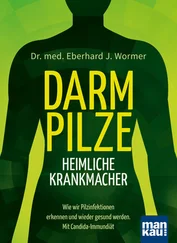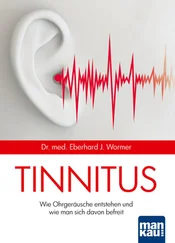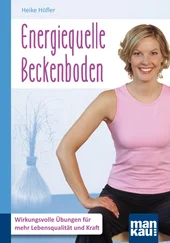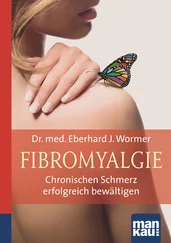Seit 2003 betrachtet man die Arthrose als eine Erkrankung, die durch viele Faktoren ausgelöst werden kann, inklusive genetischer, metabolischer, entwicklungsbedingter und traumatischer Faktoren: »Arthrose ist durch morphologische, biochemische, molekulare und biomechanische Veränderungen sowohl der Zellen als auch der Matrix gekennzeichnet. Dies führt zur Aufweichung, Fibrillation, Ulzeration und zum Verlust von Gelenkknorpel. Zudem kommt es zur Sklerosierung und zum Aufbrauch darunterliegenden Knochens, zur Osteophyten- und Zystenbildung. Typische Arthrosebeschwerden sind Gelenkschmerz, -empfindlichkeit, Bewegungseinschränkung, Gelenkreiben, gelegentlich ein Erguss sowie Entzündungen unterschiedlichen Schweregrads ohne systemische Effekte« (Flores/Hochberg 2003).
Seit 2003 betrachtet man die Arthrose als eine Erkrankung, die durch viele Faktoren ausgelöst werden kann, inklusive genetischer, metabolischer, entwicklungsbedingter und traumatischer Faktoren: »Arthrose ist durch morphologische, biochemische, molekulare und biomechanische Veränderungen sowohl der Zellen als auch der Matrix gekennzeichnet. Dies führt zur Aufweichung, Fibrillation, Ulzeration und zum Verlust von Gelenkknorpel. Zudem kommt es zur Sklerosierung und zum Aufbrauch darunterliegenden Knochens, zur Osteophyten- und Zystenbildung. Typische Arthrosebeschwerden sind Gelenkschmerz, -empfindlichkeit, Bewegungseinschränkung, Gelenkreiben, gelegentlich ein Erguss sowie Entzündungen unterschiedlichen Schweregrads ohne systemische Effekte« (Flores/Hochberg 2003).
Gelenke: Form folgt Funktion
Das knöcherne Skelett des Erwachsenen besteht aus 206 bis 214 Knochen sowie Knorpeln und Bindegewebe. Säuglinge haben noch mehr als 300 Knochen, von denen einige im Lauf der Zeit zusammenwachsen. Viele Knochen sind durch Gelenke miteinander verbunden – mehr oder weniger fest, starr oder beweglich.
Dem Skelett verdanken wir die relativ stabile aufrechte Haltung entgegen der irdischen Schwerkraft. Knochen allein bewirken keine aufrechte Haltung, geschweige denn eine Bewegung. Haltung und Bewegung werden erst durch Gelenke plus Muskelkraft möglich.
Es gibt Gelenkknochen und Bänder, die sie zusammenhalten. Werden diese Bänder durchtrennt, fällt alles auseinander. Die Knochen bewegen sich nur dann, wenn über die Muskulatur Kraft auf sie einwirkt. Allerdings wirkt ein Muskel nicht unmittelbar auf den Knochen ein, sondern überträgt die Kraft auf Sehnen, die die Muskeln und Knochen verbinden.
Jede Bewegung des Knies mit zugehörigen Knochen ist stets das Ergebnis des Zusammenspiels von Muskeln, Faszien, Sehnen und Knochen, die im Gelenk beugen, drehen oder strecken können. Ohne bewegliche Verbindungen der einzelnen Knochen wäre der Mensch nur ein schlaffer Knochensack. Es gibt deshalb ein äußerst stabiles Stützskelett mit mehr als 360 Gelenkverbindungen.
Grundstoff: Bindegewebe
Bindegewebe gehört zu den grundlegenden Bausteinen von Gelenken. Es übernimmt unter anderem Stütz- und Versorgungsfunktionen. Das Bindegewebe selbst besteht aus Zellverbänden und der Bindegewebsmatrix. Knorpelzellen (Chondrozyten) gehören zu den Bindegewebszellen, die Zellverbände bilden können.
Die Bindegewebsmatrix besteht zu 20–30 Prozent aus Fasern (kollagen, elastisch, retikulär) und zu 65–70 Prozent aus eiweißhaltigen Molekülkomplexen (Proteoglykane, Glykoproteine). Die Matrixmoleküle vernetzen die Bindegewebsfasern und fungieren beispielsweise als Wasserspeicher – Knorpel besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Unter Belastung kann Knorpel durch Wasserverlust ein Fünftel seiner Höhe verlieren. Man weiß heute auch, dass es Bindegewebs-Stammzellen gibt, die Knorpelzellen erzeugen können.
Bewegliche Teile: Gelenkknochen
Ein Gelenk verbindet mindestens zwei verschiedene Knochen. Je nach Funktion unterscheidet man Kugelgelenke (wie an der Hüfte), Eigelenke (wie an der Hand), Scharniergelenke (wie am Ellbogen), Zapfengelenke (wie am Unterarm), Sattelgelenke (wie an der Daumenwurzel) und flache Gelenke (wie an den Wirbeln). Drei Gelenktypen stehen zur Auswahl:
 Unbewegliche Gelenke (Synarthrosen), z. B. am knöchernen Schädel
Unbewegliche Gelenke (Synarthrosen), z. B. am knöchernen Schädel
 Gelenke mit stark eingeschränkter Beweglichkeit (Amphiarthrosen), z. B. Wirbelkörper
Gelenke mit stark eingeschränkter Beweglichkeit (Amphiarthrosen), z. B. Wirbelkörper
 Gelenke mit eindeutiger Beweglichkeit (Diarthrosen), z. B. die Gliedmaßengelenke
Gelenke mit eindeutiger Beweglichkeit (Diarthrosen), z. B. die Gliedmaßengelenke
Am Gelenk beteiligte Knochen haben unter der Knorpelschicht eine spezielle Knochenschicht, den sogenannten subchondralen Knochen. Es handelt sich um eine dünne Knochenplatte, die vergleichsweise gut verformbar ist. Subchondraler Knochen ist mit dem darunterliegenden Knochen und dem darüberliegenden Knorpel durch kollagene Fasern fest vernetzt. Bei Arthrose verfestigt sich der subchondrale Knochen zunehmend. Hyaliner Gelenkknorpel hat an der Unterseite noch eine verknöchernde Knorpelschicht, die mit dem subchondralen Knochen fest verzahnt ist.
Gleitfläche: Gelenkknorpel
Gelenkknorpel ist hyaliner Knorpel (hyalin = durchscheinend, glasig, klar). Die Knorpelschicht sitzt auf dem subchondralen Knochen und dieser wiederum auf dem Gelenkknochen. Gelenkknorpel kann mehrere Millimeter dick sein (z. B. am Knie: 5 mm). Knorpel wird nicht durch Nerven, Lymph- oder Blutgefäße versorgt, sondern durch das Zusammenwirken aller am Gelenk beteiligten Strukturen (Gelenkkapsel, Gelenkflüssigkeit, Bänder u. a.).
Unter dem Mikroskop erscheint die Knorpeloberfläche weißlich und mit winzigen Einsenkungen bedeckt, wie bei einem Golfball. Diese Einsenkungen markieren vermutlich die Standorte von Knorpelzellen (Chondrozyten). Knorpelzellen werden durch Diffusion via Gelenkflüssigkeit ernährt: durch Pumpbewegungen bei Gelenkaktivierung.
Statische Gelenkbelastung (zum Beispiel durch langes Stehen) sowie Gewichtsbelastung der Knie- und Hüftgelenke begünstigen Knorpelabbau durch mangelhafte Knorpelernährung. Dies erklärt auch den Erfolg eines vorbeugenden Trainings der physiologischen Gelenkbewegung, die die Knorpelernährung verbessert und vor Arthrose schützt.
| WUNDERSTOFF GELENKKNORPEL |
| Aufgaben |
Aufbau |
 Stützgewebe Stützgewebe  Reibungslose Gelenkbewegung Reibungslose Gelenkbewegung  Sicherung des Gelenks bei Zug- und Druckeinwirkung Sicherung des Gelenks bei Zug- und Druckeinwirkung  Stoßdämpfung (Schockabsorption) Stoßdämpfung (Schockabsorption)  Ausgleich von Druck- und Scherkräften (bei aufrechtem Gang) Ausgleich von Druck- und Scherkräften (bei aufrechtem Gang) |
 Knorpelzellen (Chondrozyten): Bildung von elastischen und kollagenen Fasern Knorpelzellen (Chondrozyten): Bildung von elastischen und kollagenen Fasern  Knorpelmatrix: Mukopolysaccharide, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure u. a. Knorpelmatrix: Mukopolysaccharide, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure u. a.  Wasseranteil: Erwachsene 80 Prozent, im hohen Alter 40 Prozent Wasseranteil: Erwachsene 80 Prozent, im hohen Alter 40 Prozent |
|
Gelenkknorpel besteht zu fast 80 Prozent aus Wasser sowie aus Knorpelzellen, Kollagen und Zucker/Eiweißstoffen (Proteoglykane). Bei Druckeinwirkung kann der Knorpel bis zu ein Fünftel seines Wassergehalts verlieren. Lässt der Druck nach, saugt sich der Knorpel wieder mit Wasser aus der Gelenkflüssigkeit voll. Hyaliner Knorpel hält Drücke bis zu 2000 kPA aus, was dem 10-bis 20-fachen Autoreifendruck entspricht. Die Elastizität des Gelenkknorpels lässt sich mit einem Wasserkissen vergleichen, das sich bei Druckeinwirkung die Formveränderung merken kann. Knorpel ist demnach hochgradig und optimal anpassungsfähig.
Читать дальше
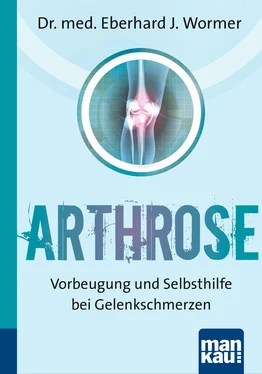
 Seit 2003 betrachtet man die Arthrose als eine Erkrankung, die durch viele Faktoren ausgelöst werden kann, inklusive genetischer, metabolischer, entwicklungsbedingter und traumatischer Faktoren: »Arthrose ist durch morphologische, biochemische, molekulare und biomechanische Veränderungen sowohl der Zellen als auch der Matrix gekennzeichnet. Dies führt zur Aufweichung, Fibrillation, Ulzeration und zum Verlust von Gelenkknorpel. Zudem kommt es zur Sklerosierung und zum Aufbrauch darunterliegenden Knochens, zur Osteophyten- und Zystenbildung. Typische Arthrosebeschwerden sind Gelenkschmerz, -empfindlichkeit, Bewegungseinschränkung, Gelenkreiben, gelegentlich ein Erguss sowie Entzündungen unterschiedlichen Schweregrads ohne systemische Effekte« (Flores/Hochberg 2003).
Seit 2003 betrachtet man die Arthrose als eine Erkrankung, die durch viele Faktoren ausgelöst werden kann, inklusive genetischer, metabolischer, entwicklungsbedingter und traumatischer Faktoren: »Arthrose ist durch morphologische, biochemische, molekulare und biomechanische Veränderungen sowohl der Zellen als auch der Matrix gekennzeichnet. Dies führt zur Aufweichung, Fibrillation, Ulzeration und zum Verlust von Gelenkknorpel. Zudem kommt es zur Sklerosierung und zum Aufbrauch darunterliegenden Knochens, zur Osteophyten- und Zystenbildung. Typische Arthrosebeschwerden sind Gelenkschmerz, -empfindlichkeit, Bewegungseinschränkung, Gelenkreiben, gelegentlich ein Erguss sowie Entzündungen unterschiedlichen Schweregrads ohne systemische Effekte« (Flores/Hochberg 2003). Unbewegliche Gelenke (Synarthrosen), z. B. am knöchernen Schädel
Unbewegliche Gelenke (Synarthrosen), z. B. am knöchernen Schädel Stützgewebe
Stützgewebe