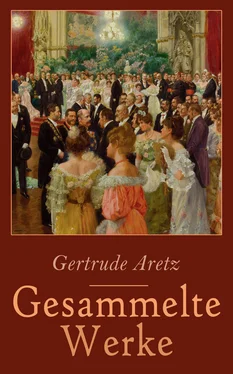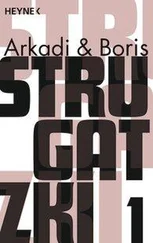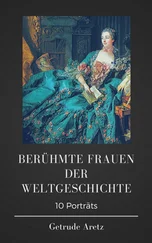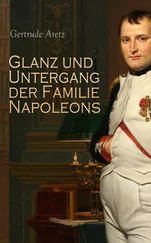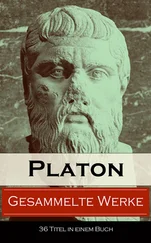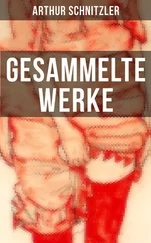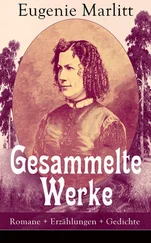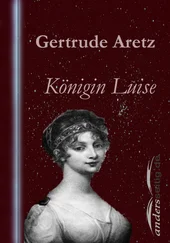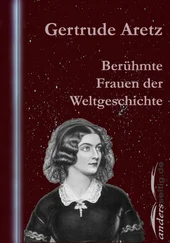»Nein, sie ist der Krone Englands unwürdig. Sie ist die illegitime Tochter Anna Boleyns. Sie ist keine aufrichtige Katholikin. Sie ist eine Heuchlerin. Sie umgibt sich nur mit Protestanten. Sie machen sich allesamt lustig über die katholischen Kirchenzeremonien. Lieber ernenne ich Lady Lenox oder Maria Stuart oder die Herzogin von Suffolk zu meiner Nachfolgerin.« Man hat Maria auch hinterbracht, Elisabeth habe den französischen Gesandten heimlich bei sich empfangen und von ihm Ratschlage des Königs von Frankreich erhalten. Es ist Verleumdung, aber Maria wird immer wieder durch derartige Hetzereien in ihrem Mißtrauen gegen die Schwester bestärkt.
Von Stund an ließ sie Elisabeth ihr Mißfallen auf unzweideutige Art fühlen. Im Audienzzimmer darf die Prinzessin nicht wagen, den Stuhl der Gräfin Lenox oder der Herzogin von Suffolk einzunehmen. Ihre Freunde und Höflinge werden in auffallendster Weise zurückgesetzt und beleidigt. Elisabeth läßt sich das nicht lange gefallen. Da sie es jedoch für diplomatischer hält, im Guten mit ihrer Schwester auseinanderzukommen, bittet sie höflich um die Erlaubnis, sich vom Hofe entfernen und nach Ashridge zurückziehen zu dürfen. Sie sei ohnehin nicht besonders gesund und habe Ruhe nötig. Man gewährt ihr die Bitte, nachdem sie versprochen hat, sich in Ashridge mit der Kirche ergebenen Leuten umgeben zu wollen. Begleitet von den guten Ratschlägen Renards und Lord Pagets, die ihr ins Gewissen reden, zieht sie davon, äußerlich ganz Sanftheit und Ergebenheit.
Elisabeth ist sehr froh, dem »Netz der Spinne« – wenigstens eine Zeitlang – entronnen zu sein. Gleichsam zum Hohn – offiziell unter dem Vorwand, auch in Ashridge nicht der katholischen Religionsgebräuche entbehren zu müssen – läßt sie einen Boten an die Königin abgehen, um sich Chorhemden, Meßgewänder und Meßgefäße von ihr zu erbitten. Sie befindet sich bereits auf dem Wege nach ihrem Schloß. Aber Maria soll sehen, welch gute Katholikin ihre Schwester ist. Hätte sie die Kirchengewänder gleich mitgenommen, so wäre ja Maria nicht darauf aufmerksam geworden. Elisabeths Berechnung fruchtet diesmal nicht. Die Königin bleibt ihr gegenüber mißtrauisch und haßerfüllt. Ihre Freunde, besonders die spanischen Ratgeber, tun ihr möglichstes, sie immer mehr davon zu überzeugen, daß Elisabeth die Ruhestörerin ist. Sie muß verschwinden. Renard sagt der Königin geradeheraus, sie habe vier verschiedene Feinde: die Ketzer und Schismatiker; die Rebellen und Anhänger des Herzogs von Northumberland; Frankreich und Schottland; Mylady Elisabeth.
Nichtsdestoweniger geht die Trennung der Schwestern äußerlich reibungslos vor sich. Maria schenkt Elisabeth beim Abschied ein prachtvolles Zobelbarett und zwei Hals- und Armketten aus großen Perlen, dem Lieblingsschmuck der Prinzessin. Elisabeths Reisezug ist außerordentlich glänzend. Fünfhundert Edelleute zu Pferd begleiten sie. Auf dem Wege aber fühlt Elisabeth sich zu schwach, die Reise zu Pferd fortzusetzen. Sie erbittet durch Boten von der Königin deren Sänfte. Sie erhält sie sofort. Die äußere Höflichkeit wird nicht verletzt. Doch weder die eine noch die andere der Schwestern ist aufrichtig in ihren Gefühlen. Und während Elisabeth froh ist, der schwesterlichen Bevormundung entrückt zu sein, bleibt Maria voll Unruhe und Unsicherheit in London zurück.
Achtes Kapitel. Die Verschwörung
Inhaltsverzeichnis
Ehe Maria Tudor Philipp erwählte, waren ihr verschiedene Heiratsprojekte vorgeschlagen worden. Anfangs hatte sie sich eigentlich geweigert, überhaupt zu heiraten. Doch das Land verlangte eine männliche Führung. Außerdem hoffte Maria durch eine Ehe ihrem Throne doch noch einen Erben zu geben. Dann war die Frage der Thronfolge Elisabeths sowieso gelöst. Doch weder der Neffe des Kaisers Karl V., Erzherzog Karl noch Heinrich II. von Frankreich noch König Christian III. von Dänemark noch der Infant Don Luis von Portugal, auch nicht der Herzog Emmanuel Philibert von Savoyen kamen für die Königin von England in Betracht. Kaiser Karl schlug ihr einige davon zwar der Form wegen vor, im Grunde aber dachte er nur an seinen Philipp. Damit begünstigte er nicht nur seine eigenen politischen Pläne, sondern kam auch einem persönlichen Wunsch der Königin entgegen. Sein Gesandter Renard verstand es, der in Philipp verliebten Maria den zukünftigen Gatten in einem so glänzenden Lichte zu schildern, daß sie schließlich keinen andern mehr haben wollte als ihn. Ihr früherer Vorsatz – wenn sie je heiraten sollte –, nur einen Mann zu wählen, der in ihrem Alter oder älter sei, war plötzlich vergessen. Philipp war trotz seiner Jugend schon acht Jahre verheiratet gewesen und hatte einen siebenjährigen Sohn, den später so unglücklichen und von seinem unmenschlichen Vater so roh behandelten Don Carlos. Philipps Charakter, versicherte ihr Renard, – der »Seelenberater«, wie sie ihn nannte – sei über alle Kritik erhaben. Er sei bescheiden, sehr gemäßigt und gütig. Dann sandte ihr die Königin Maria von Ungarn, Karls V. Schwester, ein von Tizian gemaltes Bild ihres Neffen Philipp. Es stellte ihn zwar noch jünger, als 23 jährigen, dar, aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Maria hatte sich entschieden.
Am 29. Oktober 1553 empfing sie auf höchst mystische und dramatische Weise, nur in Gegenwart ihrer Ehrendame Lady Clarence, den Abgesandten Kaiser Karls noch am späten Abend in ihrem Zimmer. Als Renard eintrat, lag die Königin vor dem Heiligen Altarsakrament, das in der Mitte aufgestellt war, auf den Knien und sang das »Veni Creator«. Sowohl die Hofdame als auch der Gesandte sangen es leise nach. Darauf erhob sich Maria und gelobte Gott, der allein sie zu dieser Ehe inspiriert habe, niemand anderen als den spanischen Prinzen zu heiraten, ihn immer zu lieben und ihm nie Grund zur Eifersucht zu geben. Sie geriet in Verzückung, verkündete Philipp als den »für die jungfräuliche Königin Erwählten des Himmels, den ihr keine Macht der Welt entreißen oder von ihr abwendig machen könne«.
Es dauerte jedoch noch drei Monate, ehe alle Verhandlungen mit Spanien abgeschlossen waren.
Erst am 2. Januar 1554 trafen die Hochzeits-Gesandten Karls V. und Philipps mit dem Ehevertrag in London ein. Maria schickte ihnen zum Empfang den jungen schönen Grafen von Devonshire, Eduard Courtenay, entgegen. Als sich der Zug durch Londons Straßen bewegte, erhob sich kaum eine Stimme zur Begrüßung der Fremden. Im Gegenteil, die Leute drehten die Köpfe auf die Seite oder senkten ihre Blicke, um die spanische Gesandtschaft nicht ansehen zu müssen. Es herrschte eisige Stille. Vor der Stadt war das Gefolge von Straßenjungen mit Schneeballen bombardiert worden.
Ein paar Tage später, am 12., wurde der Ehevertrag Marias und Philipps unterzeichnet. Es gab die üblichen Feste und Belustigungen bei dieser Gelegenheit. Niemand war jedoch zufrieden, weder der Adel noch das Volk. Trotzdem der Kanzler erst im Hause der Lords, dann vor dem Lord-Mayor und den Aldermen in einer glänzenden Rede hervorgehoben hatte, welche Vorteile England aus dieser Familienverbindung ziehen werde, und daß seine Freiheit durch den fremden Fürsten absolut unangetastet bleibe. Man stand dieser Heirat höchst skeptisch gegenüber.
Sogar Marias Vertrauensmann Renard war sich bewußt, daß die Lage der Königin sich durch die Verbindung mit Philipp dauernd verschlechtern würde. Er schrieb seine Befürchtungen schon im September an den Bischof von Arras. Er sprach sich darüber aus, wie sehr er in dieser Beziehung die Franzosen fürchte. Am meisten aber Elisabeth. Ihr traute er nicht über den Weg. In vielen Punkten seines Briefes sollte er recht behalten. Am selben Tag, als der Kanzler dem Parlament und dem Magistrat den Ehevertrag Marias mit Philipp von Spanien mitgeteilt hatte, schrieb Noailles an Heinrich II. durch Vermittlung seines Vertrauensmannes La Marque: »Die beiden Kammern werden nie gestatten, daß der Spanier ihr König wird.« Lieber wollen sie alle, Hochadel, Gentry und Volk, in einer Schlacht gegen ihn für ihre Freiheit sterben, als sich in eine solche Knechtschaft begeben. »Eines Tages«, fuhr er fort, »werden sie die Waffen ergreifen, um die Königin vom Throne zu verjagen.«
Читать дальше