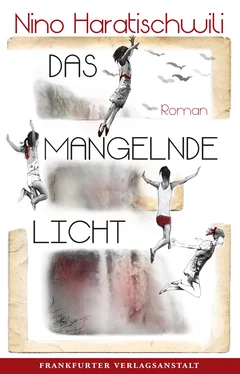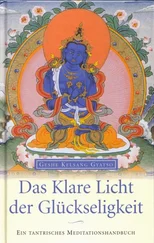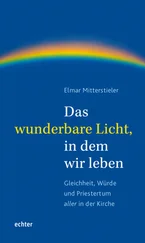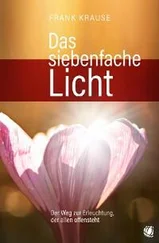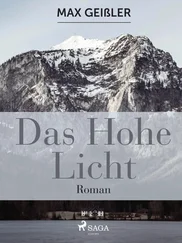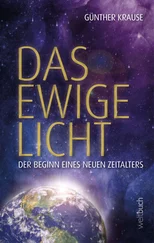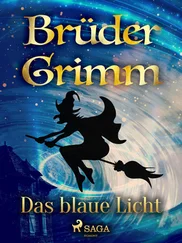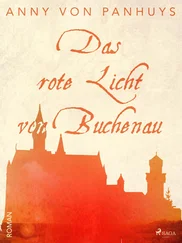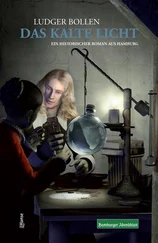Mit den Jahren entwickelte ich eine gewisse Routine bei diesen Begegnungen: Ich ahnte, wann wir allein bleiben und er mit hastigen Blicken prüfen würde, ob wir auch wirklich ungestört waren, um dann sofort zur Sache zu kommen: »Warum zeichnest du unseren Hof immer aus der gleichen Perspektive?« – »Ich habe ein cooles neues Album von einer sehr schrägen Engländerin, Kate Bush heißt sie, willst du es hören und mir sagen, wie du sie findest?« – »Rot steht dir, warum trägst du das nicht öfter?« – »Magst du auch klassische Musik?« Die Fragen kamen oftmals zusammenhanglos und wie aus der Pistole geschossen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er sie in der Zeit, in der wir uns nicht sahen, sammelte, und auf die nächste Gelegenheit wartete, um mich einem seiner Kreuzverhöre zu unterziehen. Nach und nach entdeckte ich eine gewisse Logik in diesen wirren Fragen und wurde auch mit meinen Antworten schneller. Ich hatte keine Mühe mehr, von meinen Musikvorlieben zu bestimmten Zeichentechniken, vom Lieblingsessen zu irgendeinem Streit in der Schule und dann zu einem neuen Film im Kino »Oktober« zu wechseln. Ich lernte mit der Zeit, von den Fragen auf Lewans Interessen zu schließen, sie verrieten so viel über ihn, und in mir festigte sich ein neues, ein eigenes Bild dieses Jungen, das er aus einem verborgenen Grund nur mir offenbaren wollte.
Er war musikvernarrt und liebte klassische Musik nicht nur, sondern kannte sich sogar unerwartet gut aus. Anders als bei mir hatten die langen Nachmittage bei Onkel Giwi, zu denen seine Mutter auch ihn verpflichtet hatte, bei ihm offenbar gefruchtet. Er hatte einiges für Kunst übrig, aber anders als sein Bruder gab er dieses Interesse nicht unumwunden zu, um bloß nicht aus der Rolle des harten, unerschütterlichen Rowdys zu fallen. Aber er sehnte sich anscheinend nach jemandem, mit dem er seine weiche Seite teilen konnte. Ich war diejenige, die er dafür erwählt hatte, und ich nahm diesen heimlichen Austausch als kleines, unverhofftes Geschenk an. Manchmal fragte ich mich, was mich daran hinderte, einfach selbst den Hof zu überqueren und ihn zu besuchen, um unsere Gespräche in der erforderlichen Ruhe zu führen, aber etwas in mir ahnte, dass ich mit diesem Schritt unsere zaghafte, übervorsichtige Nähe aufs Spiel setzen würde, und ich ließ es sein.
Und wie würde man uns wohl beschreiben, die Kipianis, die letzten Bewohner dieses Hofs? »Die Kipianis«, ja, so nannte man uns im Hof, der Nachname stand für alle drei Generationen in der Dreizimmerwohnung, so viele Jahre, so viele Vergangenheiten und mögliche Zukunftsversionen in sich vereinend, so viele Gegensätze, so viele eingeäscherte Träume …
Die Babudas, wie sehr sie mir doch fehlen. Sie markieren den Beginn meiner persönlichen Zeitrechnung. Babuda eins, Babuda zwei. Zwei Anfänge ein und derselben Geschichte. Bevor ich auf die Welt kam, nannte mein Bruder sie beide »Bebia«, schlicht »Großmutter«. Das aber sorgte stets für Verwirrung. Wenn mein Bruder nach Bebia rief, drehten immer beide die Köpfe nach ihm um und verloren sich in tüchtiger Fürsorge, um einander auch in diesem Punkt in nichts nachzustehen. Als meinem Bruder dieser ewige Wettstreit zu blöd wurde, beschloss er, ihnen beiden den Großmutter-Status abzuerkennen. Zuerst nannte er sie, zu ihrem Entsetzen, bei ihren Vornamen – Eter, die Großmutter väterlicherseits, und Oliko, die Großmutter mütterlicherseits –, später wählte er dann die Bezeichnung Babuda, »Schwester des Großvaters«, was keiner Logik folgte, aber auf eine sehr kindlich-intuitive Weise den Konflikt entschärfte. Dazu nummerierte er sie auch noch durch: Eter wurde zu Babuda eins und Oliko zu Babuda zwei.
Babuda eins war im Jahr der Einverleibung der kurzlebigen georgischen Demokratie durch die Bolschewiken geboren und wiederholte stets, dies komme »nicht von ungefähr«. Das gewaltsame Ende der Demokratie und ihr Streben nach Autonomie und Disziplin stünden durchaus miteinander in Verbindung. Sie war eine sehr nüchterne, im engeren Sinne intellektuelle Person, die allerdings einen Hang zur Mystik und eine sentimentale Ader für die Heroik besaß. Sie sei in diesem schicksalhaften Jahr geboren worden, weil das Leben nur den Auserwählten derlei Wendepunkte zumute. Das Universum habe gewusst, dass sie diese persönliche Herausforderung würde meistern können. Dass diese Herausforderung ihrem gesamten Volk galt, vergaß sie allzu gern, zumal es ihr insbesondere darum ging, Babuda zwei ihre Überlegenheit zu demonstrieren, da diese erst zwei Jahre später das Licht der Welt erblickt hatte, in einem weit weniger symbolisch aufgeladenen Jahr.
Ihr etwas albernes Konkurrenzgehabe zog sich durch ihrer beider Leben wie ein roter Faden, als gälte es, alles, aber auch wirklich alles, dieser koketten Rivalität unterzuordnen. Ich hätte allzu gern gewusst, wann sie damit begonnen hatten, und vor allem, wer von ihnen. Manchmal glaubte ich, dass sie nur auf die Welt gekommen waren, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, dass sogar meine Eltern nur aus diesem einen Grund geheiratet hatten: um diese beiden kruden, eigenwilligen Seelenverwandten und Rivalinnen zusammenzubringen, und keineswegs, um meinen Bruder und mich zu zeugen oder in ihrer kurzen Ehe glücklich zu werden.
Die Babudas waren sich in genauso vielen Eigenschaften ähnlich, wie sie sich radikal voneinander unterschieden. Es war eine dauernde Reibung, die eine Energie freisetzte, die sie beide am Leben hielt. Mit zunehmenden Jahren schienen sie von dieser Energiequelle immer abhängiger zu werden, und wenn gerade mal kein Streitthema anstand, wenn sich gerade kein äußerlicher Konflikt anbot, dann wurde eine Meinungsverschiedenheit regelrecht heraufbeschworen, ein Zwist provoziert. Ihre Auseinandersetzungen schienen sie zu befeuern, sie zu Höchstleistungen anzuspornen, so hielten sie ihre Lebensgeister und Köpfe wach, eben wie Menschen, die sich täglich körperlich betätigen, um in Form zu bleiben. Sie waren die tragenden Säulen unserer Familie, deren Zusammenfinden, so schien es, nicht bloß dem Zufall, sondern einem geheimen kosmischen Plan zu verdanken sei, dem sie von Kindertagen an gefolgt waren.
In Eters Erzählungen von ihrer Kindheit kamen stets märchenhaft anmutende Figuren vor, da gab es Gouvernanten aus Dresden und Handarbeitslehrerinnen aus Krakau, sogar einen Reitlehrer aus Armenien für ihren jüngeren Bruder. Ich stellte mir meine Großmutter damals als ein pausbäckiges Mädchen mit türkisen Schleifen im Haar und in Lackschühchen vor – wie ich es in unserer alten englischen Ausgabe von »Alice im Wunderland« gesehen hatte –, das mit ernstem Gesicht und aufrechter Haltung in einem lichtdurchfluteten Zimmer sitzt und Rotkehlchen auf ein Stofftaschentuch stickt. Diese lichtdurchflutete und wohlige Kindheit jagte mir einen Schauer über den Rücken, weil ich ja aus den Erzählungen wusste, dass bald Dunkles und Finsteres über sie hereinbrechen und ein böser Zauber sich über das schöne Haus mit geschwungenen Bögen und vergoldeten Spiegelrahmen legen würde: Die Bolschewiken würden kommen und ihnen alles wegnehmen. In meiner kindlichen Vorstellung waren die Bolschewiken allesamt böse Mächte der Finsternis, sie trugen schwarze Gewänder und hatten nur ein Auge, wie der Zyklop in unserem Buch der griechischen Mythologie, das ich als Kind so sehr liebte. Was ich damals nicht begriff, war, dass diese Bolschewiken nicht gekommen und wieder gegangen waren, sondern über siebzig lange Jahre bei uns blieben, und dass auch ich unter ihnen lebte.
Die Szene, wie ihr Vater, ein vornehmer Seidenfabrikant, eines Nachts abgeholt wurde, habe ich noch heute vor Augen, meine Vorstellung davon ist immer noch genauso lebendig wie damals, als ich mit geweiteten Augen und mit offenem Mund dieser grausamen Geschichte lauschte.
Ich sehe sie vor mir, finstere Männer, die ihn um drei Uhr morgens abholen kommen, als die Stadt noch in einem tiefen Schlaf versunken liegt, ich höre die Mutter weinen, höre den Vater seine Frau trösten und ihr Mut machen, sehe, wie er die Bolschewiken mit erhobenem Haupt höflich bittet, ihn nicht anzufassen, er wolle eigenständig und in Würde ins wartende Auto steigen. Und wie die bösen Bolschewiken beschämt zu Boden blicken – bloßgestellt von so viel Haltung – und wie die kleine Eter, vom Lärm geweckt, barfuß ins Wohnzimmer gelaufen kommt und der Vater ihr sagt, es sei nur ein Spiel, wie Verstecken für Erwachsene, und sie solle sich nicht fürchten, er würde sich an einem »sehr sicheren Ort« verstecken.
Читать дальше