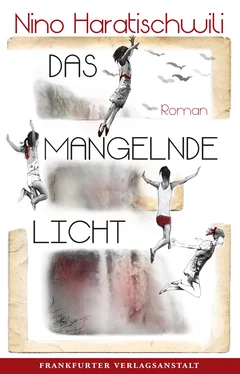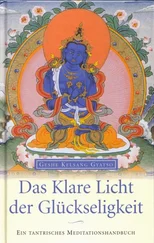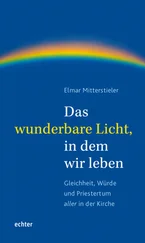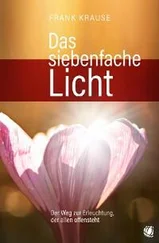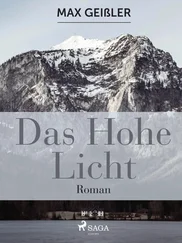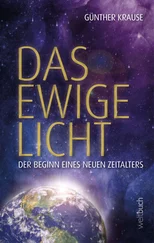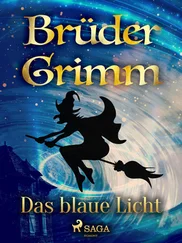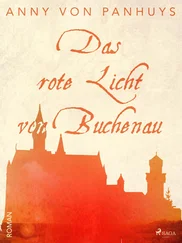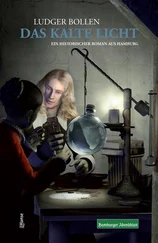Das lichtdurchflutete Zimmer wurde durch ein dunkles, feuchtes Loch nahe der Ortatschala-Festung ersetzt, wo sie niemanden kannten und wo nur Arbeiterfamilien hausten, mit denen sie keine Sprache teilten. »Sie hatten nur Verachtung für uns übrig, sie dachten, dass wir uns für etwas Besseres hielten«, betonte Eter immer, wenn sie an diese Stelle kam. Die Briefe aus Astrachan, wohin ihr Vater deportiert worden war, wurden rar, und die Mutter erkrankte an Tuberkulose. Als Eter, gerade siebzehnjährig, einen jungen, von der Permanenten Revolution besessenen und den Marxismus als letzte Rettung der Menschheit preisenden Bolschewiken heiratete, war die Hoffnung groß, damit ihrer Familie aus der bitteren Not herauszuhelfen und ihren Vater zurückholen zu können. Denn als Kinder eines »Vaterlandsverräters« hatten sie weder eine Chance auf Bildung noch auf eine ordentliche Anstellung. Ihre Hoffnungen zerfielen zu Staub: Erst erreichte sie ein Brief aus Astrachan, der Häftling sei auf einer Baustelle tödlich verunglückt, dann wurde der Große Vaterländische Krieg ausgerufen und sowohl ihr Bruder als auch ihr frisch angetrauter Mann an die Front berufen. Ein Jahr später fiel ihr geliebter Bruder Guram, der Gedichte auf Deutsch schrieb und Puccinis Arien sang »wie kein anderer«, auf der Halbinsel Kertsch. »Er war nicht für den Krieg geschaffen, er hatte die Seele eines Schwans«, wiederholte Eter an dieser Stelle, und ich versuchte, mir einen Guram vorzustellen, der nicht mein gleichnamiger Vater war, der Gedichte auf Deutsch schrieb und eine Schwanenseele besaß, aber es gelang mir beim besten Willen nicht.
Ihr Mann, den sie kaum mehr als aus den Briefen kannte, die er ihr von der Front schrieb, und in dem sie unbedingt einen Kriegshelden sehen wollte, wenn er schon nicht zum romantischen Helden taugte, hinterließ nur eine einzige signifikante Spur in ihrem Leben, und das auch nur, weil der Zufall es wollte, dass er nach einer Verwundung im letzten Kriegsjahr zur Genesung in ein Tbilisser Krankenhaus verlegt wurde. Bei diesem Aufenthalt muss es zur Zeugung meines Vaters gekommen sein, der dann bereits als Halbwaise zur Welt kam, da sein Vater, kaum genesen, erneut in den Kampf aufbrach und es nicht schaffte, die letzten Kriegstage zu überleben.
Der Status als junge Kriegswitwe machte ihr Leben etwas erträglicher, sie schluckte ihren Zorn und ihre Enttäuschungen hinunter wie bittere, aber nötige Medizin, krempelte die Ärmel hoch und begann, das Leben neu zu erfinden. Sie gab ihrem Sohn den Namen ihres geliebten Bruders, Guram, und besann sich auf die Dinge, die sie glücklich gemacht hatten. Sie dachte an die lichtdurchfluteten Nachmittage, an denen ihr Bruder Guram und sie sich im Aufsagen von Gedichten überboten hatten, im Wettstreit um das Lob ihrer deutschen Gouvernante Martha. An diesen magischen Ort kehrte sie nun immer wieder zurück, sammelte auf, was dort zurückgelassen worden war. Und auch wenn viele sich wunderten – der Krieg war gerade erst vorbei und Deutsch die Sprache der Feinde –, beschloss sie, Germanistik zu studieren, denn für sie existierte auch ein anderes Deutschland, Marthas Deutschland, das Deutschland ihres Vaters, das er öfter geschäftlich aufgesucht hatte, das Deutschland der Brüder Grimm und Heines und Kleists und Novalis’ und Hölderlins – und natürlich ihres geliebten Goethe.
Sie studierte Germanistik und ergatterte sogar ein Stipendium, mit dem sie gerade so über die Runden kamen. Wie oft mein Bruder und ich uns doch anhören mussten, dass die deutsche Sprache und Kultur ihr das Leben gerettet hätten. Dieser Sprache blieb sie bis zu ihrem Lebensende treu, in dieser Sprache fand sie Trost und Wärme, Güte und Erhabenheit – alles, was ihr das Leben seit der Verhaftung und Verschleppung ihres Vaters verwehrt hatte. Ein Trick meines Bruders funktionierte später immer: Sie war jedes Mal zutiefst betroffen und entrüstet, wenn er sagte, dass Deutsch »wie ein Presslufthammer« klinge und er sich weigere, es zu lernen.
Eigentlich bedauere ich es, dass ich die stundenlangen Zankereien und Diskussionen zwischen ihr und Babuda zwei um die Vorzüge der deutschen gegenüber der französischen Sprache nicht in irgendeiner Form dokumentiert habe. Es waren wahre Gladiatorenkämpfe, richtige Lehrstücke in der Disziplin des verbalen Duells. Welch absurde Argumente teilweise angeführt wurden, wer da nicht alles zitiert wurde: Die Nibelungensage versus das Rolandslied, Goethe versus Racine, Voltaire versus Kant, Musil versus Proust. Diese Streitereien, diese nie endenden Argumente, dieses Gegenüberstellen von französischen und deutschen Tugenden war die ewige Begleitmusik meiner Kindheit. Und wir alle wussten, dass es in diesem Kampf keinen Gewinner geben konnte, dass immer der unbefriedigende Gleichstand bleiben würde.
– Schon deswegen ist Deutsch die wunderbarste Sprache der Welt, weil zwischen dem Leben und dem Lieben nur ein einziges kleines i steht, sagte Babuda eins an einem sonnigen Morgen am Frühstückstisch. Mein Vater war in seine Zeitung vertieft, mein Bruder und ich zankten uns um irgendetwas, Oliko hatte im Hintergrund das Radio mit folkloristischem Kitsch laufen, alles war wie immer. Wir alle ahnten bereits die heraufziehende endlose Diskussion.
– Deda, bitte nicht schon wieder, und vor allem nicht jetzt!, stöhnte mein Vater.
– Was denn? Es muss nun mal gesagt werden.
Eter sah zufrieden in Olikos Richtung, die so tat, als hätte sie nichts gehört, obwohl man merkte, dass sie ihrer Rivalin durchaus Respekt zollte und ihre Eröffnung recht gekonnt fand.
– Reichst du mir die Butter bitte, mein Sonnenschein?, wandte sich Oliko an meinen Bruder.
Eter erwartete keine Lorbeeren, aber man spürte, dass sie diesen banalen Satz durchaus als einen kleinen Sieg wertete, und aß zufrieden weiter. Doch kurz bevor wir uns alle vom Frühstückstisch erhoben, kam der Gegenschlag:
– Und wisst ihr, warum Französisch die schönste Sprache der Welt ist?
Olikos funkelnde Augen streiften jeden Einzelnen von uns. Dass wir in diese ewigen Diskussionen immer hineingezogen wurden, waren wir gewohnt, wir waren die Arena, wir feuerten sie an, ohne uns wäre das Spiel sinnlos und langweilig.
– Weil nur im Französischen der Orgasmus als »der kleine Tod« bezeichnet wird.
La petite mort , fügte sie noch in ihrem eleganten Französisch genüsslich hinzu.
Mein Vater verschluckte sich an seinem Tee.
– Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren, die Kinder sitzen mit am Tisch!, echauffierte sich Eter auf der Stelle, aber sie schimpfte halbherzig, man merkte, dass sie ihrer Gegnerin durchaus Anerkennung entgegenbrachte.
– Was ist ein Orgasmus?, fragte mein Bruder und strahlte die beiden älteren Frauen scheinheilig an.
Eter Kipiani galt als Koryphäe an der Germanistischen Fakultät der Staatlichen Universität, wo sie zunächst als Professorin, später als Fakultätsleiterin arbeitete. Ihr Sohn, mein Vater Guram, war ein viel zu früh erwachsen gewordener Junge, der den hohen geistigen Ansprüchen seiner Mutter zu genügen und schon als Schüler mit den geliebten Studenten seiner Mutter Schritt zu halten versuchte, von denen sie unentwegt sprach. Sie weihte ihren Sohn in all ihre Sorgen und Probleme ein, unterschätzte aber die emotionale Bürde, die sie ihm damit auferlegte. Mein Vater sollte daher im Laufe seines Lebens eine bestimmte Strategie im Umgang mit seiner dominanten Mutter entwickeln, die er bis zu ihrem Lebensende beibehielt: Er lieferte ihr das, was sie hören und sehen wollte, und das, was ihn wirklich umtrieb oder belastete, behielt er für sich. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass die endlose Rivalität der beiden Babudas ursprünglich genau dort ihren Anfang nahm: im Herzen meines
Vaters.
Vater zeigte schon früh eine große Begeisterung für die naturwissenschaftlichen Fächer. Im Gespräch mit seiner Klassenlehrerin nickte seine Mutter wortlos und bemerkte mit leichtem Bedauern in der Stimme: »Ich hätte ihn so gerne für das Wesentliche entflammt …« Die Lehrerin sah Eter etwas irritiert an: »Ich wollte ihn für die landesweite Jugendolympiade der Mathematik anmelden!« Doch Eter zuckte bloß mit den Schultern.
Читать дальше