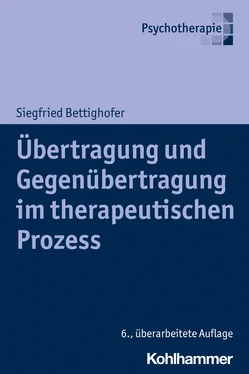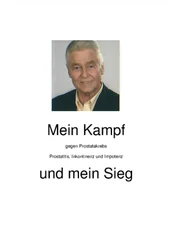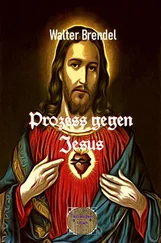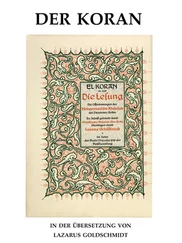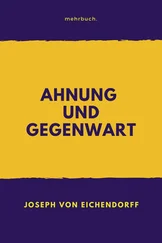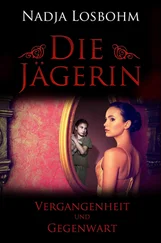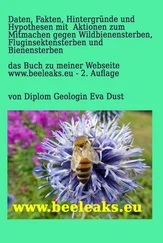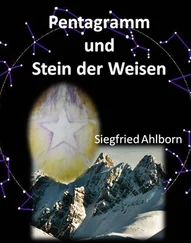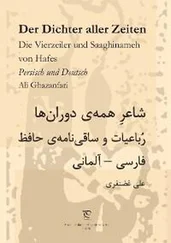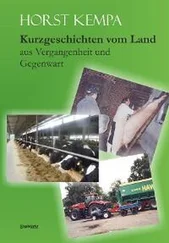So entgeht der Wahrnehmung von Wurmser möglicherweise die genaue Kenntnis seines Involviertseins in den gegenseitigen Prozess, in dem er nicht nur Beobachter, Container und Deuter, sondern auch ein durch das interaktionelle Feld Beeinflusster ist.
Langs (1989) beschreibt in seiner Arbeit über die Angst des Therapeuten vor validen, d. h. sich direkt auf die Übertragung beziehenden Deutungen, eine Behandlung, in der die gut gemeinte Honorarverminderung zum unbewussten Bestandteil einer therapeutischen Szene wurde, in der der Patient neben der Erleichterung auch eine masochistische Demütigung erlebte. Es kam zu einer monatelangen Stagnation des therapeutischen Prozesses, weil die Therapeutin aus eigener Angst die Bearbeitung der konkreten Wahrnehmungen des Patienten in der analytischen Situation vernachlässigt hatte. Sie war zum unbewusst mithandelnden Teil der pathologischen Übertragungsszene geworden, nicht deshalb, weil sie entgegenkommend und eine gute Mutter sein oder eine korrigierende emotionale Erfahrung vermitteln wollte, sondern deswegen, weil die dadurch entstandene tatsächliche Beziehung zwischen beiden nicht konkret reflektiert und in den Deutungsprozess einbezogen wurde.
Der Begriff des Gegenübertragungswiderstandes kommt in der Beschreibung von Wurmser ebenso wenig vor wie in der langjährigen Theorie und Technik der psychoanalytischen Behandlung, ausgenommen einige Arbeiten aus den letzten Jahren (z. B. Blankenburg-Winterberg 1988, Ehrenberg 1985, Ermann 1984 und 1987, Storck 2020). Der langanhaltende Übertragungswiderstand der Patientin in Form einer Abwertung der analytischen Arbeit wird von Wurmser als Verkehrung der Beziehung zu ihrem Vater ins Aktive und als Abwehr von Scham gesehen. Er wird somit rein individualistisch konzipiert, seine Quelle ist also ausschließlich die Persönlichkeit der Patientin. Dass auch im Analytiker, insbesondere bei einer derart lang anhaltenden schwierigen Situation, Widerstände entstehen können bzw. müssen, und dass solche Gegenübertragungswiderstände den Widerstand aufseiten der Patientin aufrechterhalten können und es in besonderen Fällen sogar zu einer Übertragungs-Gegenübertragungs-Kollusion kommen kann, wurde in der traditionellen Literatur wie auch bei Wurmser noch nicht berücksichtigt.
Wurmser verfolgt deutlich eine andere, sehr gebräuchliche Zielrichtung. Manchmal zu sehr theoriegeleitet, greift er Übertragungsgefühle und andere Assoziationen der Patientin auf und verknüpft sie etwas gewaltsam zu Deutungen und genetischen Rekonstruktionen, für die jedoch meines Erachtens das vorliegende Beweismaterial nicht ausreicht und die dem Erleben der Patientin so fern sind, dass sie darauf zunächst nur mit Widerstand reagiert, der aber nicht bearbeitet wird. Diesen Widerstand als Kriterium für die Richtigkeit der Rekonstruktionen anzusehen, entspräche zwar einer analytischen Tradition, wäre jedoch meines Erachtens ein Ausdruck eines analen, um Macht orientierten Agierens, bei dem die Reaktion der Patientin nicht ernstgenommen wird. Wurmser beginnt eher zurückhaltend: »Wenn ich höre, was Sie berichten […], frage ich mich, ob Sie nicht ein Geheimnis sexueller Art Ihres Vaters oder Ihrer Mutter entdeckt haben mögen, und zwar in Wirklichkeit« (1988, S. 309). Es bleibt letztlich unklar, wie er zu dieser schwerwiegenden Rekonstruktion kommt. Auch wenn die Patientin in ihrer Reaktion konzediert, es sei »durchaus möglich, dass ich meinen Vater mit jemandem gehört oder gesehen habe« (a. a. O., S. 310), geht sie doch sofort in den Widerstand, indem sie diese potenzielle Wahrnehmung verharmlost und als ihr eigenes Missverständnis abtut. In den darauf folgenden Interaktionen ist es beeindruckend, mit welch einer Entschiedenheit Wurmser der Patientin überaus gekonnt und nahtlos nachweist, dass sie ihren Vater »tatsächlich bei einem Akt der Untreue« (a. a. O., S. 310) entdeckt habe. Er gebraucht dabei ein übliches Vorgehen, indem er versucht, die unbewussten Hintergründe der Assoziationen zu verstehen und sie der Patientin zu deuten. Er verliert jedoch den Kontakt dazu, wie sie selbst diese Zusammenhänge erlebt.
Letztlich gibt sie angesichts der gewaltigen Deutungskompetenz des Analytikers nach, zunächst noch herablassend, indem sie zugesteht, das sei »eine gute Theorie« (a. a. O., S. 310), sich aber dann doch zunehmend damit identifizierend. Ihre Aussage in der nächsten Stunde: »Wir haben etwas sehr Plausibles konstruiert, aber es lässt mich noch baumeln« könnte darauf hinweisen, dass es bis dahin eher zu einem intellektualisierten Nachvollzug der Deutungen gekommen ist. Immerhin spüre sie aber eine instinktive zustimmende Resonanz (a. a. O., S. 311). Wir können nicht wissen, ob diese Deutung zu einer wirklichen emotionalen und mutativen Einsicht geführt hat. Es wäre auch denkbar, dass sich die Patientin wieder einmal einer übermächtigen Vaterfigur unterworfen und sich i. S. eines falschen Selbst verhalten hat, wofür sie sogar noch bewundert wurde. Denn »um von ihren Eltern geliebt zu werden, musste sie deren Mythen und deren Wahrnehmungen der Realität annehmen« (a.a.O.,, S. 313). In diesem Falle hätte Wurmser auf einer unbewussten und »latenten« Ebene (Bettighofer 1994, Katz 1998) ihre pathologische Beziehungsform mitgestaltet. Wurmser fügt noch hinzu, dass die Patientin zwar nun voll gezahlt habe, sie »verwirklichte aber ihren ursprünglichen Vorsatz recht unvermittelt, nämlich die Analyse im Sommer […] abzubrechen« (Wurmser 1988, S. 312).
Vielleicht hatte sie diesen Entschluss gefasst, weil sie ihren tiefen Gefühlen von Schmerz, Scham und Verlassenheit bedrohlich nahegekommen war. Vielleicht aber auch, weil sie sich von ihm nicht verstanden gefühlt hatte oder vor dem übermächtigen Vater-Analytiker fliehen musste.
Für den Stil, mit dem Wurmser die Übertragungsanalyse durchführt, ist der anfangs oben zitierte Ausschnitt möglicherweise nicht typisch. In dieser Sequenz verweilt er im Vergleich zu anderen Sequenzen relativ lange in der gegenwärtigen Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Häufig macht er von einer Übertragungsreaktion einen eher instrumentellen Gebrauch, z. B. um daran eine genetische Deutung anschließen zu können. Es ist erkennbar, dass die Suche nach Einsichten in psychodynamische und genetische Zusammenhänge im Dort und Damals einen deutlichen Vorrang vor der Bearbeitung von Vorgängen im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung hat.
Fallschilderungen wie diese suggerieren den Eindruck einer objektiven Klarheit und Eindeutigkeit, die bei genauerem Hinsehen in keiner Hinsicht gegeben ist und die schon von Argelander (1979) in seiner Arbeit über die kognitive Verarbeitung und Organisation des therapeutischen Geschehens im Analytiker kritisch reflektiert worden ist. Unter Bezugnahme auf die folgende kurze Fallvignette von Moeller (1976) nennt er einige in dieser Darstellung implizierten und damals nie reflektierten Gesichtspunkte:
Der Patient beginnt die Stunde und redet und redet. Lebhafte und farbige Szenen. Trotz der scheinbaren Lebendigkeit und Affektivität kann ich mich nicht richtig konzentrieren, auch nicht richtig auf ihn einstellen. Ich schweife selbst ab. Mir wird dann klar, dass ich hier keine Beziehung herstellen kann. Ich verstehe jetzt, dass sich der Patient vor der Aufnahme einer Beziehung zu mir scheuen muss. Unter dem quasi korrekten analytischen Verhalten, nämlich seinen freien Assoziationen folgend, wehrt der Patient die (homosexuell getönte) Bindung zu mir ab. Ich meine, dass es sich hier um eine Gegenübertragungsreaktion handelt. Der Patient induziert sie in mir. Ich nehme damit Aspekte seines Selbst wahr. (Moeller 1976, S. 148)
Das Beispiel ist paradigmatisch, weil jeder Analytiker diese Sprache versteht und sie auch gebraucht, ohne sich darüber klar zu werden, wieviele Stufen der Erkenntnis er zusammenfassend überspringt. […] Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die implizit dargestellten Formen von Interaktion, Kommunikation, Übertragungsvorgänge, Folgerungen und begriffliche Erläuterungen, in einen kognitiv organisierten Zusammenhang gehören, dessen funktionelle Bezüge, die sich in Erlebnissen, Handeln, Nachdenken, Erkennen usw. äußern, in einer selbstverständlichen Aussage zusammengefasst werden, ohne sich über diese Prozesse Rechenschaft abzulegen. Sie sind in die Professionalisierung so selbstverständlich eingegangen, dass ein Problembewusstsein für sie kaum noch existiert. (Argelander 1979, S. 12/13)
Читать дальше