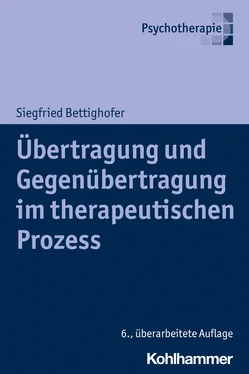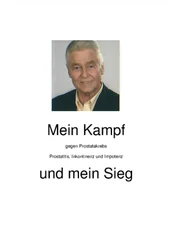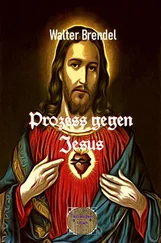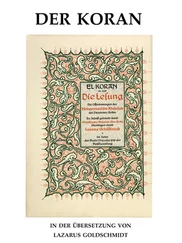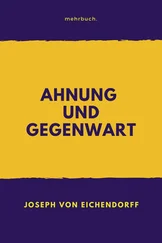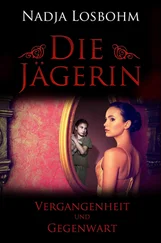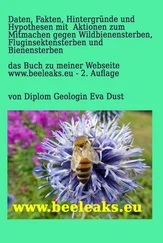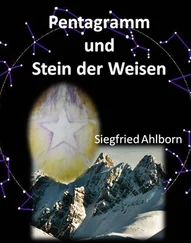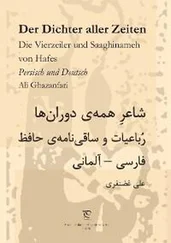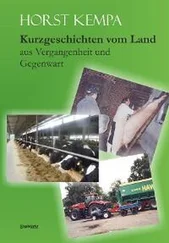Greenson hat zur Erläuterung seiner Darstellung der Übertragung sicherlich bewusst ein sehr einfaches Beispiel gewählt, aber es trifft dennoch exakt den Kern des ursprünglichen Übertragungsbegriffes. Der Analytiker als klar und eindeutig abgegrenzter Beobachter hält aufgrund seiner objektiven Erkenntnis der Realität die Fantasie der Patientin, dass er einen Bart habe, für unangemessen, da er offenbar zu dieser Zeit keinen Bart getragen hatte. In dieser Unangemessenheit der fantasierten Wahrnehmung liegt das zentrale Kriterium für das Vorliegen einer Übertragung, die dann auch konsequent hinsichtlich ihrer infantilen Vorlage bearbeitet wird.
2.1 Übertragung als Störung der Realitätswahrnehmung
Übertragung im traditionellen und auch heute noch etwas erweiterten Sinne führt also zu einer Verkennung der Realität. Im Beispiel von Greenson kann der Wahrheitsgehalt der Wahrnehmung und ihre Verzerrung aufgrund des leicht beobachtbaren Faktums problemlos erkannt werden. In den meisten Übertragungsfantasien, denen wir bei Patienten begegnen, ist diese Eindeutigkeit jedoch nicht oder nur ansatzweise gegeben.
2.2 Übertragung als Regression
Die durch die Übertragungsfantasie gestörte Wahrnehmung der Realität beruht auf einer Regression der Patientin. Ihr Ich wie auch das gerade aktualisierte Objektbeziehungsniveau bewegen sich auf einer kindlichen Ebene. Es findet also eine zeitliche und strukturelle Regression statt, wodurch kindliche und archaische und insofern auch undifferenziertere und eher unbewusste Erlebnisweisen, Fantasien und Affekte vorherrschen. Diese Regression kann mehr oder weniger weite Bereiche von Ich, Es und Über-Ich einbeziehen. Während bei den meisten neurotischen Störungen nur eine partielle und somit potenziell ichdystone und bearbeitbare Regression vorliegt, erfasst diese Regression in einer Psychose weite Teile des Ichs und der Gesamtpersönlichkeit, sodass ein völliger Bruch im Verhältnis zur Realität stattfindet.
2.3 Übertragung als Verschiebung
Der Hauptmechanismus, auf dem die Übertragung beruht, ist die Verschiebung. Dabei werden Erfahrungen vom ursprünglichen Objekt auf ein anderes, z. B. den Analytiker verschoben, d. h., es werden energetische Besetzungen von einer inneren Objektrepräsentanz auf eine andere verlagert. Die Verschiebung ist einer der zentralen Abwehrmechanismen und wurde schon von Freud (1900) als ein Hauptmechanismus der Traumarbeit beschrieben. Auch in der Fallgeschichte vom kleinen Hans diente ihm die Verschiebung dazu, dessen Angst vor Pferden zu erklären, die »ursprünglich gar nicht den Pferden galt, sondern sekundär auf sie transponiert wurde« (Freud 1909, S. 286) und sich unbewusst auf den Vater bezog. Damals gebrauchte Freud beide Begriffe, Projektion und Verschiebung, um ein und denselben Sachverhalt zu benennen.
Übertragung galt in diesem Konzept als Abwehr, als Schutz des Ichs vor dem Erinnern der pathogenen frühen Objektbeziehungen. Der Patient überträgt dabei seine frühen Objekterfahrungen auf den Analytiker und wiederholt sie in der Beziehung mit ihm, anstatt sie als Erinnerung zu reproduzieren. Dieses Agieren galt als Widerstand. Es hat sehr lange gedauert, bis der Begriff des Agierens etwas von seinem negativen Bedeutungsgehalt verloren hatte (Gill 1982). Erst seit wenigen Jahren wird das Agieren nicht mehr als Widerstand gegen den Fortschritt, sondern als ein natürlicher und konstruktiver Vorgang betrachtet (Bohleber et al. 2013, Streeck 2004).
Das behandlungstechnische Vorgehen bestand darin, dem Patienten die Unangemessenheit seiner Reaktion aufzuzeigen und sie über genetische Deutungen auf die ursprünglichen kindlichen Erfahrungen zurückzuführen, wie es Greenson (1975) im oben angeführten Beispiel illustriert. Die Übertragung diente dazu, Gefühlsreaktionen aus den Symptomen zu locken und sie auf die Person des Analytikers zu verschieben, um sie dann auf die »eigentlichen« Ursachen zurückführen zu können, deren Rekonstruktion lange Zeit als der wesentliche therapeutische Wirkfaktor angesehen wurde. Nach Freud (1912) sollte der analytische Sieg auf dem Felde der Übertragung (S. 374) gewonnen werden. Wie Freud wirklich gearbeitet hat, können wir heute trotz interessanter Arbeiten über Freuds Arbeitsweise (Cremerius 1981, May 2015, Roazen 1999) und trotz historischer Berichte von Analysanden (Blanton 1975, Pohlen 2006, Wortis 1994) nicht mehr definitiv wissen. Aus der Untersuchung von Zeugnissen über Freuds Behandlungstechnik schließt Cremerius (1981) jedoch, dass Freud in seinem praktischen Vorgehen der Übertragung vermutlich keinen sonderlich großen Stellenwert eingeräumt hat (s. a. Leitner 2001) und mit Übertragungsprozessen sehr unbefangen und eher unreflektiert oder aber rational erklärend (Koellreuter 2009) umgegangen ist.
2.4 Übertragung als Projektion
Freud beschrieb die Projektion als Abwehrmechanismus, bei dem innere Anteile auf andere Personen projiziert und im Außen wahrgenommen werden. Melanie Klein (1972) erweiterte ihn zum Begriff der projektiven Identifikation, der dann in einer Weiterentwicklung von Money-Kyrle (1956) und Bion (1990, 1984) als archaischer Kommunikationsvorgang begriffen wurde (s. a. Gilch-Geberzahn 1994, Jimenez 1992, Kernberg 1989, Mertens 1991, Ogden 1988, Porder 1991, Schore 2003). Dabei werden unbewusste und wegen ihres starken Affektgehaltes unerträgliche Anteile des eigenen Selbst auf das andere Objekt verlagert und im Falle der reinen Projektion bei einem relativ gut strukturierten Patienten als ein Gedanke über den anderen wahrgenommen. Bei Patienten mit ichstrukturellen Störungen nimmt dieser Vorgang mehr die Form einer projektiven Identifikation an. Hier besteht die Gefahr eines destruktiven Gegenübertragungsagierens aufseiten des Therapeuten, da er die projizierten und (durch subtile nonverbale Signale des Patienten) induzierten Anteile des Patienten als intensive eigene Gefühle und Handlungsimpulse verspürt (Götzmann und Holzapfel 2003, Kernberg 1988a, Streeck 2009). Mit derartigen »Stimmungsübertragungen« und »interagierten Affekten« befasst sich auch die Arbeit von Herdieckerhoff (1988), in der dieser kommunikative Vorgang bei der Stimmungsinduktion näher untersucht wird. Aus neurobiologischer Sicht spielen bei diesem Vorgang der Gefühlsansteckung und dem Erzeugen von Gefühlen im Analytiker sicherlich auch die Spiegelneuronen im Frontalhirn eine große Rolle (Bauer 2015). Diese kommunikativen Mikroprozesse wurden von Streeck (2004) und Krause (2006) auf der Basis von videounterstützten Interaktionsanalysen und von Buchholz (2019) mithilfe von Diskursanalysen therapeutischer Dialoge eingehender untersucht.
2.5 Übertragung als einseitiger Vorgang – der Analytiker als passive Projektionsfläche?
Zu einer Beschreibung weiterer Kennzeichen der ursprünglichen Übertragungsarbeit soll im Folgenden ein sehr detaillierter Fallbericht von Wurmser (1988) herangezogen werden, wobei notgedrungen viele wichtige Details weggelassen werden müssen.
Eine zu Beginn der Analyse 45-jährige Patientin hatte auf ihren Analytiker u. a. eine negative Vaterübertragung entwickelt. Sie fühlte sich als Mädchen von ihrem Vater oft lächerlich gemacht und drehte nun in der Analyse den Spieß um, wurde vom passiven Opfer zum aktiven Täter, indem sie den Analytiker und die Analyse permanent entwertete und verspottete und auch nur ein 30 % geringeres Honorar zu zahlen fähig und bereit war. Der Analytiker war damit einverstanden und erkannte erst spät in der Analyse, dass er damit begonnen hatte, eine grundlegende Spaltung im Leben der Patientin mitzuagieren. Während lange Zeit nur der Ehemann der Patientin wusste, dass sie durchaus vermögend waren, waren andererseits nur dem Analytiker die häufigen außerehelichen sexuellen Affären der Patientin bekannt. Sie habe es immer so gehalten, dass niemand die ganze Wahrheit wisse, führte so ein unehrliches Leben und habe ihr wirkliches Selbst aus Angst, von den Eltern verstoßen zu werden, immer verleugnet.
Читать дальше