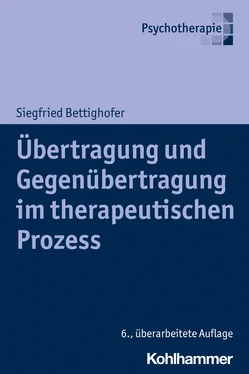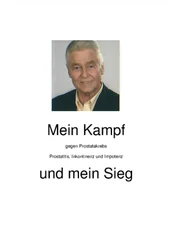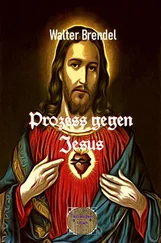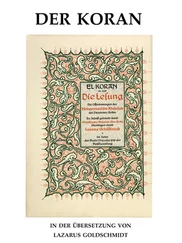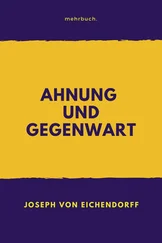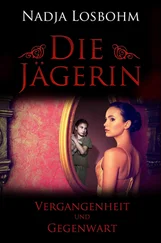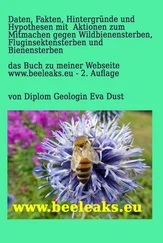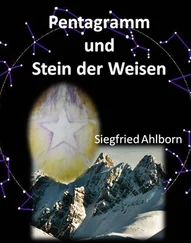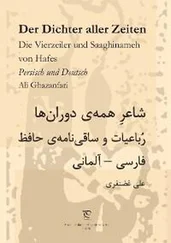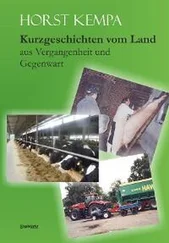Die Psychoanalyse als therapeutische Behandlungsmethode hat sich seit ihren Anfängen intensiv mit der Frage befasst, wie eine hilfreiche Beziehung zwischen Therapeut und Patient hergestellt und über den gesamten therapeutischen Prozess hinweg aufrechterhalten werden kann. Sie hat dem Aspekt der therapeutischen Beziehung immer schon einen zentralen Stellenwert eingeräumt. So hat Freud mit seinen Empfehlungen (1913), dem Patienten »Zeit zu lassen« (S. 473), einen »moralisierenden« (S. 474) Standpunkt zu vermeiden und stattdessen den Standpunkt »der Einfühlung« (S. 474) einzunehmen, eine Grundhaltung und eine Art des Zuhörens beschrieben, die für die Entwicklung einer hilfreichen Beziehung eine unverzichtbare Grundbedingung ist und die heute allgemein als einer der wesentlichen therapeutischen Wirkfaktoren gilt. Will (2010) beschreibt aus unserer heutigen Perspektive diejenigen psychoanalytischen Kompetenzen, die für die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer konstruktiven Beziehung zum Patienten notwendig sind.
Auch anderen psychotherapeutischen Methoden ist daran gelegen, einen hilfreichen Kontakt zum Patienten herzustellen. In der Gesprächspsychotherapie (Biermann-Ratjen, Eckert, Schwartz 1997) geht man davon aus, dass die durch Empathie getragene Grundbeziehung, die der Therapeut zum Patienten herstellt, von diesem im Sinne eines guten Objekts introjiziert und somit zur Grundlage für eine positivere Einstellung zu sich selbst wird.
In der Verhaltenstherapie wurde die positive therapeutische Beziehung über lange Zeit rein instrumentell als positiver Verstärker eingesetzt. Erst neuere Entwicklungen verfolgen einen differenzierteren Umgang mit der Beziehung zwischen Therapeut und Patient (Sachse 2006). Grawe (1995) hält es für eine wichtige Voraussetzung wirksamer psychotherapeutischer Arbeit, dass im Rahmen der sog. »Problemaktualisierung« (S. 136) die pathologischen Beziehungsmuster und neurotischen inneren Schemata des Patienten in der Beziehung zum Therapeuten aktualisiert werden, und kommt damit dem analytischen Übertragungsbegriff ziemlich nahe. Die Aufgabe des Therapeuten sieht sie infolgedessen darin, sich gezielt um eine »komplementäre« (Grawe et al., 1994, S. 782) oder bedürfnisorientierte Beziehungsgestaltung (Caspar 2015) zu bemühen, die dem Patienten hinsichtlich der »wichtigsten erschlossenen positiven Ziele des Patienten« (Grawe et al., S. 782) eine neue und korrektive Erfahrung vermittelt.
Damit bleibt sie letztlich bei einem instrumentellen Gebrauch der therapeutischen Beziehung und vertritt einen direktiven Ansatz, wie er in ähnlicher Form auch schon in der Geschichte der Psychoanalyse von Alexander und French (1946) beschrieben worden war, der allerdings als manipulativ galt und deshalb umstritten war – aus zeitgenössischer Sicht möglicherweise zu Unrecht (Melcher 2013, Walter 2010).
Im Gegensatz dazu besteht der originäre und emanzipatorische Beitrag der Psychoanalyse zur Gestaltung einer hilfreichen Beziehung zwischen Therapeut und Patient nicht in der gezielten Beeinflussung, sondern in der Reflexion und im Verstehen dessen, was in der Begegnung zwischen ihnen geschieht und über den Vorgang der Externalisierung innerer Konflikte in Szene gesetzt wird. Grawe et al. (1994) und Caspar (2015) bewegen sich noch in einem relativ engen Übertragungsbegriff, in dem die Persönlichkeit des Therapeuten völlig ausgespart bleibt und nur dem zielgerichteten instrumentellen Einsatz dient. Sie gehen auch nicht darauf ein, inwiefern und auf welche Art die Arbeit mit der Gegenübertragung und ihre Reflexion im konkreten therapeutischen Vorgehen einbezogen wird.
Diese Sichtweise wird der Komplexität der therapeutischen Beziehung nicht gerecht, denn sie übersieht, dass schon die sog. reale Beziehung zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten, also die Art, wie der Therapeut das Setting gestaltet und wie dies der Patienten erlebt, von den beidseitigen Übertragungsprojektionen beeinflusst wird. Diese Faktoren der realen Beziehung bekommen durch die Übertragung bereits eine unbewusste Bedeutung und werden vom Patienten auf der Basis seiner verinnerlichten Objekterfahrungen interpretiert.
Aus diesem Grund ist es für die Aufrechterhaltung einer hilfreichen Beziehung unabdingbar, von Anfang an auf die Dynamik von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen zu achten. Nur deren ständige Reflexion und der konstruktive Umgang mit ihnen kann gewährleisten, dass die positive emotionale Bindung und auch die kooperative Arbeitsbeziehung, also die therapeutische Allianz, erhalten bleiben und kritische Therapiephasen gemeinsam konstruktiv bewältigt werden können (Gumz 2012, 2020). Ein tragfähiges Arbeitsbündnis scheint auch die notwendigen, guten Voraussetzungen dafür zu schaffen, Übertragungsprozesse direkt anzusprechen und insbesondere negative Gefühle dem Therapeuten gegenüber zu bearbeiten (Benecke 2017, Greenson 1982a).
Gerade hier liegt einer der Schwerpunkte der modernen Psychoanalyse. Hinsichtlich der Bedeutung, die der Übertragung wie auch der Gegenübertragung beigemessen wird, hat sich während der letzten Jahre ein tiefgreifender Wandel vollzogen (Benecke 2017, Bettighofer 2001, 2003, 2007, 2014, 2015, Bohleber et al. 2013, Bohleber 2018, Cooper 2010, Dreyer 2017, Ferro 2003, , Jacobs 1999, Körner 2018, Krutzenbichler 2019, Maroda 2004, Mertens 2015, Oelsner 2013, Renik 2006, , Stork 2020, Thomä 2001, Wallerstein 1998, Walter 2019). Der traditionelle objektivistische Übertragungsbegriff, der zunächst im folgenden Abschnitt umrissen werden soll, wurde zunehmend erweitert um eine konstruktivistische und eine interaktionelle Komponente, sodass Übertragung und Gegenübertragung nun als eine »funktionale Einheit« (Kemper 1969) oder als eine »Einheit im Widerspruch« (Körner 1990) gesehen werden können.
In der modernen psychoanalytischen Behandlungstechnik hat sich der Schwerpunkt dementsprechend etwas verlagert. War früher eher die genetische Rekonstruktion der neurotisierenden Kindheitssituation und die rationale Einsicht in die unbewussten Konflikte der zentrale Kern der analytischen Behandlung, so steht heute gleichberechtigt die Aktualgenese des Erlebens in der therapeutischen Beziehung daneben, die Frage also, inwiefern das Erleben des Patienten mit dem Therapeuten zusammenhängt und eine Reaktion auf ihn sein könnte. Die Psychoanalyse hat sich so während der letzten Jahre zu einer »Beziehungsanalyse« (Bauriedl 1994) entwickelt, in der die Beziehungssituation zwischen Analytiker und Patient zum Fokus wurde und die im Hier und Jetzt abgebildeten Konflikte gezielt bearbeitet werden (Bettighofer 2007). Die intersubjektiven und relationalen Ansätze in der Psychoanalyse (Altmeyer und Thomä 2006, Benjamin 2007, Jaenicke 2006, 2010, 2014, Mitchell 2005, Orange 2004) bewegen sich alle im Rahmen einer konsequenten Zwei-Personen-Psychologie (Bettighofer 2014) und beruhen auf einem interaktionellen Verständnis der therapeutischen Beziehung, das ich hier in seinen einzelnen Komponenten darstellen werde.
2 Das ursprüngliche Übertragungskonzept
Die Grundlogik des ursprünglichen Übertragungsbegriffes lässt sich leicht mit einem einfachen Fallbeispiel aus dem Lehrbuch von Greenson (1975) erläutern:
Bei der Durcharbeitung einer libidinösen ödipalen Vaterübertragung beschreibt die Patientin auf die Aufforderung des Analytikers hin ihre Fantasien, von ihm geliebt, geküsst und penetriert zu werden. Nach einer Pause fährt sie fort: »Ein komisches Detail ist mir eingefallen, als ich dies alles beschrieb. Ihr Gesicht war unrasiert und Ihr Bart hat mich im Gesicht gekratzt. Das ist seltsam, Sie scheinen immer glatt rasiert zu sein« (a. a. O., S. 312). Beim Nachdenken fielen Greenson bestimmte Zusammenhänge aus der Kindheit der Patientin auf und er fragt: »Wer hat Sie immer mit dem Bart gekratzt, als Sie ein kleines Mädchen waren?« Daraufhin schreit die Patientin fast: »Mein Stiefvater, mein Stiefvater, er pflegte mich mit Genuß zu quälen, in dem er sein Gesicht an meinem rieb […]«. (a.a., O., S. 312)
Читать дальше