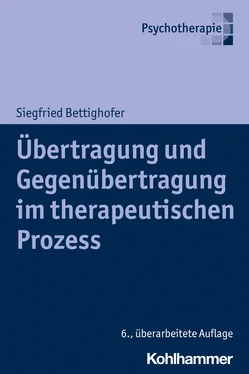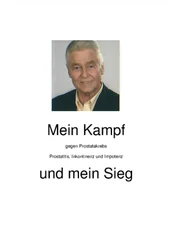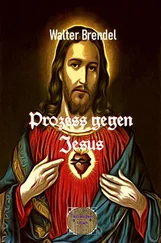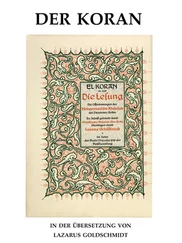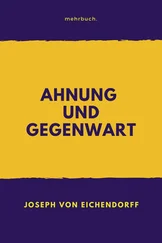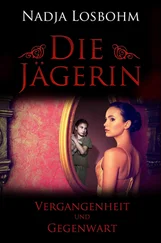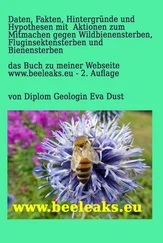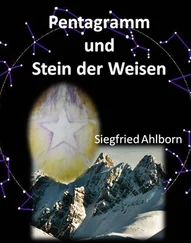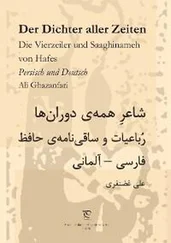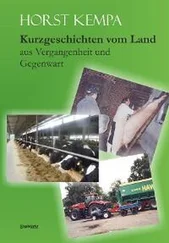In einem letzten Teil der vorliegenden Arbeit wird die moderne psychoanalytische Therapie als eine entwicklungsorientierte Beziehungskonflikttherapie konzeptualisiert und es werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie im Hier und Jetzt der aktuellen therapeutischen Beziehung konkret mit Übertragungsprozessen gearbeitet werden kann. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade in diesem Punkt neuere Strömungen der Psychoanalyse Vorgehensweisen entwickelt haben, wie sie in sehr ähnlicher Form bereits von der Selbstpsychologie verwendet werden.
Meine Hoffnung beim Schreiben dieser Arbeit war es, die äußerst komplexen Prozesse in der therapeutischen Beziehung angemessen zu beschreiben, auf wenig beachtete Aspekte hinzuweisen und so die Aufmerksamkeit für solche Vorgänge zu schärfen. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass immer mehr Psychoanalytiker und Therapeuten anderer Schulrichtungen die nötige kritische Ehrlichkeit sich selbst, den Patienten und ihren Kollegen gegenüber aufbringen. Ihre Patienten würden es ihnen danken und sie selbst könnten bei Ihrer therapeutischen Arbeit authentisch, natürlich und lebendig bleiben. Dreiundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage habe ich zahlreiche Stellen, die nicht mehr zeitgemäß waren, stark verändert bzw. gestrichen. Da die Gegenübertragung in der fachlichen Öffentlichkeit inzwischen einen enormen Stellenwert einnimmt, habe ich mich entschlossen, ein kurzes Kapitel über den Umgang mit der Gegenübertragung hinzuzufügen.
| Augsburg, im Herbst 2021 |
Siegfried Bettighofer |
1Mir ist bewusst, dass Psychotherapie inzwischen immer mehr von Therapeutinnen ausgeübt wird und dass die überwiegende Anzahl der Patienten nach wie vor Frauen sind. Dennoch möchte ich auf eine gendergerechte Schreibweise verzichten und lasse die früher übliche maskuline Form stehen, um die Lesbarkeit des Textes nicht zu erschweren. Es sind trotz der Verwendung der männlichen Form selbstverständlich alle gemeint.
1 Die hilfreiche Beziehung in der Psychoanalyse
Das wichtigste Anliegen der empirischen Psychotherapieforschung war es immer, die Effektivität von Psychotherapie nachzuweisen. Zugleich ging es um die Untersuchung der Wirksamkeit verschiedener Therapiemethoden im Hinblick auf die spezifische Störung und die Patientenpersönlichkeit. Diese Fragestellung wurde bald erweitert, und so ging man im Rahmen von Prozessuntersuchungen der Frage nach, warum Psychotherapie eigentlich wirkt und welches die entscheidenden Faktoren sind, auf denen diese Wirksamkeit beruht.
Whitehorn und Betz (1960) konnten als erste hinsichtlich der Effektivität in der Behandlung von schizophrenen oder neurotischen Patienten zwei globale Therapeutentypen A und B unterscheiden. Nun waren es nicht mehr vorwiegend Patientenvariablen oder Merkmale der jeweiligen Therapiemethode, denen das Interesse der Forscher galt. Der Schwerpunkt verlagerte sich jetzt zunehmend auf die Untersuchung der Persönlichkeit des Therapeuten, deren Bedeutung für günstige Behandlungsverläufe allmählich erkannt wurde (Beutler et al. 1995). Diese Untersuchung einzelner Merkmale der Therapeutenpersönlichkeit war ein bedeutender Fortschritt hin zu einer differenzierteren Betrachtungsweise des therapeutischen Prozesses; sie war jedoch spätestens nach der großen Literaturübersicht von Beutler et al. (1995, s. a. Kächele 1992) in dieser Form nicht mehr zu halten.
Insbesondere seit den Untersuchungen von Luborsky (1976, 1985) gilt die hilfreiche therapeutische Beziehung als der grundlegende und übergeordnete therapeutische Wirkfaktor, der weitaus mehr als einzelne Patienten-, Therapeuten- oder Methodenmerkmale über Erfolg oder Misserfolg von Behandlungen entscheidet (Kächele 1992, 2007, Orlinsky et al. 1995, Rudolf 1991). Es geht dabei im Wesentlichen um die Fähigkeit des Therapeuten, sich auf den jeweiligen Patienten einzustellen und zu ihm eine Beziehung aufzubauen, die dieser als therapeutisch hilfreich empfindet. Auf der Basis dieser Befunde konnte es nicht mehr als ausreichend angesehen werden, nur bestimmte als therapeutisch relevant geltende Interventionsstrategien wie beispielsweise Empathie, Kongruenz oder das Geben von Deutungen einzusetzen. Denn es kommt immer darauf an, dass auch der Patient ein bestimmtes Therapeutenverhalten als für sich und seine Entwicklung hilfreich empfindet. Obwohl das sehr eng mit der Störung und der Persönlichkeit des Patienten sowie mit bestimmten Merkmalen der Therapeutenpersönlichkeit zusammenhängt, kommt hier doch der Faktor der Interaktion zwischen beiden bestimmend hinzu. Ob eine hilfreiche und »heilende« (Frick 1996) Beziehung zwischen Therapeut und Patient entsteht, ist im Wesentlichen das Resultat eines interaktiven Prozesses zwischen ihnen (Luborsky et al. 1985).
Neuere Metaanalysen haben ergeben, dass bezüglich der therapeutischen Effektivität »einige Therapeuten relativ unabhängig von der Behandlungsausrichtung bessere Ergebnisse als andere erzielen« (Wampold et al. 2018, S. 229). Manchen Therapeuten gelingt es auch, über verschiedene Störungsbilder hinweg konstant gute Ergebnisse zu erzielen. Es stellt sich die Frage, was diese erfolgreichen Therapeuten anders als machen die weniger erfolgreichen. Vielfach wurde empirisch bestätigt, dass die unterschiedliche Wirksamkeit von Therapeuten nichts mit der Therapiemethode zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit des Therapeuten, mit den Patienten eine »therapeutische Allianz« (Gumz et al. 2018, Flückiger et al. 2015, Flückiger 2021) zu bilden. Die Psychotherapieforscher Wampold et al. (2015) fanden, »dass Therapeuten, die besser in der Lage sind, Allianzen mit Patienten zu formen, mit ihren Patienten zu besseren Ergebnissen in der Therapie kommen als andere Therapeuten« (S. 304). Zudem ist die Fähigkeit, über den gesamten Therapieprozess hinweg ein tragfähiges Arbeitsbündnis aufrechtzuhalten, von entscheidender Bedeutung. Diejenigen Therapeuten scheinen effektiver zu sein, die tragfähige Allianzen mit allen, auch mit schwierigen Patienten bilden und das tragfähige Arbeitsbündnis über die gesamte Therapie hinweg aufrecht halten können (a. a. O., S. 243, Wöller 2016). Sie schaffen es, Patienten länger in der Therapie zu halten und haben auch gute »interpersonelle Fähigkeiten, die insbesondere in schwierigen Therapiesituationen relevant sind« (Altmann et al. 2020, S. 445). Begriffe wie die therapeutische Allianz, die hilfreiche Beziehung oder das analytische Konzept des Arbeitsbündnisses (Greenson 1982a) stammen zwar aus verschiedenen Bereichen, sie beziehen sich jedoch alle auf etwas sehr ähnliches, nämlich einerseits auf das Bestehen einer emotionalen Bindung und andererseits auf eine mehr oder weniger explizite Einigung hinsichtlich der Ziele, Erwartungen und Vorgehensweisen in der Therapie.
In diesem Zusammenhang weist die Psychotherapieforschung der letzten Jahre eindeutig nach, dass dabei die interpersonelle Kompetenz des Therapeuten der entscheidende Faktor ist, der es ihm ermöglicht, auch mit schwierigen therapeutischen Situationen konstruktiv umzugehen. Diese interpersonelle und kommunikative Kompetenz (Buchholz 2017) erwies sich auch als der entscheidende Prädiktor für den Therapieerfolg (Hermer 2012, Körner 2013) und ist unabhängig von der praktizierten Therapiemethode (Gumz 2020). Auch Lambert (2010) fand einen großen Einfluss hilfreicher zwischenmenschlicher Fähigkeiten, die es dem Therapeuten erlauben, auch schwierige Beziehungssituationen gut zu bewältigen. Für Strupp (1989) »ist die größte Herausforderung, der der Therapeut gegenüber steht, die geschickte Handhabung des Enactments, das ihn häufig in die Defensive treibt und Langeweile, Irritation, Ärger und Feindseligkeit hervorruft und ihn unter Druck setzt, sodass er sich auf eine Art verhält, die mit seiner Haltung als einfühlsamer Zuhörer und Erklärender nicht vereinbar ist« (S. 719, zit. n. Schore 2003, S. 126). Die Ergebnisse von Willutzki et al. (2013) zeigen ebenfalls, dass »das interpersonelle Funktionsniveau und interpersonale Merkmale einschließlich der nonverbalen Kommunikation innerhalb der Sitzungen am wichtigsten zu sein« (S. 431) scheinen.
Читать дальше