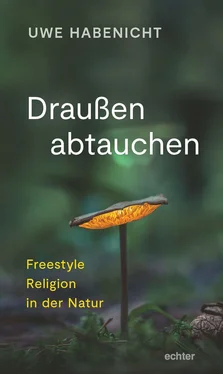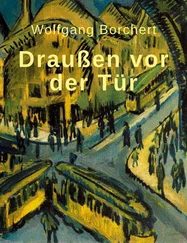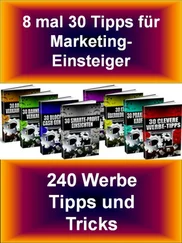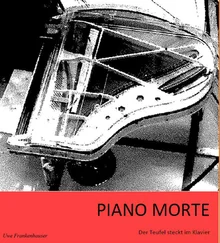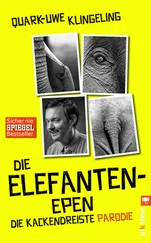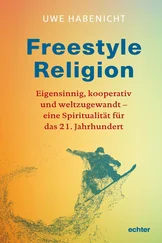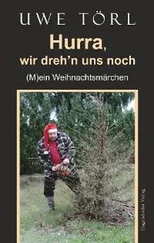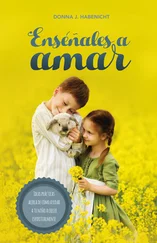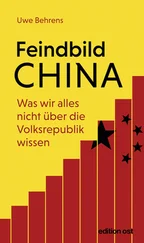3.Wegweiser durchs Blätterrauschen
Offenbar ist uns ist dieses Andere, das manche Gott nennen, im Alltagsgrau verlorengegangen, fast zumindest. Unterwegs auf unserer Reise durch die Zeit, in der wir das Grün der Wälder immer mehr durch Asphaltgrau ersetzt haben, muss er irgendwann außer Sichtweite gekommen sein, und der Zeitstrom hat ihn dann wohl davongetragen. Früher war er einfach so da, ungefragt und selbstverständlich, unseren Kinderhänden war er spürbar nah. Die Kinder und die Künstler wissen um seine Gegenwart. Paul Klee mit seiner bewahrten Kinderseele nennt ihn den „ Gott des nördlichen Waldes “ und lässt ihn zwischen den Grüntönen hervorschauen. Auch die Dichter lassen ihn zwischen ihren Wortzeilen wie zufällig immer mal wieder erscheinen. Aber uns ist das Grün der Frühzeit, das Lesen in den Zwischenräumen der Zeichenzeilen verlorengegangen. Wir haben alles mit dem Grauschleier des Rationalen überzogen, und dann ist da nichts mehr als dieses Mausetotgrau, in dem nichts erscheint und nichts sich bewegt. Aber das ist eine lange und verworrene Geschichte, die anderswo mit verschiedenen Überschriften (Säkularisierung, Rationalisierung, Moderne) oft schon nacherzählt wurde.
In jedem Fall ist es an der Zeit, ihn zu suchen in den lebendigen Farben der Erfahrung, die die Natur uns bietet. Denn er fehlt.
Dieses Buch unternimmt deshalb den Expeditionsversuch, den im Strom der Zeit und im Grau des Alltags fast verlorengegangenen Gott in der Natur wiederzufinden. Gott in der Natur zu suchen, ist ein waghalsiges Unterfangen. Wer weiß schon so genau, was das ist, „Gott“, und woran man ihn oder sie oder es erkennt. Gott in der Natur suchen, das klingt wie: Ich gehe in den Wald und suche nach Silphium, einer möglicherweise ausgestorbenen Heilpflanze, die in der Antike immer wieder erwähnt wurde. Gott ist kein Silphium und er ist ganz sicher nicht einfach so auf einer Lichtung zwischen Buchen zu finden. So müssen wir herausfinden, was wir meinen, wenn wir „Gott“ sagen. Und wir müssen nochmals die Orte aufsuchen, an denen er bis zu seinem zunehmenden Verschwinden erkennbar war, um überhaupt zu wissen, wonach wir suchen. Denn woran erkennen wir, dass wir ihn und nicht etwas anderes gefunden haben? Ist seine Nähe unverwechselbar spürbar? Was erfahren wir, wenn wir Gott begegnen? Schweigt er und ist seine Gegenwart einfach in einem vielsagenden Schweigen spürbar? Oder murmelt er wie der Bach oder rauscht er wie die Winde in den Wipfeln der Linden?
Die Natur galt lange als Ort der Gottesgegenwart, obwohl die Theologen das gar nicht gerne hören und es immer wieder bestritten haben. Und doch hat es immer mehr den Anschein, als suchten unsere grünsüchtigen Zeitgenossen nach ihm zwischen den Bäumen, auf den Hügeln und im Ruf des Waldkauzes. So viele gehen in die Natur und gehen doch alle anders dorthin. Welchen Zugang zur Natur brauchen wir, wenn wir Gott darin finden wollen? Gehen wir als Biologen oder Geologen, Philosophen, Achtsamkeitslehrer, Psychologen, Paläontologen oder Soziologen? Nehmen wir Lupe und Feldstecher, Spaten oder Leinwand und Farbe mit? Jeder wird in der Natur nur das entdecken, wonach er gesucht hat. Jede nur finden, was das eigene Instrumentarium hergibt. Vielleicht brauchen wir viele Begleiterinnen und Begleiter verschiedenster Profession, um besser zu verstehen, was es heißt, Gott zu suchen, und um den Erfahrungsraum Natur in seiner ganzen Weite zu ermessen.
Ganz gleich, wie wir es auch drehen und wenden, die offenen Fragen zu unserer Suche reißen nicht ab. Das muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Wir sollten uns nur darauf einstellen, dass für diese Suche viele Hindernisse überwunden werden müssen. Bloßes Nachdenken auf dem Sofa in herkömmlicher Weise wird nicht reichen. Wir werden tief, mit all unseren Sinnen, unserem ganzen Leib und allem, was wir über ihn hinaus noch spüren, abtauchen müssen, um eine Ahnung davon zu gewinnen, wonach wir suchen. Gott schwimmt nicht auf der Oberfläche, sonst wäre er längst gefunden. Wir werden abtauchen müssen, sehr tief sogar. Wir werden den Zwischenraum der Gottesgegenwart aufspüren müssen, jenen „Streifen Fruchtlands zwischen Strom und Gestein“ , den Rainer Maria Rilke poetisch beschreibt und den der Psychoanalytiker Donald Winnicott als „ intermediären Zwischenraum“ bezeichnet. Die Natur als Zwischenraum zu verstehen und als Buch, in dessen Zwischenräumen uns leiblich, wortlos und sprachlos „ göttliche Atmosphären“ ergreifen, wird eine wichtige Spur sein, der wir nachgehen, auch wenn dieser Bereich des Vorrationalen und Vorsprachlichen uns fremd geworden ist. Sehr wahrscheinlich müssen wir unser vertrautes Denken, das die Welt fein säuberlich in Subjekte und Objekte spaltet, hinter uns lassen, damit wir wieder zu dem finden, was vor und nach aller Spaltung immer schon da ist. Wir werden demnach unser herkömmliches Verhältnis zur Natur überdenken müssen, auch unser modernes Selbstverständnis als autonome Subjekte, und schließlich könnte es sein, dass wir all das, was wir meinten über Gott zu wissen, hinter uns lassen müssen. So geht es wohl überhaupt um einen neuen Zugang zur Wahrnehmung der Welt, Gottes und unser selbst. Und dafür ist die Natur ein ausgezeichneter Ort.
Der Naturphilosoph Gernot Böhme skizzierte die Herausforderung dazu in einem Zeitungsartikel so: „Wir Menschen sehen uns heute mit der riesigen Aufgabe konfrontiert, unser Verhältnis zur Natur neu zu organisieren. Der Klimawandel, der Rückgang der Artenvielfalt, der Verlust agrikulturell nutzbaren Bodens, die Störung oder gar Zerstörung natürlicher Reproduktionszyklen und schließlich die Verseuchung aller natürlichen Medien, von Luft, Wasser und Boden, verlangen Änderungen der menschlichen Weisen zu produzieren und zu konsumieren. Aber schon im Vorfeld solcher Anstrengung verlangen sie eine Änderung unserer Einstellungen zur Natur. Und hier kann die Naturästhetik ihren Beitrag leisten: Denn sie bedeutet ein Wissen von der Natur, bei dem der Mensch emotional beteiligt ist.“ 2
Unsere krisengeschüttelte Gegenwart steht vor immensen Aufgaben. Wer auf die Klimapolitik bzw. auf ihr Fehlen in den letzten Jahren blickt, bemerkt das Gefälle von großen Herausforderungen und kosmetischen Kleinstmaßnahmen zu ihrer Bewältigung. Offenbar sind wir überfordert. Aber nicht nur das Personal in Politik und Wirtschaft scheint überfordert, auch wir weniger Exponierten leiden an täglicher Überforderung. Das überforderte Subjekt wird zum neuen Typus der Gegenwart. Zunehmend entgleiten uns Raum und Zeit. Nicht nur, dass wir ständig und überall in Eile sind, nicht nur, dass wir angestrengt versuchen, den vielen gleichzeitig tickenden Uhren gerecht zu werden; wir sind müde und erschöpft, weil es uns nur mit größter Mühe gelingt, uns zu halten und nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Weil wir unablässig in Bewegung sind, Dinge in Bewegung setzen, Grenzen und Räume digital und anlog überwinden, kommen wir nie irgendwo wirklich an. Neben den Chronopathologien, der zeitlichen Überforderung, zu wenig in zu viel Zeit getan zu haben, kommt der Verlust des Raumes. Mit unserem Leib sind wir nie richtig da und lassen uns immer weniger auf die Atmosphäre des Raumes ein. Denn der Leib braucht Zeit, um sich einen Raum zu erschließen, Aufmerksamkeit und Gespür. Sonst fühlt er sich fremd. Und das Gefühl des Fremdseins und der Entfremdung gehört wohl ebenso zur Signatur unserer Zeit wie der Verlust des Raumes und die Beschleunigung der Zeit. „Überforderung stellt sich ein, wenn Subjekte trotz Mobilisierung aller Fähigkeiten und Ressourcen äußere und innere Anforderungen nicht mehr erfüllen können und zugleich diese Forderungen als fremd erfahren, ja sich ihnen ohnmächtig unterworfen fühlen.“ 3
Wenn Religion im 21. Jahrhundert weiterhin von Bedeutsamkeit sein soll, muss sie einen Beitrag zur Bewältigung dieser Überforderungskrise leisten. Dem überlasteten und Burnout-gefährdeten Subjekt kann Religion nicht noch mehr auflasten und auferlegen, den Druck nicht noch weiter erhöhen. Vielmehr muss relevante Religion dem überforderten Subjekt Zeit und Raum zurückgeben, so dass Zeit wieder als erfüllte Zeit und Räume als leibhaftig erlebte Räume erfahren werden können.
Читать дальше