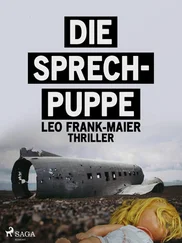Diese Einstellung führte dazu, dass drei von vier Schülern die 8-jährige Volksschule bis zu ihrem Ende besuchten. Mit zwei Lehrpersonen in zwei Klassen. Wie ging das?, werden sich heute viele fragen, die lediglich den Präsenzunterricht von einem Jahrgang in einer Klasse mit einer Lehrperson oder dem Teamteaching mit zwei Pädagogen sowie das Homeschooling kennen. Die junge Lehrerin unterrichtete in ihrer Klasse die Jahrgänge 1 bis 3 und der Direktor brachte den Schülern der Jahrgänge 4 bis 8 das Grundwissen bei. Die Lehrerin unterteilte die Jahrgänge in die Abteilung 1 mit den Schulanfängern und in die Abteilung 2 mit den Jahrgängen 2 und 3. Der Schuldirektor unterteilte wiederum seine Jahrgänge in die Abteilung 1 mit den Jahrgängen 4 und 5 und in die Abteilung 2 mit den Jahrgängen 6 bis 8. Während die Pädagogen die Schüler einer Abteilung unterrichteten, wurde den Schülern der anderen eine Aufgabe gestellt und umgekehrt. Das bedeutete, dass die Jahrgänge 2 und 3 sowie 4 und 5 zwei Jahre und die Jahrgänge 7 bis 8 drei Jahre lang im Wesentlichen dasselbe präsentiert bekamen. Der Unterrichtsstoff war wenig, jedoch die geistige Verankerung durch das mehrmalige Wiederholen dauerhaft. Wettrechnen war eine sehr beliebte Methode des Direktors, um kognitive Fähigkeiten und logisches Denken bei den Schülern herauszufinden, und beeinflusste auch die Mathematikbenotung. Dabei stellte er verbal eine Rechenaufgabe und wer sie am schnellsten gelöst hatte, lief mit dem Ergebnis zu ihm und bekam ein Hakerl oder eine Eins. Martin musste sich in dieser Disziplin nur selten geschlagen geben.
Die pädagogischen und didaktischen Methoden von damals unterscheiden sich erheblich von den heutigen. Jede Woche wurden zwei Schüler verpflichtet für den Klassendienst: Die Tafel musste gelöscht werden und im Winter waren Holzspäne zum Anzünden des Klassenofens zu hacken, Brennholz in die Klasse zu tragen und die Aschenlade war zu leeren. Vor Unterrichtsbeginn mussten täglich die „Klassendienstler“ in Ermangelung von Fließwasser frisches Wasser von einer Handwasserpumpe in einem Lavoir bereitstellen. Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, musste nach Schulschluss mindestens eine Stunde in der Klasse nachsitzen und irgendetwas abschreiben oder das Einmaleins auswendig lernen. Kleinere disziplinäre Vergehen wie Schwätzen oder Abschreiben ahndete der Direktor meist durch Schläge mit dem Lineal auf die Finger oder durch Ziehen an den Haaren.
Der Schuldirektor hatte in Geschichte nie über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und wenn die schrecklichen Kriegsereignisse trotzdem thematisiert wurden, beendete er die Diskussion mit dem Hinweis, dass die Schüler keine Ahnung davon hätten. Das war zwar richtig, aber kein Grund, nicht mehr darüber zu erfahren. Vielleicht war seine Zurückhaltung sogar besser, da den Schülern eine sehr subjektive Sichtweise vermittelt worden wäre. Augenscheinlicher wurde seine frühere politische Einstellung beim Turnunterricht. Geräteturnen war wegen der fehlenden Geräte nicht möglich. Statt Kastenspringen hüpften die Schüler laufend über ihre vorderen Kollegen, die einen „Bock“ machten. Begonnen wurde aber jede Turnstunde der Buben mit dem Antreten in einer Reihe und der Größe nach. Mit „Habt acht!“ und „Rechts um!“ ging es im Laufschritt rund um die Tische im Klassenzimmer. Dabei mussten die Schüler über den Haselnussstab, den der Direktor in einer Höhe von 50 bis 60 cm hielt, springen. Wer das nicht schaffte, bekam den „Herrn von Haselnuss“ zu spüren. Nur alle zwei Jahre gab es am provisorischen Fußballfeld eine Leichtathletik-Turnstunde, die Martin besonders liebte. Körperliche Ertüchtigung eigneten sich die Buben ohnedies auch in der einstündigen Mittagspause auf der „Blutwiese“ an, einer Wiese in Schulnähe, wo die Halbwüchsigen durch unblutige Raufereien ihre Rangordnung herstellten. Rangordnungen in Gesellschaften sind auch heute noch festzustellen. Allerdings weniger in Form von körperlicher Kraft, sondern die eher durch Bildungs- und Vermögensunterschiede, die vornehmlich durch Markenklamotten, Smartphones u. dgl. dokumentiert werden.
Eröffnung des Kirchenwirtes
Das Bauerngasthaus neben der Kirche schloss Anfang der 50er Jahre seine Pforten. Damit gab es im unmittelbaren Umkreis der Kirche kein Gasthaus mehr, wohin sich die Männer am Sonntag nach dem Gottesdienst zurückziehen konnten, um ihren Frauen bei der Zubereitung des Sonntagsbratens nicht im Wege zu stehen bzw. ihnen die volle Entfaltungsmöglichkeit geben zu können. Angesichts dieser von der Männerwelt sehr positiv empfundenen Nebeneffekte wurde der Besuch der Sonntagsmesse in Kauf genommen. Diese Beweggründe hatte der Pfarrer, neben dem Lehrer der einzige „Gstudierte“ im Ort, rasch erkannt und drängte Ludwig und Johanna ein Gasthaus zu eröffnen. Vor allem war ihm wichtig, dass Gösser Bier ausgeschenkt wird, was ihm selbst vermutlich am besten schmeckte. Als gläubige Menschen beugten sich Ludwig und Johanna den Wünschen des Botschafters Gottes auf Erden und eröffneten 1956 ihr Gasthaus neben der Kirche in der Annahme, dass mit kirchlichem Beistand nichts schiefgehen könne. Wie vermutet war das Gasthaus am Sonntag nach der Messe gut besucht. Bier und eine kleine Jause in Form von Würstel oder Gulasch ließen die mahnenden Worte des Pfarrers in seiner Predigt leichter verdauen. Überdies erfolgte in dieser medienarmen Zeit der Informationsaustausch vornehmlich in Dialogen, die nicht selten zu leidenschaftlichen Debatten über die besten Auto- oder Traktormarken führten.
Soziologisch interessant ist das Phänomen der Gruppierung der Gasthausbesucher:
Da gab es den Bürgertisch, an dem der Pfarrer, der Schuldirektor, der Bürgermeister, der Jagdleiter und die „größeren Bauern“ saßen (Bauern mit den meisten Grundflächen).
Am Jungbauerntisch saßen die visionären Bauernsöhne, die in absehbarer Zeit den Hof der Eltern übernehmen sollten oder aus der Landwirtschaft ausscheiden mussten, und diskutierten heiß über die technischen Entwicklungen und ihre künftigen Möglichkeiten. Die eigene Traktor- oder Mähdreschermarke war stets die beste und die Vorzüge der eigenen Landmaschinen wurden mit großer Leidenschaft diskutiert.
Der Arbeitertisch war der Platz für die unselbständigen Männer und dort bildeten vorwiegend Arbeitnehmerrechte und dementsprechend politische Forderungen die Gesprächsgrundlage. Vielfach waren diese Themen auch eine Möglichkeit, die eigene Qualifikation oder den beruflichen Erfolg in der Runde bekannter zu machen, um das Image steigern zu können.
Am Junggesellentisch nahmen mehrheitlich Junggesellen Platz (der Begriff Singles war noch unbekannt): Männer in allen Altersstufen und solche, die in Ermangelung von ausreichendem Selbstbewusstsein sich eher zu der wenig erfolgreichen Gruppe gesellten. Dieser Tisch stand am Eingang in die Gaststube und ersparte diesen Männern den Gang durch die gesamte Gaststube und von allen angesehen zu werden, ein Phänomen, das heute noch bei Besuchern von Vorträgen und Konzerten zu beobachten ist.
Diese nicht vorgegebene Sitzordnung blieb über Jahrzehnte als Verhaltensmuster unverändert und erhielt durch die vielen Wiederholungen sogar noch einen Verstärkereffekt. Ausnahmen bildeten lediglich Personen, die sich in einer Debatte nicht verstanden oder persönlich beleidigt fühlten und sich vorübergehend oder dauerhaft einer anderen Tischgruppe zuordneten. Sozialpsychologisch ist bekannt, dass Personen gefühlsmäßig jene Tischrunde bevorzugen, an der sie einen übereinstimmenden Meinungsaustausch mit ähnlichen Zielen und Meinungen erwarten dürfen. Umgekehrt führt eine Divergenz in der Kommunikation zu kognitiven Dissonanzen, also einem erkenntnismäßigen Unbehagen, das es allgemein zu vermeiden gilt. Daher wird von vielen Diskussionsteilnehmern im Gespräch versucht, andere Meinungen mit der eigenen in Einklang zu bringen.
Читать дальше