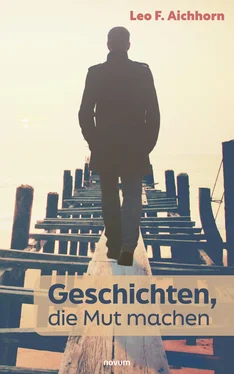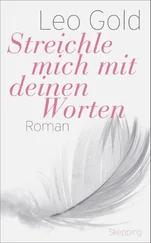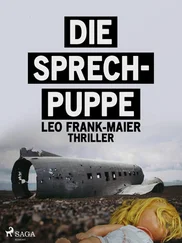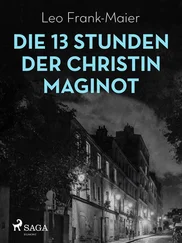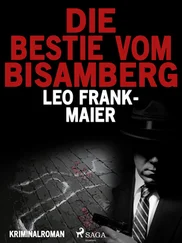Kinderarbeit infolge Landflucht
Mit Beginn der 60er Jahre im 20. Jahrhundert erhielt die maschinelle Entwicklung in der Landwirtschaft eine noch nie da gewesene Dynamik. Die Traktoren wurden größer und bekamen drei oder vier Zylinder, die ersten Mähdrescher und Ladegeräte wurden auf Bauernmärkte mit Volksfestcharakter präsentiert und veränderten die landwirtschaftliche Arbeit enorm. Die Mähdrescher trennten schon am Feld die Getreidekörner vom Stroh. Die Ladegeräte transportierten das Heu, das Stroh oder die schweren Blätter von Zuckerrüben mittels einer „Pick-up-Vorrichtung“ und eines Förderbands auf den nachgezogenen Traktoranhänger. Vereinzelt waren schon Melkmaschinen im Einsatz und entleerten die Euter der Milchkühe ohne Handarbeit. Melklehrer wurden mit einem Schlag arbeitslos.

Die menschliche Arbeitskraft wurde zwar nicht zur Gänze, aber im hohen Maße durch halbautomatische Maschinen entbehrlich. Die Abwanderung der Landarbeiter in den produzierenden Sektor wurde insbesondere durch die starke Industrialisierung vorangetrieben. Der Glaube an das eigene Land und nicht zuletzt der Wiederaufbauplan ERP (European Recovery Programm – „Marshall-Plan“) der USA schafften ein Wirtschaftswunder namens „Golden Age“ in Europa. Nachdem sich die Kriegsindustrie in eine Technologie- und Konsumgüterindustrie umgewandelt hatte, tausende Autos von den Fließbändern rollten und die Fabrikarbeiter allein mit ihrem Urlaubsgeld in den Süden fahren konnten, war das Arbeiten in der schlecht bezahlten Landwirtschaft für die meisten keine Alternative mehr. Arbeiteten zu Beginn der 50er Jahre noch 33 Prozent5 der Erwerbstätigen im primären Sektor, so waren es knapp 60 Jahre später nur mehr 4,3 Prozent6, die Freude an der landwirtschaftlichen Arbeit fanden. Ohne die Industrialisierung der Landwirtschaft wäre die Industrielle Revolution nicht möglich gewesen, da nicht genug Hände und Köpfe für die Fabriken und Dienstleistungsbetriebe zur Verfügung gestanden hätten.
Dieser Strukturwandel stellte die Landwirte vor kaum bewältigbare Herausforderungen. Auch die aus dem Mühlviertel stammende Magd Manuela und der aus Mittersill angereiste Knecht Heinz verließen 1960 den Hof von Ludwig und Johanna, obwohl sie sich hier wohlgefühlt hatten. Manuela war groß, für eine Frau unheimlich kräftig, und hatte riesigen Spaß, wenn sie den wohl kernigen, aber kleineren Dienstbotenkollegen Heinz ihre überlegene Stärke etwa beim händischen Lufteinpumpen von Anhängerreifen zeigen konnte. Manuela war schon zuvor der Liebe ihres Lebens begegnet und gründete mit dem etwas älteren Herrn aus der übernächsten Gemeinde eine Familie. Auch für Heinz war es ein „herzlicher Abschied“, da auch er zu seiner Angebeteten zog und künftig sein Geld in einem Industrieunternehmen verdiente. Dieser personelle Abgang konnte nicht allein durch den maschinellen Einsatz kompensiert werden. Im selben Jahre beendete der adoptierte Sohn Andreas seine 8-jährige Pflichtschulzeit und trat als Landwirtschaftslehrling in den Dienst seiner Eltern. Für arbeitsintensive Zeiten wie etwa im Frühling das Vereinzelnen der zahlreich aufgegangenen Zuckerrüben- und Zichoriepflänzchen (Einkornsamen wurden erst später gezüchtet), das Aufklauben von maschinell freigelegten Zuckerrüben, Kartoffeln und dem von den Bäumen heruntergefallenen Mostobst im Herbst wurden Hausfrauen aus dem Ort als Tagelöhnerinnen engagiert. Später verstärkte noch Gabriele mit ihren Händen den Familienbetrieb, bevor sie und ihr älterer Bruder Andreas sich nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten umsehen mussten.
Große Erwartung hatten Ludwig und Johanna auf Martin gesetzt, der als ältester gemeinsamer Sohn als Hoferbe vorgesehen war und daher nicht früh genug mit der verantwortungsvollen Aufgabe eines Landwirtes vertraut werden konnte. Vor allem aber auch seine Geschicklichkeit beim Traktorfahren war Ursache für das nicht selten vorzeitige Ende des Schultages, wenn Johanna vormittags in die Schule ging und dem Direktor eröffnete, dass Martin zum Pflügen oder Eggen benötigt wird. Diesem Begehren kam der damalige Schuldirektor nicht ungerne nach, wurde doch sein Entgegenkommen am sonntägigen Stammtisch meist mit einem oder mehreren Gläsern Rotwein honoriert. Auch beim „Saustechen“ dachte man an die guten Beziehungen zur Schuldirektion und legte ein schönes Stück Fleisch für sie zur Seite. Die Frau des Schuldirektors, von allen Menschen in der Gemeinde als Frau Direktor angesprochen, nahm sich als Tochter eines Fleischhauers der weiteren Verarbeitung gerne an. An den Tagen ohne vorzeitiges Ende des Unterrichts wurde Martin zu Hause die Schultasche abgenommen und ihm die Tasche mit einem gewässerten Most, eingehüllt in ein nasskaltes Tuch zur Kühlung, ausgehändigt. Damit wurde er aufs Feld geschickt. Dort musste er mitarbeiten bis abends und fiel nicht selten erschöpft ins Bett.
Martin hatte oft nicht einmal Zeit, seine Hausaufgaben zu machen. Durch seinen leichten Schlaf stand er oft zu einer Zeit auf, wo noch Gäste anwesend waren, und legte sich wieder in das Bett. Nicht selten stand er um 2 oder 3 Uhr früh auf und machte bei Kerzenlicht seine Hausaufgaben. Erst danach konnte er wieder einschlafen. Schon mit sechs Jahren wurde Martin Ministrant und führte mit dem Pfarrer den liturgischen Dialog in lateinischer Sprache. Des Öfteren wurde er kurz vor 07:00 Uhr geweckt, wenn der Mesner zur Mutter lief und Martin als Ministrant für die tägliche Messe verlangte. Erst das 2. Vatikanische Konzil, das 1965 endete und u. a. den Priestern die Hinwendung zu den Kirchenbesuchern und den Dialog mit ihnen erlaubte, ermöglichte auch die Messfeier in der jeweiligen Landessprache. Damit wurden die Ministranten vom „kleinen Latinum“ befreit und der überwiegende Teil der Kirchenbesucher verstand erstmals, was hier eigentlich gebetet wurde. Ein ähnlicher Vorgang wie die Übersetzung der Bibel vom Lateinischen ins Deutsche durch Martin Luther. Für Martin kam diese Änderung zu spät, da er 1964 nach acht Jahren Kirchendienst ausscheiden musste. Andererseits beherrschte er die lateinischen Texte im Zwiegespräch mit dem Priester längst perfekt. An Wochentagen gab es nur stille Messen ohne Orgelmusik oder gesangliche Begleitung. Entsprechend der gotischen Architektur war es an Tagen mit geringem Sonnenschein in der Kirche sehr finster und die wenigen, meist älteren Frauen mit ihren dunklen Kleidern waren kaum sichtbar – und hörbar schon gar nicht. Es hatte etwas Gespenstisches. Um 07:30 Uhr war die Messe aus und Martin lief nach Hause, um sich vor dem um 08:00 Uhr beginnenden Schulunterricht noch schnell am Frühstückstisch zu laben.
Ministrant zu sein bedeutete nicht nur eine liturgische Verpflichtung bei einer Messfeier, sondern auch einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten anzugehören und für Gott und die Kirche etwas Positives zu leisten. Und alternative Gemeinschaften für Kinder und Jugendliche gab es in der kleinen Gemeinde ohnehin nicht. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten traten Martin und viele seiner Freunde der Katholischen Jungschar bei. Spielerisch und singend lernten sie die religiösen Werte kennen und wurden ermuntert, nach diesen Wertvorstellungen zu leben. Unvergesslich für Martin blieben ihre Aktivitäten, die von der Diözese Linz veranstaltet wurden. Einige Tage auf einer alten Burg im oberösterreichischen Kremstal wurden für alle 8- bis 10-Jährigen zum unvergesslichen Erlebnis. Die geisterhaften Nächte zwischen den Burgmauern, die nächtlichen und angsteinflößenden Entdeckungsmärsche durch den Wald sowie der Badeausflug über den bewaldeten Berg in die 12° Celsius kalte Steyr waren weitreichende Lernprozesse und unvergessliche Erlebnisse. Ebenso die Österreichische Jugend-Olympiade in der Steiermark, an der Martin mit seinem Freund Joachim teilnehmen durfte. Mehr als 2.000 Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren aus allen Teilen des Landes nahmen an den sportlichen Wettkämpfen mit großem Eifer teil. Die Jugendlichen schliefen in Zelten, wo sie sich auch von ihrem sportlichen Wettbewerben erholten. Martin und Joachim konnten sich mangels eines Trainers und mangels verfügbarer Trainingsgeräte nur für den 60 m-Lauf und im Schlagball vorbereiten, wo sie nicht so schlecht abschnitten. Im Schwimmen war Martin durch sein Donautraining ziemlich gut, als er auf dem dortigen Schwimmteich neben einer Ringelnatter seine Distanz bewältigte und schneller als sie war. Wie hoch dabei der Angstfaktor war, wurde nie erforscht.
Читать дальше