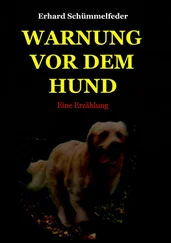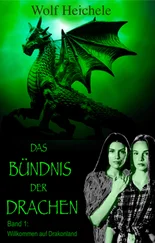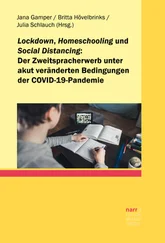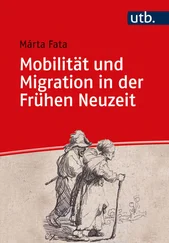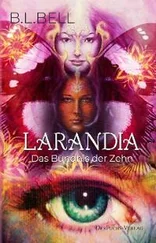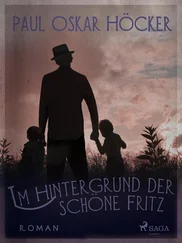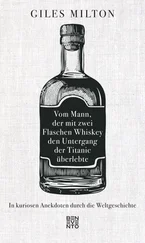Im Zuge seiner Überlegungen zur Problematik historischer Schrifterzeugnisse führt Oesterreicher (1998:26–27) noch einen weiteren Begriff ein, nämlich den der Textzentrierung . Darunter versteht er einen „schriftkulturelle[n] Prozeß, bei dem die ‚Ausblendung‘ der mit Diskursen ursprünglich verbundenen Vielfalt semiotischer Ausdrucksmodalitäten sich historisch sukzessive fixieren und diskurstraditionell festschreiben kann“ (Oesterreicher 1988:26). Dabei geht es vor allem um die beispielsweise in der mittelalterlichen Dichtung sichtbar werdenden Verfahren bei der Herausbildung von schriftlichen Diskurstraditionen, die zum Teil auf mündlichen Vorläufern basieren. In diesem Prozeß der Neukonstituierung treten bestimmte semiotische Verfahren eines Nähediskurses in den Hintergrund, während andererseits Textualitätsanteile zunehmen (Oesterreicher 1998:27).
Ohne prinzipiell diesen Prozeß und die damit verbundenen Veränderungen in der Kommunikation in Abrede stellen zu wollen, erscheint doch der wesentlichere Aspekt dieser beiden, die Oesterreicher (1998:27) „wohlunterschieden“ wissen möchte, derjenige der Rekontextualisierung zu sein. Aus diesem Grund soll dieses Prinzip, welches wichtige hermeneutische Verfahren impliziert, auch in vorliegender Untersuchung zentraler Bestandteil sein und als „Gegengewicht“ zu einer rein nach modernen linguistischen Termini ausgerichteten Textinterpretation (cf. Kap. 3.1) fungieren.
Im Rahmen der in der einleitenden Zielsetzung beschriebenen Methodik des Vorgehens in Bezug auf die Analyse der frühneuzeitlichen Texte (cf. Kap. 1.4) bildet die Herangehensweise mittels aktueller varietätenlinguistischer und soziolinguistischer Begrifflichkeiten, deren Grundlagen bereits erläutert wurden (cf. Kap. 3.1), den Fokus vorliegender Untersuchung. Eine rein auf dieser Methode fußende Analyse würde jedoch Gefahr laufen, voreilige oder ganz allgemein zu kurz greifende Ergebnisse zu folgern, vor allem im Hinblick auf eine womöglich überinterpretierte Modernität – im Sinne eines aktuellen linguistischen Verständnisses – der untersuchten Texte. Daher ist die hier vorgestellte Rekontextualisierung, im Sinne einer adäquaten zeitgeschichtlichen Verortung – und diese impliziert allgemein historische Epochenbezüge genauso wie spezifisch literarische –, unabdingbar, um eine geistesgeschichtliche Entwicklung, wie hier geplant, nachzuzeichnen. Diese Rekontextualisierung, wie sie von Oesterreicher (1998) im Hinblick auf eine sprachwissenschaftliche Nutzbarkeit hin konzipiert wurde, ist dabei nicht denkbar ohne die Tradition der klassischen Hermeneutik, spricht er doch selbst von der „Hermeneutik der Rekontextualisierung“ (Oesterreicher 1998:21).147
Unabhängig von den bei Oesterreicher nur kursorisch angesprochenen Bezügen zu dieser Disziplin, schien es daher notwendig, einige entscheidende Aspekte der hermeneutischen Analyse aufzugreifen. Dabei ging es nicht darum, sich dezidiert einem der großen Klassiker (Schleiermacher et al.) anzuschließen, sondern Überlegungen herauszustellen, die ganz konkreten Nutzen für die vorliegende diachrone Konstellation der Textinterpretation haben und als methodische Grundpfeiler fungieren können.
Die Arbeit mit Texten einer vergangenen Epoche zwingt einen somit unter Beachtung grundlegender hermeneutischer Prinzipien dazu, Relationen wie Vorstellungen bzw. Denkprozesse, Schriftzeugnisse, sprachliche Realisierung und zeitgenössischen Diskurs nur mit äußerster Vorsicht in Bezug zueinander zu setzen bzw. immer wieder neu zu überdenken und zu hinterfragen. Dieser Versuch einer Verankerung und Verortung der Korpustexte soll aus diesem Grund den zweiten methodischen Pfeiler vorliegender Untersuchung bilden und unter dem Schlagwort der Rekontextualisierung figurieren.
Das konkrete Vorgehen im Einzelnen ist dabei natürlich abhängig von der Art des Textes, seiner Strukturierung, seiner Intentionalität und seiner Bedeutung innerhalb des Diskurses. Ganz allgemein besteht das Ziel darin, jeden Text des Korpus in seinem zeitgeschichtlichen Kontext adäquat zu verorten. Bei dieser Vorgehensweise, die eine exakte Lektüre und eine umsichtige, aber dennoch dezidierte Interpretation beinhaltet, sollen die vorgestellten hermeneutischen Verfahren eine methodisch wichtige Grundlage bilden. Es geht letztendlich darum, den gegebenen Text so zu interpretieren, daß alle für die vorliegende Fragestellung relevanten Bezüge aufgedeckt werden, d.h. das untersuchte Traktat ist daraufhin zu bestimmen, welchen Platz es in der geschilderten Debatte um das Latein der Antike einnimmt, in welcher Relation es zu den anderen an diesem Disput involvierten Texten (und Autoren) steht, welche historische gesellschaftspolitische Implikationen hierbei zum Tragen kommen, welche grundlegende Zielsetzung bzw. Intentionalität ermittelt werden kann, im Rahmen welcher Diskurstradition es verfaßt wurde bzw. welche Textsorte oder Textgattung vorliegt und welche Versprachlichungsstrategien damit verbunden sind bzw. welcher stilistische Duktus damit einhergeht. Dies sei nur beispielhaft dafür angeführt, was es zu beachten gilt, wenn es darum geht, die Aufgabe der Rekontextualisierung durchzuführen. Dabei soll allerdings nicht eine Analyse der aufgezeigten Aspekte in vollem Umfang angestrebt, also z.B. alle intra- und intertextuellen Bezüge aufgezeigt werden, sondern nur solche die für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung von Relevanz sind und die dabei helfen, den untersuchten Text in seiner Entstehungszeit und seinen historischen Kommunikationsraum angemessen einzuordnen und ihn damit so zu verstehen, wie er intendiert wurde.
4. Die Architektur des Lateins
Nachdem im vorherigen Kapitel zur Methodik der Vorgehensweise die beiden Untersuchungsebenen für die vorliegende Analyse der frühneuzeitlichen Traktatliteratur vorgestellt wurden (cf. Kap. 3) und dabei im Rahmen der varietäten- und soziolinguistischen Theorie auch ein Entwurf für ein allgemein applizierbares diasystematisches Beschreibungsmodell ausgearbeitet wurde (Kap. 3.1.3), soll nun im Folgenden eine Bestandsaufnahme der Architektur des Lateins geleistet werden. Es handelt sich demnach um den Versuch, die Varietätenvielfalt des Lateins in der Antike aus moderner linguistischer Perspektive so adäquat wie möglich zu erfassen und zu beschreiben.
Der Fokus sei dabei auf das Latein der Antike gerichtet, also aus soziolinguistischer Perspektive auf seine Entwicklung bezüglich des Ausbaus als lingua viva und sein Verhältnis zu den Kontaktsprachen (Diglossie, Mehrsprachigkeit) sowie aus varietätenlinguistischer Perspektive auf seine Architektur. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht wie in der Literaturgeschichte auf der Zeit des Klassischen und Nachklassischen Lateins, sondern auf der Entstehungsphase, in der die Herausbildung von bestimmten schriftsprachlichen Diskurstraditionen und der damit zusammenhängende erste Ausbau der Sprache stattfindet (cf. Kap. 4.1).148
Weieterhin soll aber auch ein Ausblick gegeben werden auf die weitere Geschichte – d.h. in erster Linie externe – des Lateinischen im Mittelalter, seinen Übergang von einer lebendigen Sprache zu einer immer weiter erstarrenden, d.h. seine Transformation von einer lingua viva in eine lingua morta viva bzw. später in eine lingua morta (cf. Kap. 4.2).149
Im Rahmen dieses Versuches, die aktuellen sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Frage der Differenziertheit des Lateins auf verschiedenen diasystematischen Ebenen zu synthetisieren, soll schließlich zur Verdeutlichung der zuvor entworfene Beschreibungsrahmen, der auf der Basis der Modelle von Coseriu und Koch/Oesterreicher beruht (cf. Kap. 3.1.3), auf die Situation des antiken Lateins angewandt werden (cf. Kap. 4.3).
4.1 Lingua viva : Latein in der Antike
Читать дальше