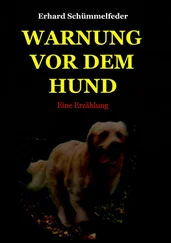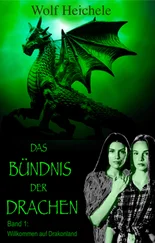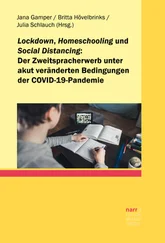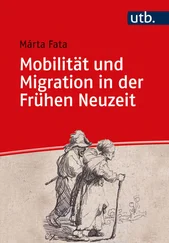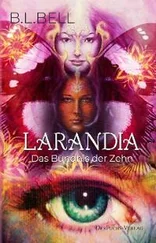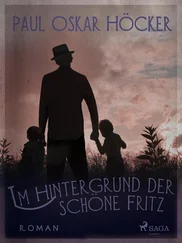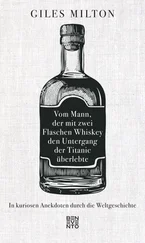Dies ist für vorliegende Untersuchung insofern relevant, da aus den Traktaten des Korpus, die ja mit je unterschiedlichen Zielsetzungen (literaturtheoretische, historiographische, sprachtheoretische, etc.) konzipiert wurden und keine literarischen Produkte im engsten Sinne sind, der jeweilige Kenntnisstand in der Debatte um das antike Latein herausgelesen werden soll, d.h. als historische Fakten eines Diskurses zu rekonstruieren ist.
Anschließend an diese kursorischen Ausführungen zur Hermeneutik, die in erster Linie dem Traditionsstrang der traditionell verstandenen Philologie zuzurechnen ist, aber auch in anderen Disziplinen gewinnbringend Anwendung findet,138 sollen nun die disiecta membra der Literatur- und Sprachwissenschaft wieder zusammengeführt werden und zusätzlich Aspekte der Nützlichkeit dieser Vorgehensweise auch für die linguistische Analyse herausgestellt werden.139
Auf bestimmte Konvergenzen beider Fachdisziplinen hat auch Leo Spitzer (1887–1960) hingewiesen, der sich in seinen Schriften oft sowohl mit literaturwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt hat als auch mit solchen der schwer einzuordnenden Stilistik. In seinem erstmals auf Englisch erschienen Buch Linguistics and Literary History (1948) gibt er in seinem einleitenden Aufsatz einige wichtige, eher praxisorientierte Leitgedanken zum Umgang mit literarischen Texten.
Warum behaupte ich so nachdrücklich, daß es unmöglich ist, dem Leser eine schrittweise Anleitung zum Verständnis eines Kunstwerks an die Hand zu geben? In erster Linie, weil der erste Schritt, von dem alles abhängen kann, nie im Vorhinein geplant werden kann: er muß schon stattgefunden haben. (Spitzer 1969:31)
Im Weiteren präzisiert Spitzer (1969:31) diesen ersten Schritt, der darin bestehen sollte, daß man über ein bestimmtes Detail eine Erkenntnis gewinnt, sodann diese mit dem gesamten literarischen (Kunst)Werk in Relation setzt, dazu eine Theorie konzipiert und aus dieser Konstellation heraus eine bestimmte Fragestellung an den Text heranträgt. Voraussetzung ist dabei nicht nur eine gewisse Erfahrung, Begabung und ein methodisches Vorgehen, sondern auch ein wiederholtes Lesen. Die Untersuchung eines Textes ist dabei von einer gewissen Zirkularität geprägt, denn erst wenn für einen bereits einen Zugang besteht, kann man weiteren bzw. tieferen Zugang erlangen, was er tautologisch dahingehend synthetisiert, „daß Lesen wirklich bedeutet, gelesen zu haben, und daß Verstehen bedeutet, verstanden zu haben“ (Spitzer 1969:32).140
Ein anderer wichtiger Hinweis Spitzers in Bezug auf das hermeneutische Vorgehen ist in der Mahnung zur Vorsicht bei der Analyse verschiedener Kunstwerke zu sehen, da die Verschlüsselung durch die Sprache eine je spezifische darstellt.
Der Grund dafür, daß der Schlüssel zum Verständnis nicht mechanisch von einem Kunstwerk auf das andere übertragen werden kann, liegt in der künstlerischen Ausdrucksweise selbst. (Spitzer 1969:33)
Dieser Gedanke ist insofern von Belang, als bei einer Analyse jeder Text und vor allem Texte verschiedener Produzenten immer wieder auf die Art ihrer Zugänglichkeit hin befragt werden müssen oder konkreter ausgedrückt: Ist die applizierte Methode in vorliegendem Fall noch valide oder womöglich zu variieren?
Spitzers Ausführungen sind dabei unabhängig davon zu sehen, ob die Frage einen eher literaturwissenschaftlichen oder sprachwissenschaftlichen Hintergrund hat, und somit für vorliegende Untersuchung in jedem Fall von Relevanz. Die Erarbeitung einer Fragestellung, die nicht ohne vorheriges Sich-Auseinander-Setzen mit dem schriftlichen, künstlerischen Produkt – dazu zählt auch ein Traktat – möglich ist, soll hier genauso Beachtung finden wie die Berücksichtigung der sprachlichen (bzw. stilistischen) Implikationen der je einzelnen Texte, die unter Umständen eine andere Herangehensweise erfordern könnten.
Zuletzt sei nun auf den bereits mehrfach formulierten (cf. Kap. 1) zentralen Aspekt der hier geplanten analytischen Methode eingegangen, nämlich auf die Rekontextualisierung . Diesen Terminus verwendet Oesterreicher (1998:21–22) mit Rückgriff auf Fleischman (1990:37) als Schlüsselbegriff,141 um auf die Bedeutung der notwendigen Rekonstruktion des Kommunikationsraumes (bzw. des Produktions- und Rezeptionskontextes), in dem ein historischer Text einst funktionierte, hinzuweisen. Seine Herangehensweise ist vor dem Hintergrund des von ihm mitentwickelten Konzeptes von Nähe-Distanz zu sehen (cf. Koch/Oesterreicher 2011), so daß für ihn die zentrale Frage zunächst lautet, welche Kommunikationsbedingungen bei einem bestimmten Text anzusetzen sind (cf. Kap. 3.1.1). Jeder Diskurs und jeder Text ist eingebettet in einen bestimmten Handlungszusammenhang mit wiederum spezifischen Kommunikationsbedingungen wie ‚Grad der Öffentlichkeit‘, ‚Grad der Vertrautheit der Partner‘, ‚Grad der emotionalen Beteiligung‘ und ’physischen Nähe der Kommunikationspartner‘, ‚Grad der Kooperation‘, ‚Grad der Dialogizität‘142 oder ‚Grad der Themenfixierung‘.143 Während (mündliche) Nähediskurse im Allgemeinen stark von einer außersprachlichen Situations- und Handlungseinbettung gekennzeichnet sind, so daß deren Bedeutung nur unter Kenntnis dieses Kotextes rekonstruierbar ist, sind (schriftliche) Distanzdiskurse prinzipiell mit expliziteren Referenzbezügen ausgestattet. Handelt es sich jedoch um Schriftprodukte, deren Entstehungszeit nicht mehr ohne weiteres mit den aktuellen Parametern bestimmt werden kann, so kann sich die adäquate Einordnung – insbesondere von literarischen Texten, aber auch von juristischen, historiographischen, theologischen und anderen komplexen Gebrauchstexten – deutlich schwieriger gestalten.144 Dies liegt unter anderem daran, daß vor allem bei historisch weiter zurückliegenden Kommunikationssituationen, in denen einst ein bestimmter Text eingebettet war, die Beleglage für die Zeit womöglich lückenhaft ist – sicherlich jedoch in irgendeiner Weise defizitär. Ganz prinzipiell ist es jedoch auch der Tatsache geschuldet, daß es bei schriftlich niedergelegten Diskursen immer zu einer, wie es Oesterreicher (1998:22) nennt, „raum-zeitliche[n] Entkoppelung der Kommunikationssituation“ kommt oder, wie es Ehlich (2010:542) ausdrückt, zu einer „zerdehnten Sprechsituation“. Aus dieser Konstellation heraus plädiert Oesterreicher für eine umso größere Notwendigkeit, diachrone Schriftzeugnisse in ihre ursprüngliche Kommunikationssituation zu rekontextualisieren:
Die texthermeneutische Frage stellt sich jedoch insofern verschärft, als sich unter Umständen keine oder nur unvollständige oder einfach zu wenig historische Informationen zum jeweiligen kommunikativen Geschehen beibringen lassen. Trotzdem sind diese Texte grundsätzlich daraufhin zu befragen, wie sich ihre uns vorliegende schriftlich fixierte Form zu einem originären kommunikativen Geschehen verhält, das in der Regel zumindest in seiner Grundstruktur rekonstruiert werden kann. Den allgemein hermeneutisch zu konzipierenden Prozeß dieser Rekonstruktion der verschiedenen semiotischen Bezüge der Texte durch den Betrachter bezeichne ich im folgenden als Rekontextualisierung , die teilweise auch als eine Re-Inszenierung von Texten verstanden werden kann. (Oesterreicher 1998:22–23)
Im Zuge dieses hermeneutischen Vorgehens sind sowohl Implikationen, die aus der jeweiligen diskurstraditionellen Verankerung eines Textes resultieren, zu berücksichtigen, als auch solche, die sich durch den Verschriftungs- und Verschriftlichungsprozeß ergeben.145 Ziel ist es dabei, letztendlich die „Verluste“ des kommunikativen Rahmens einer historischen Konstellation soweit als möglich auszugleichen und die einstige „diskursive Einbettung“ wiederherzustellen (Oesterreicher 1998:24).146
Читать дальше