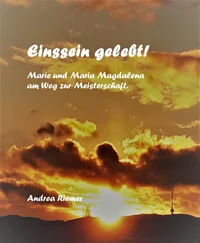„Habt ihr es Giorgio erzählt?“, frage ich.
„Nein, was soll er denn dagegen tun?“, antwortet meine Mutter mit einer wegwischenden Handbewegung.
„Aha. Und mir erzählt ihr es? Was soll ich denn dagegen tun?“
Ich bin verwirrt. Was erwarten sie von mir?
„Ich weiß nicht, du bist doch Arzt, du kannst sie dir doch einmal anschauen. Außerdem kennst du dich doch mit Flüchtlingen aus!“
„Das ist doch etwas anderes! Ich werde sie mir sicher nicht anschauen! Ich habe schon genug verzweifelte Menschen gesehen!“, beginne ich plötzlich laut zu werden. Ich erschrecke vor diesem ungewohnten Ton.
„Übrigens“, hole ich erneut aus, „chinesische Arbeiter in der Textilindustrie sind in Italien keine Seltenheit! Ich sag nur Pronto Moda! In Prato arbeiten schon seit Jahren Tausende chinesische Migranten in der Textilindustrie. Und in manchen Städten, ja, da sind auch Schwarzarbeiter. Das kann euch doch nicht ernsthaft schockieren! Chinesen sind billig!“ Ich schreie schon fast.
Wahrscheinlich will ich es wegschreien. Diese grauenhafte Wahrheit, diese Ausbeutung der Schwachen. Warum erzählen sie mir davon, warum quälen sie mich mit der Ungerechtigkeit der Welt? Ich habe bereits erfolglos versucht, dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Jetzt will ich sie nur noch verdrängen. Doch es sei mir nicht vergönnt.
„Es tut uns leid, Antonio! Wir haben es nur gut gemeint. Wir dachten, du willst helfen. Wir dachten, du bist damit vertraut, und dass du die Erfahrung und Kraft hast, dich für diese Menschen einzusetzen“, redet mein Vater plötzlich ruhig auf mich ein.
Doch jetzt ist es zu spät. Meine innere Ruhe ist längst vernichtet. Ich springe auf und der Sessel fällt mit einem Scheppern zu Boden. Wie können sie es wagen zu denken, dass ich für irgendetwas noch Kraft hätte?
„Erzählt es doch einfach dem Bürgermeister, der soll sich darum kümmern! Oder ruft die Polizei! Aber lasst mich damit in Ruhe!“, schreie ich ihnen ins Gesicht.
Schon lange war ich nicht mehr so aufgebracht, schon lange habe ich mir den Schmerz nicht vom Leib geschrien. Sie wollen doch gar nicht helfen. Sie wollen einfach keine Schwarzarbeiter, keine Fremden. Wenn sie Menschen helfen wollen würden, wenn ihnen etwas an Menschenleben läge, würden sie sich doch auch um die Flüchtlinge scheren. Dann sähen sie das Leid, das um sie herum geschieht. Würden sie mir dann nicht auch helfen wollen? Ich renne aus dem Wohnzimmer, schlage die Türen hinter mir zu und verschwinde in meinem Zimmer. Wie ein bockiges Kind. Lasse die beiden am Tisch sitzen, nur ein Gefühl von Wut und Ratlosigkeit bleibt zurück. Das weihnachtliche Glücksgefühl ist verpufft, schneller als gedacht. Ich werfe mich auf mein Bett und starre leer an die Decke, spüre das Leid, von dem ich nie erfahren wollte. Mein Herz schnürt sich gefährlich eng zusammen, der Druck auf der Brust wird immer intensiver. Meine Eltern, meine geliebten Eltern, sehen sie mich überhaupt noch? Sehen sie, wer ich bin und was ich brauche? Sie sollten mich beschützen und nicht an die Front schicken.
Ling
3. Januar 2020
Heute ist ein seltsamer Tag. Als ich aufgewacht bin, fühlte ich schon diese Bedrücktheit, diese Unruhe, die der ganze Tag verhieß. Ich hasse diesen Tag jetzt schon. Das fahle Licht versucht sich seinen Weg in unsere winzige Wohnung zu bahnen, aber es scheint ihm nicht zu gelingen, es scheint, als würden die Fensterscheiben alles dafür tun, die Lichtstrahlen nicht hineinzulassen, sie zu verschlucken. Es ist nicht nur furchtbar eng, jetzt ist es auch noch furchtbar dunkel. Ich schleiche in die Küche und ziehe die Kühlschranktür auf. Das, was mir in die Hände fällt, nehme ich heraus und lege es auf den Tisch. Mir ist völlig gleichgültig, was ich esse, ich schmecke sowieso nichts, ich esse bloß, um am Leben zu bleiben. Ich achte nur darauf, was Maja schmeckt und lege es zu den anderen Lebensmitteln dazu. Als ich mich umdrehe, sitzt Maja plötzlich schon am Tisch. Lautlos, wie ein Geist, muss sie geschwebt sein. Ihre langen dünnen Beine und Arme hängen schlaff und ohne Kraft von ihrem Körper. Ihre Hautfarbe ist schneeweiß und ihr Gesicht spitz, fast schon knochig. Eigentlich hatte sie wegen der Chemotherapie ihre kinnlangen, schwarzen Haare verloren, doch sie ist eitel und so kauften wir ihr eine lange, dunkelbraune Echthaarperücke. Sie wollte schon immer lange Haare haben. Kaum ist sie aus dem Bett, setzt sie die Perücke auf. Sie sagt, sie kann sich nicht mit Glatze sehen. Ich setze mich zu ihr und wir essen schweigend. Xiaolong ist vorgestern in den frühen Morgenstunden aus dem Haus gegangen und nach Wuhan gefahren, wo sein Zwillingsbruder lebt. Zwölf Stunden Autofahrt braucht man nach Wuhan. Hin und wieder besucht er ihn für ein paar Tage. Dann gehen sie gemeinsam zu dem Markt und genießen die chinesische Kultur. Ich mag diese Märkt nicht, Xiaolong liebt sie. Ich gehe nie mit ihm mit und deshalb geht er allein oder mit seinem Bruder. Sich durch diese Menschenmengen schlängeln, hin zu den verschmutzten Ständen, bei denen Tausende lebendige Tiere in Käfige gequetscht sind, gibt mir nichts. Alle bezeichnen das als „seltsam“, dass ich nicht viel davon halte und schütteln den Kopf dazu. Fast jeder, den ich kenne, ist von diesen Märkten begeistert. Von Fröschen, Hunden und Katzen bis hin zu Fledermäusen, Affen und Tigerbabys sind dort alle Tiere an die Stände angebunden oder in Stahlgitterkäfigen zusammengepfercht. Sie stehen alle in ihrem eigenen Dreck. Man kann von Stand zu Stand schlendern und sich Tiere kaufen, wenn man will. Dann beißt man Fröschen oder Mäusen den Kopf oder die Glieder ab oder schluckt sie gleich bei lebendigem Leib hinunter. Doch auch Hunde, Katzen oder Tiger werden vor Ort, vor den Augen aller geschlachtet und gegessen. Ein Blutbad, ein Geschrei, ein Fest. Kultur. Ich kann darauf verzichten, Xiaolong aber nicht. Deshalb fährt er regelmäßig nach Wuhan zu seinem Bruder, um das zu erleben, was er für sein Wohlbefinden braucht, was er mit mir nicht erleben kann. Während er heute seinen Tag auf diesem Markt verbringt, werde ich mit Maja wieder ins Krankenhaus fahren. Sie braucht eine neue Infusion. Vorsichtig, als könnte ich ihre Haut zerreißen, berühre ich sie am Arm.
„Wie geht’s dir heute, Maja?“, frage ich besorgt.
„Gut. Alles gut.“ Sie hebt lächelnd den Kopf und fügt hinzu: „Aber wahrscheinlich nicht mehr lange.“
Wie wahr! Diese Infusionen sind ein Graus und sie ist so tapfer. Ich bete jeden Tag, dass ihre Tapferkeit belohnt wird, dass sie die Leukämie bald besiegen wird. Sie ist doch noch so jung, erst zwölf. Ihr Körper will sich doch erst vom Kind zur Frau entwickeln. Sie kann doch jetzt nicht einfach sterben. Sie wird auch nicht sterben, sie wird es schaffen. Es kann gar nicht anders sein, es muss einfach alles gut werden. Wir ziehen uns an und verlassen die Wohnung. Wir gehen durch die Stadt und zur U-Bahn. Aber nur sehr langsam, denn Maja kann nur ganz langsam gehen, ohne völlig außer Atem zu kommen. Wir schleichen fast dahin. Es dauert eine Ewigkeit, bis wir endlich den Krankenhausflügel betreten. Die Halle ist grauenhaft hell und das gesamte Gebäude riecht, als wäre es in Desinfektionsmittel getränkt. Alles ist sauber, komplett steril, nur man selbst ist der Dreck. Mein Kind redet kein Wort. Was sollte sie denn auch groß bereden wollen? Und ich schweige uns tot. Welche Worte könnten uns jetzt noch retten? Die Ärzte dieser Station kennen uns bereits und führen uns auf ein Zimmer. Auch sie sagen nichts, deuten nur auf das Bett und holen die Infusion. Heute haben wir ein Einzelzimmer bekommen. Es riecht genauso wie der Rest der Klinik und ist panikmachend eng. Es erinnert mich an zu Hause. Nur dass das Zimmer hier von Licht durchflutet ist. Doch nicht von warmem Licht, in dem man Sonnenbaden möchte, nein, ein grelles Licht, das dir die Sehnerven zersticht. Ich sitze bei Maja und halte ihre Hand, schaue zu, wie die Flüssigkeit der Infusion in ihre Adern tropft. Ein Tropfen, dann der nächste und wieder der nächste. Jeder Tropfen scheint ein Schlag zu sein. Ein Schlag, der dich gesund schlagen soll. Bizarr. Wir warten und warten. Es dauert und dauert. Doch dann färbt sich ihr Gesicht schon grün und gelb. Sie schwitzt und dreht sich gequält von einer Seite zur anderen, bis sie es aufgibt und einfach nur mit leerem Blick an die Decke starrt. Doch auch das ist nicht lange zu ertragen. Ohne ein Wort steht sie auf, fährt mit der Infusion in das Badezimmer des Raumes. Ich höre, wie sie sich mühsam – wie eine alte, gebrechliche Frau – niederkniet und über die Kloschüssel beugt. Dann kotzt sie sich die Seele aus dem Leib. Langsam stehe ich auf und folge ihr ins Bad, knie mich neben sie und nehme ihr die Perücke vom Kopf. Die braucht sie jetzt nicht, die kann jetzt auch nichts mehr verstecken. Ich stopfe sie in meine Tasche und streiche Maja über den Rücken, halte sie im Arm, bis es vorbei ist. Doch dieses Mal dauert es länger. Sie erbricht und erbricht und hört nicht mehr auf. Sie kotzt sich beinahe leer. Heut ist kein guter Tag. Die Tränen rollen ihr stumm über die Wangen und ich weine mit ihr. Leise, in meinem Inneren. Als alles langsam zu einem Ende kommt, gehen wir wieder zum Bett. Langsam, ganz vorsichtig. Jede Bewegung scheint ein Messerstich zu sein. Sie legt sich hin und schläft ein. Vor Erschöpfung. Nach einiger Zeit kommt eine Ärztin hinein, lächelt milde und dreht an der Infusion.
Читать дальше