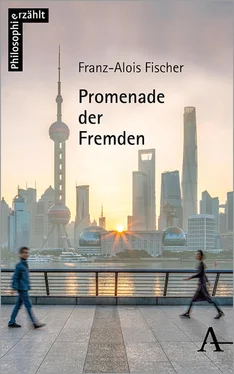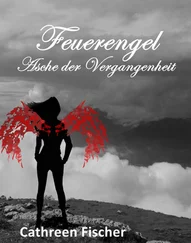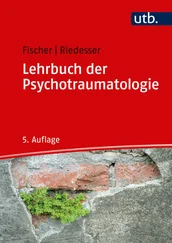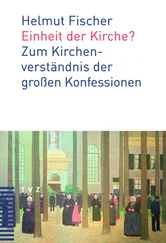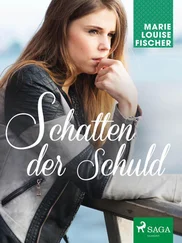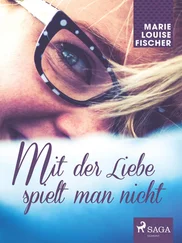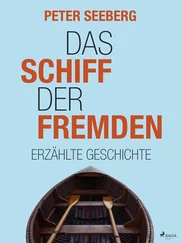Nach der Vorlesung werden wir, die Gäste aus Europa, von unseren Assistenten in ein Restaurant in Uninähe eingeladen. Die Speisen sind wieder so vielfältig, die Portionen so reichlich, dass man es ein opulentes Mahl nennen muss. Am späteren Abend sitze ich dann bei einem Bier zusammen mit den Kollegen an der Hotelbar. Die anderen Hotelgäste sind sämtlich Chinesen und so ist die Bar jeden Abend verwaist, denn die Chinesen trinken nichts und gehen auch nicht weg. Ein Student, etwa Mitte zwanzig, erzählte uns in der Mittagspause, dass er noch nie in einer Bar war. Dafür hatte er während seines letzten Deutschland-Aufenthalts das Gesamtwerk von Thomas Mann gelesen. Daraufhin machte ich reflexhaft einen Witz über torture (dass das Gesamtwerk von Thomas Mann in Deutschland als Folterwerkzeug für Studenten gelte), strich aber nur ein paar Höflichkeitslacher ein. Hoffentlich hatten sie das nicht auf Hongkong bezogen! Bei uns in Deutschland wäre es jedenfalls leichter, ein paar Studenten zu finden, die noch nie im Hörsaal waren, als einen einzigen, der noch nie in einer Bar war. Beides irgendwie verrückt.
Der Kellner, großgewachsen und etwas dümmlich dreinblickend – und damit eine außergewöhnliche Erscheinung –, hat uns jetzt schon zum wiederholten Mal das falsche Bier gebracht. Diesmal gibt es Tsingtao statt Heineken. Taugt aber und ist auch grad egal. Wir haben jetzt die erste Vorlesungseinheit hinter uns und sind nun ein wenig schlauer, wie das hier läuft. Einige Einheiten Kant, Fichte und Hegel stehen zwar noch aus, aber wir haben alle das Bedürfnis nach einem ersten Zwischenfazit und tragen daher unsere Anekdoten der ersten Tage zusammen. Über manches lachen wir, über manches wundern wir uns. Uns verbindet die schöne Klammer des gemeinsamen Erlebens auf Zeit. Fast komme ich mir vor wie in einer dieser Filmszenen, wenn sich alte Freunde ein letztes Mal wiedersehen und über die alten Zeiten sprechen. Dabei sind wir doch mittendrin, und eigentlich kennen wir uns auch nicht wirklich, das ist schon komisch. Beim dritten Bier – Asahi statt Tsingtao, das wir eigentlich nachbestellen wollten, weil es wirklich geschmeckt hat – stecken wir beim Zuprosten konspirativ die Köpfe zusammen. Das geht von Daniel aus und es ist klar, dass jetzt eine wichtige Frage von ihm kommen muss. »Ganz ehrlich«, beginnt er, um nach langer denkerischer Pause zu vollenden, »können die was?«
Wir schauen uns an und brechen in nahezu hysterisches Gelächter aus. Die ganze Anspannung der zurückliegenden Tage prusten wir aus uns heraus. Der große Chinese und seine Kollegin hinter der Bar schauen uns irritiert an, ganz kurz, ehe sie sich wieder ihrer Aufgabe zuwenden: Seit bald einer Stunde sind sie dabei, den Kaffeevollautomaten zu reinigen, wobei sie ihn mit einer Mischung von Akribie und Faszination behandeln, wie man sie von einem NASA-Wissenschaftler erwartete, der ein UFO untersucht.
Wir nehmen unser Gespräch wieder auf, indem ich davon erzähle, wie nach der Kant-Vorlesung ein Student zu mir kam, um mir eine Frage zu stellen.
»Normalerweise«, sage ich, »kommen da ja Fragen zu irgendwas Konkretem und ich hatte mich daher schon darauf eingestellt, die Frage nicht beantworten zu können. Aber der hat mich ganz eindringlich angeschaut und gefragt: ›Pro fä so, one question. What äh is äh metaphysic?‹ Was willst du da sagen? Des is, wie wenn einer am Ende des Jurastudiums herkommt und sagt: ›Alles gut, ich hab das ja alles verstanden, nur eine Frage noch: Was ist denn eigentlich dieses Grundgesetz, von dem immer alle reden?‹ – Manche Leute, die hast schon verloren, bevor du das erste Wort gesagt hast.«
Roland, dem Wiener Kollegen, gefällt das außerordentlich. Ein wenig später wird er dann allerdings ernster und meint, dass unter den Studenten schon einige sehr schlaue dabei seien und er alles in allem positiv vom Niveau überrascht sei. »…, oder?«, in typisch Wiener Art schließt er nicht fragend, sondern bestätigend. Und in gewisser Hinsicht hat er auch recht. Dann will er sich abermals zum Rauchen verabschieden, doch Daniel und ich beschließen, mitzukommen. Zum Rauchen muss man einen kleinen Bereich links neben dem Hoteleingang aufsuchen, der von einem sich bückenden roten Plastikmännchen bewacht wird. Roland bietet mir eine Zigarette an, die ich jedoch ablehne. Eine Weile schaue ich den anderen beiden beim Rauchen zu, dann will ich es aber doch wissen. »Ne, jetzt mal ernst«, sage ich, »Können die was? – Ich mein jetzt nicht, ob die schlau sind oder fleißig oder gebildet. Das ist ja offensichtlich. Aber können die auch Philosophie? Meint ihr, dass der nächste große Philosoph – und da rede ich jetzt von der Gewichtsklasse Kant und Hegel –, dass der in vielleicht zwanzig oder fünfzig Jahren aus China kommen könnte? Bei uns entstehen die ja offenbar nicht mehr.«
Die beiden wiegeln ab. Kant und Hegel werde es sobald nicht nochmal geben, die kämen aus der Glanzzeit der Philosophie und die sei zweihundert Jahre her. Aber ich muss nachbohren, schließlich ist das der erste halbwegs klare Gedanke, den ich hier zu fassen bekomme: »Der heutige Kant und der heutige Hegel, die wären ja kein bisschen wie Kant oder Hegel. Kant und Hegel sind ja alte Säcke aus einer anderen Zeit!« Aber die anderen beiden lassen sich nicht mehr aus der Reserve locken und so geht jeder bald auf sein Zimmer.
Ich nehme meine Unruhe mit ins Bett und schalte den Fernseher ein, wieder einmal auf Ablenkung hoffend. Erst zeigen sie Regen, dann Hongkong, fünf Minuten später wird das Bild schwarz. »Das ist doch scheiße«, denke ich. »Wer kann denn jetzt bitte schlafen, solange meine Frage noch unbeantwortet im Raum steht.« Also rufe ich – auch wenn es mit dem Handy pervers kostspielig ist – einen guten Freund in München an. Der ist zunächst ganz erschrocken, weil ich mich so unverhofft bei ihm melde, und befürchtet schon, es wäre etwas passiert, bis er merkt, dass es sich um ein dringliches philosophisches Problem handelt. Er erfasst sofort, worum es geht, und wir können uns das ganze Drumherum, das philosophische Gelaber und Geziere, sparen. Er, der selbst bereits mit Philosophie im Gepäck in China war, weiß auch nicht, wie es die Chinesen unterm Strich mit dem freien Denken halten wollen. Ob dort ein großer Geist entstehen kann? Er ist unsicher. Aber er ist sich ganz sicher, dass in China gerade etwas entsteht, und zwar etwas Neues und Großes. Und allein deswegen müsse man solche Chancen, wie sie unsere Summer School bietet, nutzen, und sei es auch nur, um diesen neuen Geist kennenzulernen. Und eines sei sicher: Wer auch immer es sein wird, der oder die diesen neuen Geist verkörpert, Hegel wird es nicht sein. Der ist nämlich schon seit zweihundert Jahren tot. – Das waren meinerseits gut investierte 30 Euro.
Für mich ist das nämlich doppelt beruhigend. Zum einen heißt das ja, dass sie uns den Hegel, anders als den Transrapid, ja gar nicht wegnehmen können. Der ist ja schon lange vorbei. Und zum andern heißt das für uns, dass wir hier ja vielleicht Geburtshelfer für jemanden sein können, der zwar nicht der Hegel und auch nicht der Kant, aber vielleicht der Song oder die Xiang sein wird. Und den Song oder die Xiang können die uns dann in zweihundert Jahren nach Europa bringen. Das ist doch schön. Ich beschließe, meinen Studenten morgen das Lied »Es gibt nur ein Willy Hegel« beizubringen. Da freu ich mich schon drauf. Jetzt ist mein Kopf leer. Ich schlafe wie ein Baby.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше