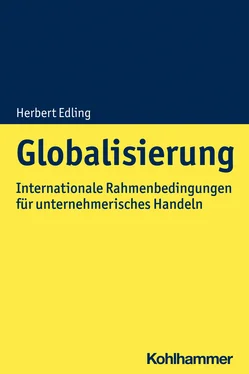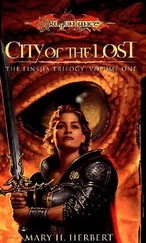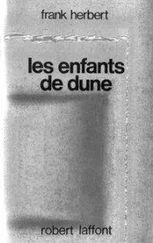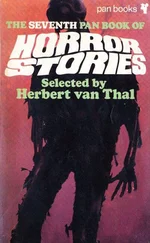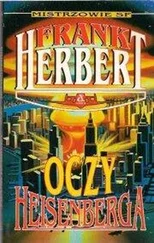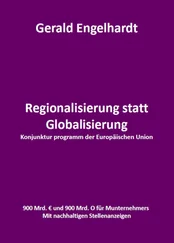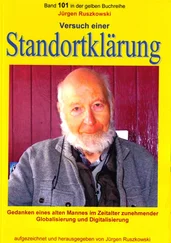Neuere Erklärungsansätze beziehen sich auf den Handel gleichartiger Güter zwischen den Industrieländern (sog. intraindustrieller Handel). Der Handel von gleichartigen Produkten zwischen industrialisierten Ländern wird u. a. erklärt durch die Ausnutzung steigender Skalenerträge bei gleichzeitigem Auftreten von monopolistischer Konkurrenz als dominierender Marktform sowie der gewünschten Produktvielfalt der Konsumenten.
Ein Grund für Handel ist die Nichtverfügbarkeit von Gütern und Produktionsfaktoren. Ursächlich hierfür können natürliche Gegebenheiten sein, wie bspw. das Klima, mangelnder Zugang zu Rohstoffen oder das Fehlen von Know-how. Kostendifferenzen bei der Herstellung der Güter sind ein weiteres wesentliches Argument für Handel zwischen den Staaten. Bei absoluten Kostenvorteilen – ein Land kann ein Gut mit geringeren Kosten produzieren als die Konkurrenz – soll sich jedes Land auf die Produktion derjenigen Güter und Dienstleistungen spezialisieren, die es am preiswertesten herstellen kann.
Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte David Ricardo in einem Zwei-Güter-Zwei-Länder-Modell auf, dass sich Handel zwischen zwei Ländern auch dann lohnt, wenn ein Land bei beiden Gütern absolute Kostenvorteile besitzt. Das mit diesem Theorem der komparativen Kostenvorteile begründet bis heute noch größtenteils den Handel. Voraussetzung ist, dass sich das Land mit den absoluten Kostennachteilen bei beiden Gütern auf die Produktion und den Export desjenigen Gutes spezialisiert, das es mit dem kleinsten absoluten Nachteil (dem vergleichsweisen Kostenvorteil) herstellen kann. Der reale Wohlfahrtseffekt liegt dann in einer Erhöhung der Produktivität für die beiden Länder insgesamt. 30
Während Ricardo die Kostendifferenzen in erster Linie auf das Klima und die geologischen Verhältnisse in den jeweiligen Ländern zurückführte, begründeten die beiden Ökonomen Heckscher und Ohlin diese primär mit einer unterschiedlichen Ausstattung der Länder mit den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital.
Handel entsteht demzufolge aufgrund unterschiedlicher Ausstattung an Produktionsfaktoren. Angenommen, der in einem Land relativ reichlich zur Verfügung stehende Faktor wird gering entlohnt, folgt daraus das sog. Heckscher-Ohlin-Theorem (Faktorproportionentheorem): Jedes Land wird diejenigen Güter exportieren, bei deren Produktion jener Faktor relativ intensiv verwendet wird, mit dem das Land relativ reichlich ausgestattet ist und die Güter deswegen entsprechend günstig angeboten werden können. 31
Nach Vernon ist bei der Ausstattung der Länder nicht nur nach der Quantität, sondern auch nach der Qualität zu differenzieren. Nicht alle Länder verfügen über dieselbe Technologie und Humankapital. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis kombinierte er das Heckscher-Ohlin-Modell mit dem Produktlebenszyklustheorem und erreichte somit eine dynamische Erweiterung. Betont wird dabei vor allem die Rolle des Humankapitals und Wissen als Ursache zeitlich begrenzter komparativer Kostenvorteile. 32
Generell ist zu beobachten, dass Länder sich hinsichtlich ihrer Exporte immer weniger spezialisieren. Die Verbesserungen in den Bereichen Transport, Telekommunikation, Informationstechnologie auf der einen Seite und die steigende ökonomische Integration sowie die generelle Öffnung der Märkte auf der anderen, führen zu einer verbesserten Mobilität der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Wissen. Daraus folgt, dass die komparativen Kostenvorteile für viele Länder immer mehr an Bedeutung verlieren. 33
Auch Krugman verweist darauf, dass Außenhandel nicht unbedingt auf komparative Kostenvorteile zurückgehen muss. Außenhandel kann auch durch zunehmende Skalenerträge verursacht werden – d. h. durch das tendenzielle Sinken der Kosten pro Einheit mit wachsender Produktionsmenge aufgrund der Tatsache, dass sich die Fixkosten auf immer mehr Einheiten verteilen. Skalenerträge bieten Ländern den Anreiz, sich zu spezialisieren und auch mit denjenigen Ländern zu handeln, die über die gleichen Ressourcen und Technologien verfügen. Die Skalenerträge können intern (mit zunehmender Unternehmensgröße) oder extern (mit zunehmender Größe der Branche) anfallen. 34
Nach Linder wird ein Gut erst dann zum Exportgut, wenn eine repräsentative Binnennachfrage vorhanden ist (Theorie der repräsentativen Nachfrage). Die Eroberung der Auslandsmärkte findet erst nach Ausschöpfen der inländischen Marktmöglichkeiten statt. 35Was den Umfang und die Struktur der Handelsgüter angeht, sind diese mithin durch die interne, »repräsentative« Nachfrage determiniert. Der Handel ist dabei umso intensiver, je ausgeglichener das Pro-Kopf-Einkommensniveau – bzw. je ähnlicher die Präferenzen nach bestimmten Produkten – der Handelspartner ist.
Kein anderes Land mit einem ausgebauten Straßennetz ähnlich wie jenes in Deutschland ermöglicht die »freie Fahrt für freie Bürger«, wie der ADAC vor vielen Jahren die Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen begründete. Die Autobahn ist geradezu ein Alleinstellungsmerkmal Deutschlands auf den Absatzmärkten seiner Autoindustrie und damit ein starkes Verkaufsargument geworden, wie Piper in der Süddeutschen Zeitung formulierte.
Porsche bewarb einst seine Auslandsmärkte mit dem Slogan ›in Deutschland konkurriert Porsche nicht mit Autos, sondern mit Flugzeugen.‹ Und Piper merkt noch an: Als Zyniker, sollte man den deutschen Autobauern wegen des vielen Ärgers auf dem Absatzmarkt Amerika wenigstens nicht auch noch das Verkaufsargument Autobahn wegnehmen. 36
Eine weitere Ursache für Handel sind unternehmensstrategische Überlegungen. Ausländische Direktinvestitionen beeinflussen in zunehmendem Maße den Handel von Gütern und Dienstleistungen zwischen den Ländern sowie die Richtung der Handelsströme. 37
Die Handelsströme zwischen den verschiedenen, weltweit verteilten Standorten bzw. Wertschöpfungseinheiten multinationaler Unternehmen (Intra-Unternehmenshandel) nehmen ständig zu. Dies mag damit zusammenhängen, dass eine immer stärkere Fragmentierung der Wertschöpfungsketten zu beobachten ist. 38Nur noch sehr wenige Produkte werden an einem Produktionsstandort hergestellt. Gegenwärtig fallen schätzungsweise über 50 % des weltweiten Handels auf den Warenhandel innerhalb multinationaler Konzerne.
Insbesondere sein den 1990er Jahren kam es zudem zu einer Zunahme von regionalen Wirtschaftsräumen. Diese verschaffen ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich gegenseitige Privilegien einzuräumen. Zwar müssen die Abkommen von der WTO genehmigt werden, aber die WTO sieht darin eine Förderung des internationalen Freihandels, da regionale Abkommen Meilensteine auf dem Weg zur weltweiten Verwirklichung dieses Ziels sind. Andere sehen darin einen fruchtbaren Wettbewerb zwischen Regionen. Kritiker wiederum halten diese Entwicklung kaum vereinbar mit der Vorstellung von globalem Freihandel.
Als »regionaler Wirtschaftsraum« haben Teile der EU eine weltweit einzigartige Vertiefung der Integration erreicht. Als Integrationsstufen unterscheidet man:
Freihandelszonen entstehen durch Freihandelsabkommen oder sog. Präferenzhandelsabkommen. In erster Linie geht es dabei um den Abbau der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten. Neuere Abkommen vereinheitlichen Normen und Standards. Da weiterhin gegenüber Drittstaaten die Mitgliedsländer ihre eigene Handelspolitik betreiben können, bleibt die Souveränität der beteiligten Nationalstaaten gegenüber Drittstaaten weitestgehend erhalten. Um auszuschließen, dass Waren über jenes Mitgliedsland in die Freihandelszone gelangen, das den niedrigsten Außenzoll hat, bedarf es eines sog. Urspruchzeugnisses, das für jede gehandelte Ware mitzuführen ist und als offizielle Bestätigung der Herkunft einer Ware dient.
Читать дальше