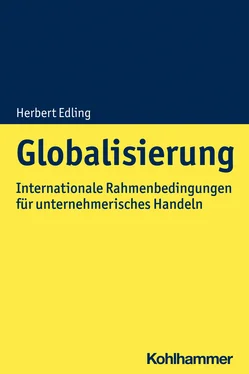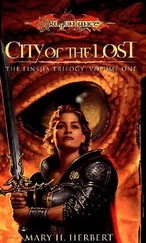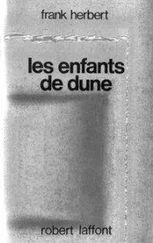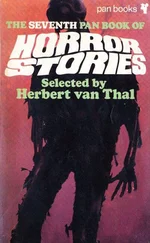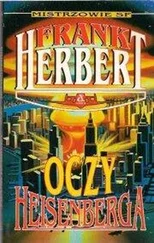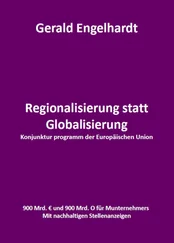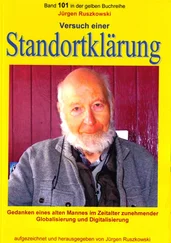Herbert Edling - Globalisierung
Здесь есть возможность читать онлайн «Herbert Edling - Globalisierung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Globalisierung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Globalisierung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Globalisierung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Globalisierung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Globalisierung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1.4.2 Global Governance: Strukturen und Instrumente
Bei Global Governance handelt es sich um das »Regieren jenseits des Nationalstaates« 121oder um eine Form des »Regierens ohne Regierung« 122im internationalen Kontext, in der staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenwirken, in dem Bemühen »to bring more orderly and reliable responses to social and political issues that go beyond capacities of states to address individually.« 123Governance umfasst dabei den zu regelnden Inhalt wie auch die Normen, die den Prozess beschreiben, über den eine Regelung zustande kommt und durchgesetzt wird. 124
Nach Boughton u. a. ist «the ideal of global governance (…) a process of cooperative leadership that brings together national governments, multilateral public agencies, and civil society to achieve commonly accepted goals. It provides strategic direction and then marshals collective energies to address global challenges. To be effective, it must be inclusive, dynamic, and able to span national and sectoral boundaries and interests. It should operate through soft rather than hard power. It should be more democratic than authoritarian, more openly political than bureaucratic, and more integrated than specialized. 125
Global Governance bedeutet auch, dass staatliche wie nichtstaatliche Akteure zur Norm- und Regelsetzung bzw. deren Umsetzung beitragen. Politische Regulierung findet dabei auf verschiedenen, miteinander interagierenden Ebenen statt. Internationale Politik ist nicht mehr nur horizontale Politik zwischen Staaten, sondern besitzt auch vertikale Komponenten zwischen internationalen Institutionen einerseits und Staaten sowie Individuen andererseits. Internationale Normbildungsprozesse werden auch durch lokale Akteure angestoßen, und globale Normen wirken auch lokal bzw. werden auf lokaler Ebene entsprechend angepasst. An die Stelle des hierarchischen Regierens tritt zunehmend die horizontale Steuerung. 126
Dieser Trend und die Zunahme an relevanten Akteuren in den internationalen Beziehungen sowie die damit einhergehenden immer komplizierteren Wirkungsketten, die zunehmenden Interdependenzen und die Machtdiffusion erschweren das Regieren der Welt. Interessenausgleich wird schwieriger, Problemlösungen werden komplexer und politische Steuerung wird aufwendiger. 127Hinzu kommt, dass sich über die Jahrzehnte eine Vielzahl von Formen globalen Regierens etabliert hat.
Dabei ist Governance nicht zwingend an Staaten gebunden. Neben »Governance by Government« gibt es auch »Governance with Governments«, Staaten verpflichten sich im Umgang miteinander auf bestimmte Normen und Regeln, ohne dass diese von einem übergeordneten Akteur beschlossen und durchgesetzt werden können, und »Governance without Government.« 128In diesem Fall legen sich gesellschaftliche Akteure in Form der Selbstregulierung ohne Beteiligung von Staaten selbst Normen und Regeln auf, wie z. B. den Verhaltenskodex für multinationale Unternehmen oder die Domain-Namen im Internet, die ohne formale Beteiligung von Regierungen durch ICANN vergeben werden.
In einer Mischform gehen Staaten sog. öffentlich-private Partnerschaften (Public Private Partnerships) als Teil eines transnationalen Arrangements ein. In diesen Fällen erbringen gesellschaftliche Akteure eine Reihe von Governance-Leistungen oder produzieren globale öffentliche Güter, die allein von Staaten nicht bereitgestellt werden können. Schließlich sind noch Elitenetzwerke wie bspw. das jährlich in Davos stattfindende World Economic Forum (WEF) zu nennen. Hier treffen sich Individuen, Staaten, Unternehmen, Medien, Verbände und Nichtregierungsorganisationen, um informell auszuloten, was im globalen Geschehen wichtig oder weniger wichtig ist und entsprechend mehr oder weniger politische Aufmerksamkeit bedarf. 129
Neben den internationalen Organisationen wie der UN, dem IWF oder der WTO gewinnen zunehmend sog. Clubs Einfluss in der Weltpolitik. Clubs sind eher flexible, relativ schwach institutionalisierte vergleichsweise unverbindliche Zusammenkünfte von Staatengruppen. Die »Clubs der Lobbyisten« agieren innerhalb der bestehenden internationalen Organisationen (z. B. G33 innerhalb der WTO), »Clubs der Willigen« außerhalb. Primär verfolgen diese Clubs eigene Interessen (z. B. OPEC; Anti-Irak-Koalition). Die »Clubs der Relevanten« agieren ebenfalls außerhalb internationaler Organisationen. Darin finden sich für eine Problembewältigung relevante Akteure, die über entsprechende Ressourcen und Macht verfügen, wie die G8 und G20. Vor allem diese neuen Formen von Global Governance – bezeichnet auch als »open method of governance« oder als »Ad-hoc-Kooperation« – werden zum bestimmenden Muster der Zusammenarbeit von Staaten des 21. Jahrhunderts. 130Sie oder gelten als flexibel gestaltbar und effektiv. Allerdings fehlt es ihnen an repräsentativer Legitimität. 131
Box: Kommt ein »Klimaclub«?
Auf Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums hat das Bundeskabinett im August 2021 die Eckpunkte für die Gründung eines Klimaclubs verabschiedet. Die Idee an sich geht auf den US-Ökonomen und Nobelpreisträger William Nordhaus zurück, um das Trittbrettfahrerproblem im internationalen Klimaschutz in den Griff zu bekommen.
Die Mitgliedsstaaten der Klimaallianz sollen sich demnach auf gemeinsame Emissionsstandards sowie einen gemeinsamen Mindestpreis für Kohlendioxid festlegen, der auf jede Tonne CO 2anfiele, die in der Staatengruppe von Unternehmen ausgestoßen wird. Um einen möglichen Wettbewerbsnachteil gegenüber jenen Unternehmen auszugleichen, die in Staaten produzieren, die nicht Clubmitglied sind, soll beim Import aus diesen Ländern – vorausgesetzt sie halten sich nicht an die vorgegebenen Umweltstandards – ein Aufschlag (Klimazoll) anfallen. 132
Um die vielfältigen, in globaler Abhängigkeit stehenden Akteure mit ihren unterschiedlichen Präferenzen trotz möglichem Trittbrettfahrer-Verhalten dennoch zu einem kooperativen Verhalten bewegen zu können, sind gewisse Anreize notwendig. »Ways and means must be found to make international cooperation an attractive, or at least, acceptable proportion for all.« 133
Zunächst stellt sich jedoch die Frage, wie globale öffentliche Übel (bspw. der Klimawandel) überhaupt auf die internationale Tagesordnung kommen, nachdem die Ignoranz gegenüber dem Problem erst einmal überwunden ist. 134Voraussetzung ist ein fundierte wissenschaftliche Bestätigung der Existenz des globalen Problems, ein langfristiger Dialogprozess der Wissenschaftler mit den politischen Entscheidungsträgern, die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem grenzüberschreitend ist, wenn sie große und/oder dramatische Risiken bergen oder gar eine unmittelbare Bedrohung für die Menschheit darstellen wie bspw. die Covid-19 Pandemie. Außergewöhnliche Ereignisse wie Atomreaktorunfälle, das Schaffen von Problembewusstsein und die Verbreitung von Kenntnissen durch internationale Nichtregierungsorganisationen sowie die Unterstützung internationaler Organisationen (bspw. durch die OECD) und jene durch mächtige und einflussreiche Staaten sind weitere Bedingungen dafür, dass die Korrektur global öffentlicher Übel auf die internationale Politikagenda kommen und die Bereitstellung korrigierender globaler öffentlicher Güter eingeleitet werden. 135
Ist die Anzahl der Betroffenen und Beteiligten eher klein oder das Interesse an einer Lösung für einige wenige Länder besonders groß, so kommt es tendenziell auch eher zu konkretem kollektiven Handeln. Je kleiner die betroffene Gruppe ist, desto homogener dürften die Interessen und der Beitrag des Einzelnen für das Gelingen des gemeinsamen »Projekts« sein sowie genügend Vertrauen innerhalb der Gruppe vorliegen. Zudem ist es auch möglich, in kleinen Gruppen eher als in großen das Verhalten einzelner Mitglieder zu überwachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einem Trittbrettfahrer-Verhalten kommt und ein kooperatives Handeln ausbleibt, eher gering sein. 136Kollektives Handeln wird zudem begünstigt, wenn die beteiligten Akteure ohnehin in verschiedenen Politikfeldern miteinander kooperieren und/oder eine privilegierte Ländergruppen (sog. Clubs) bestehen, die einseitig die Kosten für die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter tragen, weil sie selbst sehr stark davon profitieren. 137
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Globalisierung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Globalisierung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Globalisierung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.