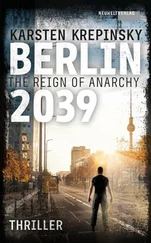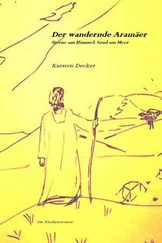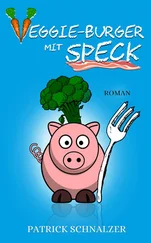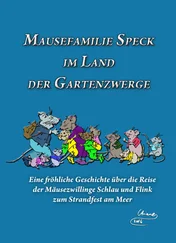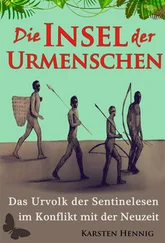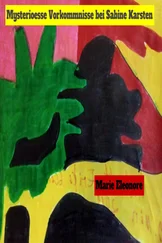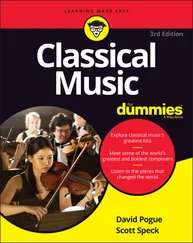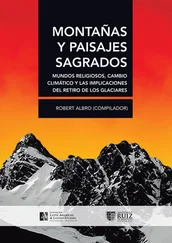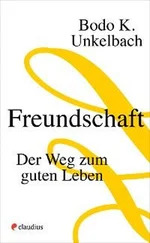Für die Schweiz zeichnet sich wie in Deutschland einerseits eine fragmentierte Datenlage zur Verbreitung der Schulsozialarbeit und andererseits eine quantitative Gesamtentwicklung, die auf eine Institutionalisierung hinausläuft, ab: Auf der einen Seite fehlen bislang sowohl verlässliche Daten zur aktuellen Verbreitung in der Schweiz. Gründe hierfür sind ein junges und sich rasch etablierendes Arbeitsfeld, die sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Kantonen und Gemeinden, die Verantwortung der Gemeinden für die Schulsozialarbeit, die fehlende kantonale Steuerung und Datenaufbereitung sowie die unterschiedlichen Datensätze (z. B. Bezugnahme auf Fachkräfte, Stellen, Gemeinden oder Schulen).
Auf der anderen Seite hat die Schulsozialarbeit in der Schweiz, legt man vorliegende Diplomarbeiten, unveröffentlichte Publikationen und erste Bestandsaufnahmen zugrunde, mit etwas Verzögerung eine ähnliche Gesamtentwicklung wie in Deutschland genommen (Drilling 2009; Helfenstein et al. 2008; Baier 2008; Vögeli-Mantovani 2005; Müller 2007): Nach einzelnen Pilotprojekten in den 1970er und 1980er Jahren fand ab Mitte der 1990er Jahre eine Ausweitung der Schulsozialarbeit vor allem in größeren Städten statt (z. B. Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Zug, Zürich). Besonders in den 2000er Jahren ist dann eine enorme Aufwertung der Schulsozialarbeit zu konstatieren. Im Jahr 2003 gab es in der Deutschschweiz über 118 Standorte der Schulsozialarbeit, wobei der Kanton Zürich mit 67 Stellen die Zahlen klar dominierte (Vögeli-Mantovani 2005, 64 ff.). Baier ermittelte im Jahr 2008 auf der Basis von im Internet zugänglichen Berichten, Homepages und (fach-)politischen Dokumenten bereits 289 SchulsozialarbeiterInnen in der Schweiz und ging aufgrund der unterschiedlichen Datenquellen von insgesamt etwa 400 Personen aus, die in der Schulsozialarbeit in der Schweiz tätig sind (Baier 2008, 89). In einer umfangreichen quantitativen Bestandsaufnahme zur Schulsozialarbeit, die im Auftrag des SchulsozialarbeiterInnen Verbandes (SSAV) durchgeführt wurde, konnten im Jahr 2007 allein für die Deutschschweiz 350 Adressen von SchulsozialarbeiterInnen ermittelt werden (Helfenstein et al. 2008). Einer aktuelleren Bestandsaufnahme zur Schulsozialarbeit in der Deutschschweiz zufolge (Seiterle 2014) gab es in der alleine in der Deutschschweiz Ende 2013 bereits 883 SchulsozialarbeiterInnen auf 527 Vollzeitstellen.
Zur fachlichen Entwicklung und Verbreitung der Schulsozialarbeit in Österreich gibt es inzwischen einige Publikationen (für einen Überblick Adamowitsch et al. 2013 und 2011; Braun/Wetzel 2013 und 2011; die Beiträge in Bakic/Coulin-Kuglitsch 2012; Knapp/Lauermann 2007; Vyslouzil/Weißensteiner 2000). Im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz hat der Ausbau der Schulsozialarbeit hier später begonnen, konnte aber durch ein Bundesprogramm aktiv unterstützt werden (Krötzl 2009). Einer Untersuchung von Adamowitsch et al. (2011) zufolge gab es im Jahr 2010/2011 an 256 österreichischen Schulen Schulsozialarbeit. Damit wurden österreichweit ca. 4 % der Schule mit dem Angebot Schulsozialarbeit erreicht. Die meisten Schulen mit Schulsozialarbeit bestanden in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Wien. Zum Einsatz kamen insgesamt 131 SchulsozialarbeiterInnen. In Liechtenstein ist ein kleineres Team von SchulsozialarbeiterInnen tätig ( www.schulsozialarbeit.li).
Zusammenfassend betrachtet expandierte die Schulsozialarbeit im deutschsprachigen Raum in relativ kurzer Zeit.
3 Begriffsklärung und Definition zur Schulsozialarbeit
Bislang mangelt es dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit sowohl an einem unumstrittenen Begriff als auch einem relativ klaren inhaltlichen Verständnis (Speck 2005).
Der von Maas 1966 aus der amerikanischen „School Social Work“ in Deutschland eingeführte und von Abels (1971) einige Jahre später aufgegriffene Begriff „Schulsozialarbeit“ ist in Deutschland inzwischen zwar weitgehend gebräuchlich (z. B. in den Ländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein). Gleichwohl werden – anders als in den anderen deutschsprachigen Ländern – darüber hinaus auch andere Begriffe verwendet. Die Begriffsvielfalt gilt angesichts der föderalen Struktur der Bundesrepublik nicht ganz unerwartet für die Förderpolitik der einzelnen Bundesländer, aber auch für die Fachpublikationen (siehe Kasten):
„Berufsschulsozialarbeit“ (in den Ländern Bayern, Thüringen)
„Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“ (in Thüringen)
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ (in den Ländern Baden-Württemberg, Berlin, Bayern)
„Jugendarbeit an Schulen“ (im Land Thüringen)
„Schoolworker“ (im Saarland)
„Schul Soziale Arbeit“ (Witteriede 2003)
„schulalltagsorientierte Sozialpädagogik“ (Maykus 2001)
„schulbezogene Jugendhilfe“ (Prüß et al. 2001a)
„schulbezogene Jugendsozialarbeit“ (z. B. im Land Thüringen BMFSFJ 2005; BAG JAW 1996; BAG KJS 2002)
„Schul-Soziale Arbeit“ (Schilling 2004)
„Sozialarbeit an Schulen“ (z. B. im Land Brandenburg)
„Sozialarbeit in der Schule“ (z. B. Glanzer 1993; THMSG 1998a)
„Soziale Arbeit an Schulen“ (z. B. Spies/Pötter 2011)
„Sozialarbeit in Schulen“ (im Land Hessen)
„Sozialpädagogische Fachkräfte an Gesamtschulen“ (im Land Nordrhein-Westfalen)
„sozialpädagogisches Handeln in der Schule“ (z. B. Braun/Wetzel 2000)
Für die unterschiedlichen Begrifflichkeiten werden unter anderem a) die historische Vorbelastung des Begriffes Schulsozialarbeit, b) die stärkere Betonung des Jugendhilfecharakters des Arbeitsfeldes, c) die angestrebte Verknüpfung präventiver und intervenierender Angebote sowie d) die Vermeidung einer einseitigen und etikettierenden Zielgruppenfokussierung auf benachteiligte und beeinträchtigte SchülerInnen angeführt. Auffällig ist allerdings, dass diese Begrifflichkeiten in den Untertiteln, den Ausführungen sowie anderen Veröffentlichungen derselben AutorInnen nicht konsequent eingehalten werden, bei der Bezeichnung der sozialpädagogischen Fachkräfte häufig nicht mehr nutzbar sind und oftmals keine tatsächlich anderen Ziele und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen gegenüber anderen Veröffentlichungen zur Schulsozialarbeit markieren.
Angenommen werden kann, dass durch die Begriffsvielfalt in der Förderpolitik und Fachdiskussion ein fachlicher Austausch über die Schulsozialarbeit, die notwendige Konzeptdiskussion und Profilschärfung sowie die Transparenz und Durchsetzung des Arbeitsfeldes in der (Fach-)Öffentlichkeit deutlich erschwert sind. Vor diesem Hintergrund spricht vieles für die Verwendung des Begriffes „Schulsozialarbeit“. Der Begriff Schulsozialarbeit
 ist erstens an die Entwicklung im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich, Liechtenstein) und die internationale Debatte zur „School Social Work“ anschlussfähig (Allen-Meares 2004; Huxtable/Blyth 2002; Constable et al. 2002; Dupper 2002), während andere Begriffe hier zusätzlicher begrifflicher Erläuterungen bedürfen,
ist erstens an die Entwicklung im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich, Liechtenstein) und die internationale Debatte zur „School Social Work“ anschlussfähig (Allen-Meares 2004; Huxtable/Blyth 2002; Constable et al. 2002; Dupper 2002), während andere Begriffe hier zusätzlicher begrifflicher Erläuterungen bedürfen,
 ist zweitens in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten historisch gewachsen und gebräuchlich, während andere Begriffsneuschöpfungen eher zu Verständnis- und Akzeptanzproblemen als zu inhaltlichen Impulsen führen,
ist zweitens in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten historisch gewachsen und gebräuchlich, während andere Begriffsneuschöpfungen eher zu Verständnis- und Akzeptanzproblemen als zu inhaltlichen Impulsen führen,
 ist drittens sowohl in der (Fach-)Öffentlichkeit als auch in allen Bundesländern mit bestimmten konzeptionellen Vorstellungen verbunden, während länderspezifische Begriffe meist bundesweit erklärungsbedürftig sind und im (fach-)öffentlichen Diskurs dann wieder unter dem einheitlichen Begriff Schulsozialarbeit subsummiert werden (müssen),
ist drittens sowohl in der (Fach-)Öffentlichkeit als auch in allen Bundesländern mit bestimmten konzeptionellen Vorstellungen verbunden, während länderspezifische Begriffe meist bundesweit erklärungsbedürftig sind und im (fach-)öffentlichen Diskurs dann wieder unter dem einheitlichen Begriff Schulsozialarbeit subsummiert werden (müssen),
Читать дальше
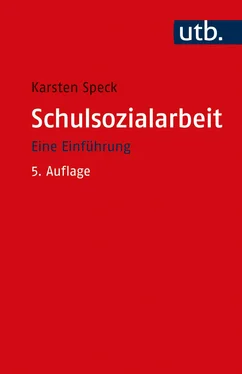
 ist erstens an die Entwicklung im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich, Liechtenstein) und die internationale Debatte zur „School Social Work“ anschlussfähig (Allen-Meares 2004; Huxtable/Blyth 2002; Constable et al. 2002; Dupper 2002), während andere Begriffe hier zusätzlicher begrifflicher Erläuterungen bedürfen,
ist erstens an die Entwicklung im deutschsprachigen Raum (Schweiz, Österreich, Liechtenstein) und die internationale Debatte zur „School Social Work“ anschlussfähig (Allen-Meares 2004; Huxtable/Blyth 2002; Constable et al. 2002; Dupper 2002), während andere Begriffe hier zusätzlicher begrifflicher Erläuterungen bedürfen,