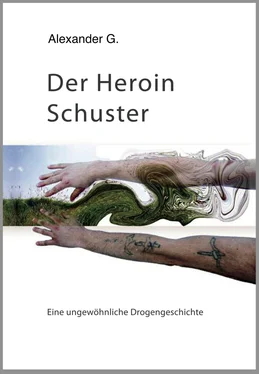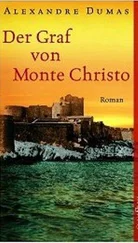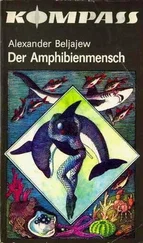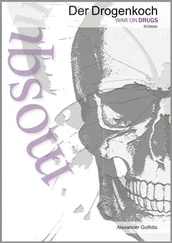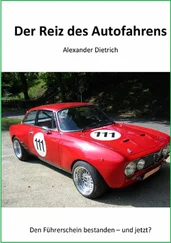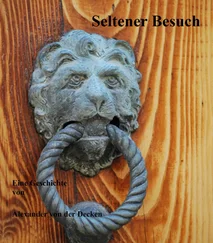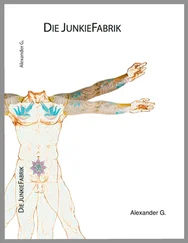Marcel ging abermals zu Boden und mühte sich dann taumelnd wieder hoch. Um uns herum standen mittlerweile etwa dreißig Leute – alles Feinde. Jeder von ihnen hätte sich, wäre er allein gewesen, gegen Marcel in die Hosen gemacht. Aber zusammen waren sie eine wilde Meute. Einzig Karl hielt sie zurück, es war sein Heimspiel. Hier konnte er zeigen, was er drauf hatte, sich profilieren. Er hob den Fuß und zielte damit gegen Marcels Kopf. Der Tritt traf ihn direkt neben dem Auge, wo nun eine weitere Wunde aufgerissen war, aus der das Blut hervorquoll. Marcel fiel in sich zusammen und blieb liegen. Fünf endlose Minuten lang. Der Kampf war gelaufen. Das Zittern verbergend, half ich ihm wieder auf die Beine und stützte ihn etwas ab. Nun konnte jeder sehen, dass es zu weit gegangen war. Marcels Augen waren so zugeschwollen, dass er kaum mehr etwas sehen konnte – sie gaben den Weg frei. Wir durften ziehen.
Als wir geknickt und geschlagen den Nachhauseweg antraten, hatte ich das schlechteste Gewissen meines Lebens. In meinen Tagträumen rückte ich mir die Situation noch oft zurecht. Verdammt, hätte ich nur zugeschlagen! Aber ich hatte mich von der Angst lähmen lassen. In Wirklichkeit gab es in meinen Augen an diesem Tag nur einen Verlierer und der war ich.
Der Neuaubinger
Auf der anderen Seite fühlte es sich wirklich gut an Neuaubinger zu sein. Ich war Mitglied einer Rocker-Gang, und so zog ich durchs Viertel und sponn mir meinen ganz eigenen Film vom Leben.
In Neuaubing zählten andere Werte, es konnte zum Beispiel passieren, dass man in einer Kneipe neben einem Typen wie Jörg landete. Jörg war groß, hatte schwarze, kurze, lockige Haare und trug zu seinen Cowboystiefeln einen eng anliegenden Nadelstreifen Anzug. Um seinen Hals hing eine dicke Goldkette, an der ein goldenes, zigarettenschachtelgroßes Marihuanablatt baumelte. Manchmal, wenn er an der Bar stand und sein Glas hob, gab sein Sakko einen Blick auf einen Schulterhalfter frei, in dem er eine Pistole trug. Jörg war kein Polizist. Und solche Typen gab es in Neuaubing vereinzelt öfter. Ihre Namen wurden durch die Straßen getragen und hinter vorgehaltener Hand genannt. Sie waren unsere Vorbilder.
Cowboystiefel, Jeans, schwarze Lederjacke, am besten noch von »Erdmann«. Dann gab es da noch Waffen: Nunchakus (zwei dreißig Zentimeter lange, mit einer Kette verbundene Stöcke) die ich in Bruce Lee Manier wild um mich kreisen ließ und dabei zur Prüfung meiner Treffsicherheit schon tausende Zigaretten gekillt hatte; welche ich in die Luft geschmissen mit meinen Nunchakus entzweite. Dann Schlagringe, Mercedes-Sterne (in Neuaubing fuhr kein einziger Mercedes mehr mit Stern, wir grasten sogar die Tiefgaragen nach diesen Dingern ab), Gaspistolen und Nothammer.
Bevor ich aus dem Haus ging, überlegte ich mir noch, welche Waffen ich mir einsteckte. Zu meiner Standardbewaffnung gehörten die Chuks, die aus der Seitentasche meiner schwarzen Lederjacke hingen, und eine 9mm-Gas-Pistole mit bearbeiteten Patronen, die ich mittels eines Stückchen Wachses und Eisenspäne, verschärfte.
Ich lief durch die Straßen meines Viertels und niemand wagte es, sich mir in den Weg zu stellen. Mein Name war schon weiter gereist als mein Gesicht. Bis in die Nachbarviertel wussten die Leute, wie ich hieß, ohne mich jemals gesehen zu haben.
Darauf war ich stolz. Ein Gefühl von Allmacht und Rebellion. Dreizehn Jahre alt, tätowiert und bewaffnet.
Ich war ein Rocker, das hatte ich zwar nie selbst von mir behauptet, aber die Eltern der Nachbarskinder wussten es und warnten ihren Spießbürgernachwuchs vor mir. Uns hatte kein Erwachsener mehr etwas zu sagen. Der neue Feind war die POLIZEI.
Und damit ergab sich das perfekte Gefühl: Cowboystiefel, schwarze Lederjacke und bewaffnet; ich war ein Revoluzzer!
Für mich war es klar, ich hatte den richtigen Weg, sprachen doch allmorgendlich die Gesichter der Bevölkerung in den Bussen und U-Bahnen ihre eigene Sprache. Ausdruckslos und mit hängenden Gesichtszügen standen die Erwachsenen wie Kühe sinn- und willenlos umher, um abends dann vom richtigen Leben zu träumen, während sie gebeugt in ihren Urlaubskatalogen studierten. Und die wollten einem nun erzählen wo’s lang ging, die konnten mir allenfalls Leid tun.
Erst einmal Rocker und später Gentlemangangster, das war mein Ding.
Als ich mit der neunten Klasse fertig war, hatte ich natürlich keine Lehrstelle in Aussicht. Während die Hälfte meiner Freunde nun doch so klug waren und einen Beruf erlernten, saß ich zu Hause.
Der einzige Beruf, den ich mir vorstellen konnte, war Automechaniker. Zum Automechaniker hätte ich mindestens einen Notendurchschnitt von 4 gebraucht. Doch in meinem Abschlusszeugnis war die beste Note eine 4 – die liebe Englisch-Lehrerin – dann vielleicht zwei Fünfen, und der Rest alles Sechsen.
Nun lagen mir die Familie und die Freunde arg in den Ohren, wie wichtig so ein erlernter Beruf sei. Mir selber schien das egal, arbeiten war sowieso nicht mein Ding; doch jetzt wurde es tagsüber langweilig, da fast alle anderen arbeiten gingen. Die Freunde hatten Kohle und ich keine, das passte am allerwenigsten zusammen. Beruf hin oder her, aber das Geld war ein Argument und so fand ich nach dem dritten Anlauf einen Job als Hilfsarbeiter.
Gleich bei der ersten Arbeitsstelle hatte ich einen Glückstreffer gelandet. Wir fuhren für eine Weinhandlung den Wein aus. Der Chef, ca. Mitte vierzig, war selbstständig und hatte mich als Beifahrer eingestellt.
Ich saß neben ihm im Führerhaus seines Lastwagens, mit der Straßenkarte auf den Knien und suchte dabei immer die günstigste Strecke heraus.
Raftlmeier, so hieß der Chef, war die größte diebische Elster, die mir bis dato begegnet war.
Früher stellten die Post und andere Boten die Päckchen oft nur in den Hauseingang – Deutschland war noch brav und bieder.
Wir stellten unsere Pakete ab und nahmen die anderen mit. Im Auto wurde dann brüderlich geteilt. Was sich die Leute alles schicken ließen: Haarföhn, Dessous in Übergrößen, »Massagestab« (ganz unscheinbar verpackt) und eine Menge völlig indiskutable Klamotten, die dann bei uns aus dem Fenster flogen. Mit dem ganzen Scheiß konnte man sowieso nichts anfangen, aber so wurde es wenigstens nie langweilig. Und wenn wir mal in ein Mehrfamilienhaus lieferten, sahen wir auch gleich bei den anderen Parteien nach, ob nicht wieder Überraschungspäckchen für uns vor die Türe gelegt waren. Zu Ostern hatte der Chef sogar ein Osternest mitgenommen. Vor dem war nichts sicher – so hatte er seinem Sohn zum fünfzehnten Geburtstag ein nagelneues Moped geklaut: Raftlmeier musste eine Kiste Wein in das Zündapp Werksgelände liefern, und bei der Abfahrt half ich ihm dabei ein Moped einzuladen. Dass wir das Ding klauten, erzählte er mir erst hinterher.
In Raftlmeiers Welt drehte sich alles ums Stibitzen.
Ab und zu sorgte er auch für »Bruch«. Bei besonders guten Weinen gaben wir an, uns wären Flaschen zerbrochen. In Wahrheit hatten der Chef und ich ein recht großes Privatlager mit den auserlesensten Weinen.
Dieser Job war wirklich gut: Kohle, Diebesgut und Wein. Der Traumjob schlechthin. So fuhr ich brav Tag für Tag mit dem Moped in meine Arbeit. Ich fühlte mich direkt reich, immerhin verdiente ich viermal soviel wie die meisten anderen aus unserer Clique. Die Tage waren aufregend und spannend, während die Abende immer öder wurden. Das lag daran, dass ein großer Teil unserer Gang zusehends dem Alkohol verfiel.
Nun fühlte ich mich schon nicht mehr so wohl in dieser Clique.
Alkohol trinken war schon ok, aber nicht jeden Tag. Mir schmeckte das Zeug sowieso nie. Natürlich hatte ich auch getrunken, aber mehr so als Mitläufer. Ich konnte zum Beispiel bis zu sechs Halbe Bier auf ex austrinken. Das schindete zwar Eindruck, brachte aber eine Menge Schwierigkeiten mit sich, da ich stets die Übersicht verlor und hinterher reinkippte, was ich in die Finger bekam. So landete ich eines Abends nach sechs Bieren auf ex und einigen Schnäpsen mit Alkoholvergiftung hinter einer Tankstelle. Meine Freunde trugen mich nach Hause, wo ich mir dann die Seele aus dem Leib kotzte, während meine Schwester Nachtwache an meinem Bett hielt.
Читать дальше