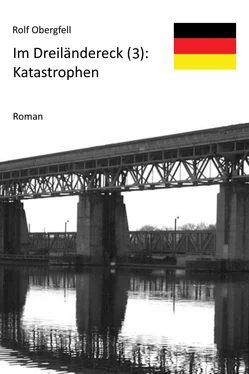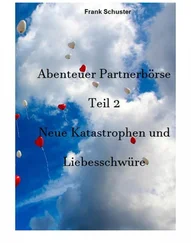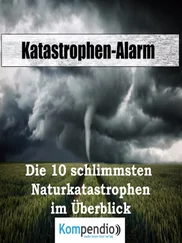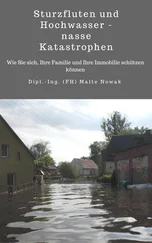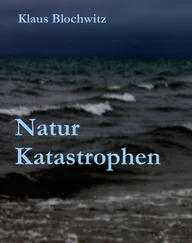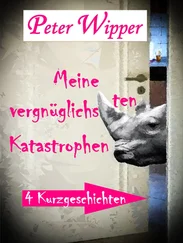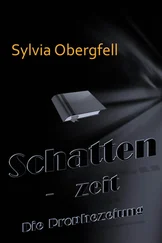In Lyon gab er die Frachtpapiere ab und fuhr sofort wieder los. Dieses Mal hatte er keine Lust, sich nach Erledigung des Auftrages noch in der Stadt herumzutreiben, obwohl er dort einen Brocante-Laden mit vielen Karaffen kannte. Während der Rückfahrt rief ihn Tina an: Sie konnte sein Handy nicht finden, er würde sich noch etwas gedulden müssen. Strickmann war ratlos: Wo sonst könnte er sein Handy verloren haben? Er würde noch einmal seine Wohnung absuchen müssen.
Zu Hause fand er einen Anruf von Sara vor: Sie wollte ihn sprechen, es sei dringend. Da er fand, dass er ihr einen Rückruf schuldig war, rief er bei ihr an, würde sich aber zu nichts drängen lassen. Er verabredete sich mit ihr zu einem späten Frühstück am nächsten Tag in der Coffee Bar am Hebelpark. Sie war schon wieder enttäuscht.
Ihm gefiel die Vorstellung, eine ganze Nacht für sich zu haben, ein ausgedehntes Bad nehmen, im eigenen Bett liegen und durchschlafen zu können.
Am nächsten Morgen wachte er gerade noch rechtzeitig auf, um zum Frühstück mit Sara nicht zu spät zu kommen. Als er etwas außer Atem an der Coffee Bar ankam, war sie noch nicht da. Er ging ein paar Schritte durch den Hebelpark und ließ die Atmosphäre des Ortes auf sich wirken: das hellgrüne Gras mit dem gelben Klee, die mächtigen Bäume, Platanen und Linden, und den Taubenschlag. Obwohl er auf seinem Weg in die Innenstadt an diesem Ort jahrelang vorbeigekommen war, entdeckte er viele Dinge erst jetzt. Er hätte geschworen, dass der Taubenschlag vor zwei Wochen noch nicht an seinem Platz gestanden hatte, dass der ganze Park noch nicht auf einer Ebene gelegen hatte mit dem Bürgerssteig und dem Café, dass er nicht so offen war. Jetzt gab es ein kreisrundes Wackelbrett auf sechs dicken Stahlfedern und ein Mini-Trampolin für die ganz Kleinen. Eine schlanke Mutter mit langem, glattem Haar und eine braune mit einer schwarzen Angela Davis-Frisur waren in ein Gespräch vertieft, lachten immer wieder und warfen ab und zu einen Blick auf ihre Kleinen, die gedankenverloren miteinander auf dem Trampolin herumhopsten.
Strickmann ging zur Mitte der Wiese, setzte sich in einen der Liegestühle und betrachtete Hebels lebensgroße Statue, die 1910 aufgestellt wurde und deren Bronze eine beträchtliche Patina auf
weist. Der selbstbewusste Mann steht fest auf dem Boden und strotzt vor Kraft, was durch seine aufrechte Körperhaltung und einen Wanderstock ausgedrückt wird, der erst jüngst zurechtgeschnitten scheint. Sein linker Daumen hängt lässig an der Hosentasche, über seinem rechten Arm trägt er einen Mantel. Die Tafeln auf dem Sandsteinsockel sind voller Symbole aus seiner alemannischen Heimat: eine Hacke als Werkzeug, Hörnerkappen als Teil der Frauentracht und ein alter Mann in einer Wirtschaft, ein Weinglas in der Hand.
Gekrönt wird das Ganze von einem Spruch Scheffels, der Assoziationen an den blinden Sänger aus der griechischen Antike weckt:
S'isch kein meh cho,
der g'sunge het wie du …
Nach allem, was Strickmann wusste, war dieser Johann Peter Hebel eine seltsame Figur: Er war unbestritten der bedeutendste Autor, der im alemannischen Dialekt geschrieben und ihn dadurch literaturfähig gemacht hatte. Gleichzeitig Karriere als protestantischer Geistlicher. 1760 in Basel geboren, lebte er im Markgräflerland und starb 1826 an Darmkrebs in Schwetzingen. Seine kurzen Geschichten waren so detailliert und lebendig, dass sogar Bertold Brecht sie analysierte. Er wollte herausfinden, worauf ihre Wirkung beruhte. Gleichzeitig erreichten sie eine Tiefe, die man bei vielen Autoren vergeblich sucht. Dies galt vor allem für seine beiden Texte Kannitverstan und Die Vergänglichkeit, für die er auf die hochdeutsche Sprache zurückgegriffen hatte. Intime Beziehungen von ihm sind nicht bekannt, kein Wunder litt er gegen Ende seines Lebens an Altersdepression. Mit der Entscheidung, seine Themen aus dem bäuerlichen Lebensraum zu wählen und Alemannisch zu schreiben, schränkte er seine Wirkung sowohl zeitlich als auch örtlich erheblich ein.
Als Sara ankam, war sie gut gelaunt, hatte ihren ruinierten Nagellack entfernt und ein paar Ideen mitgebracht, was sie an diesem angebrochenen Sonntag unternehmen könnten. Strickmann dachte zum ersten Mal daran, dass sie vielleicht auf der Pirsch war, aber ihm war das zu eng. Außerdem hätte er nicht gedacht, dass sie sich nach ihren Nackenschlägen emotional so schnell stabilisieren würde. War seine Anwesenheit der Grund, gehörte sie zu den Frauen, die nicht allein sein konnten?
So war er ganz zufrieden, als sie plötzlich ernst wurde und vom Besuch bei Margret Hausler erzählte, ihrer Ex-Schwiegermutter in spe. Ihre Geschichte war etwas wirr, sie hüpfte von Punkt zu Punkt und hatte offensichtlich keine Vorstellung von einem Gesprächsziel oder davon, welche Aspekte wichtiger waren als andere. Frau Hausler hatte einen Marmorkuchen gebacken, die beiden Frauen miteinander Kaffee getrunken.
Sara ging es wohl vor allem darum, dass Margret sich besser fühlen konnte. Der Anfang des Gesprächs war sehr schwierig, Margret konnte zuerst überhaupt nicht sprechen, weinte einfach still vor sich hin. Dann redete sie über ihren Sohn. Sein Suizid war ein furchtbarer Verlust für sie, ohne dass klar wurde, worin ihre Berührungspunkte bestanden, ob sie in einer gemeinsamen Wohnung nur nebeneinanderher gelebt hatten oder ob allein schon seine Anwesenheit für die Mutter wichtig gewesen war. Strickmann bekam den Eindruck, dass es vor allem um Margrets Selbstbild ging, das nun als falsch entlarvt war: Ihrem Kind war es nicht gut ergangen, es hatte kein schönes Leben gehabt. Bis vor Kurzem hatte sie sich in diesem Punkt noch etwas vormachen können: Er ist anständig, gesund, nimmt keine Drogen. Sein Beruf als Autoverkäufer ernährte seinen Mann, eines Tages würde er sein eigenes Geschäft aufmachen und ein Autohaus führen, er würde jemand sein in Weil. Und auf ihn war Verlass, mit ihm konnten seine Freunde Geschäfte per Handschlag machen. Aber jetzt war das nicht mehr möglich, diese Gedanken waren nun als Lebenslügen entlarvt. Dann sprach sie über sich: Ihre Ehe war ein Fiasko, ihr Mann eines Tages einfach gegangen. Sara war sich nicht sicher, ob sich da eine verlassene Ehefrau selbst bemitleidete oder ob da noch Gefühle waren. Die ältere Tochter Nicole hatte ihr Elternhaus mit 17 verlassen und lebte nach allem, was sie von ihr wusste, auf der Straße. Irgendwann hatte Margret angefangen, im Alkohol Trost zu finden. Jetzt war sie nicht mehr in der Lage, große Entscheidungen zu treffen, lebte schon lange ein passives Leben. Veränderungen hatte es nur durch das Fernsehprogramm gegeben und die monatlichen Hartz IV-Überweisungen. Genau genommen schaute sie auf ungelebte zehn Jahre zurück. Konkret befürchtete sie, dass das Sozialamt sie nach dem Tod ihres Sohnes zwingen könnte, ihre Dreizimmerwohnung aufzugeben – für sie eine Horrorvorstellung. Wie sollte sie einen Umzug bewältigen, geschweige denn bezahlen? In dieser Situation erinnerte sie sich an Nicole, die sie seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Nur ganz sporadisch bekam sie Hinweise von Bekannten, die ihr angeblich irgendwo begegnet waren, manchmal auch an verschiedenen Orten gleichzeitig. Sie wagte es kaum auszusprechen, aber Kontakt zu ihr, das wäre schon etwas, daran könnte sie sich festhalten. Sara kam mit Margrets Art zu erzählen nur schlecht zurecht. Sie wurde immer wieder von Tränen unterbrochen und versteckte sich hinter Formulierungen wie vielleicht …, könnte man nicht … oder irgendwie … Sie als Person kam in dieser Geschichte nicht vor – Sara gewann zunehmend den Eindruck, wie wenn Margret keinerlei eigene Existenzberechtigung empfände. Am Ende des Gesprächs bedankte sie sich überschwänglich, sie habe darüber noch nie so ausführlich reden können, weil es einfach niemanden gegeben habe, der ihr habe zuhören wollen.
Читать дальше