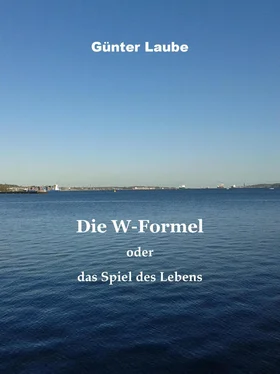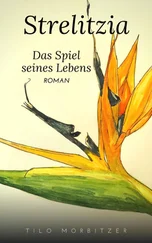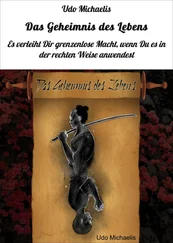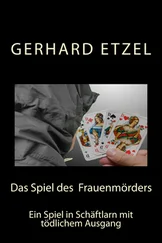Montag Mittag. Ich bin als erster zu Hause, mein Bruder hat heute eine Stunde länger als ich. Das macht aber nichts, denn es gibt keine Reste vom Sonntag. Wir haben gestern Mittag alles aufgegessen und somit ist der eigentliche »Reste-Tag« reif für ein komplett neues Mittagsgericht. Es ist unser Lieblingsgericht: Pfannkuchen. Um genau zu sein: Eierpfannkuchen. Im Pfannkuchenessen sind wir die absoluten Champions, kurz gesagt: völlig verrückt danach. Insofern brach bei uns auch nie sonderlicher Unmut aus, wenn es keine Reste vom Sonntag gab, im Gegenteil.
Das Schöne an der Sache war - aus Kindersicht -, dass wir gar nicht viel tun mussten. Außer essen. Unsere Mutter hat den Teig schon fertig und backt, wenn wir soweit sind. Also Rad abstellen, Schulsachen auf den Schreibtisch zwecks späterer Hausaufgaben, Tasche in die Ecke, Hände waschen, fertig. Das Timing ist im Laufe der Zeit so hervorragend, dass ein Pfannkuchen genau die Zeit braucht, um fertig zu werden, in der wir einen essen. Wenn wir gleichzeitig Schulschluss hatten und dementsprechend auch etwa zeitgleich zu Hause waren, wurden zwei Pfannen zur Zubereitung benutzt. Das animierte unsere Mutter nach Erreichen des ersten Sättigungsgrades - also nach ungefähr fünf bis sechs Pfannkuchen - dazu, dass sie auch selber einmal einen aß.
Die anfangs fast streng gepflegte klassische Variante mit Apfelmus erfuhr im Laufe der Zeiten zahlreiche Variationen: mit Zimt und Zucker, Marmelade, vorrangig Erdbeer, Apfelmus und Zucker gemischt, Vanilleeis, und im fortgeschritteneren Teenageralter habe ich auch schon mal eine Banane fachgerecht eingerollt. Um richtig satt zu werden. Ja, wir haben die Pancakes stets fachmännisch bestrichen und dann zusammengerollt. Dann konnte man sie prima mit Messer und Gabel essen, nämlich in portionsgerechte Stücke schneiden.
Während des Studiums habe ich eine weitere Version in Erfahrung gebracht. Als ich eines Tages mit Freunden zu Hause war und wir uns zwischen den Vorlesungen kurz ein paar Pfannkuchen zur Sättigung machen wollten, schnitt eine Freundin Apfelscheiben in den Teig. Im ersten Moment war ich verblüfft, doch bald gab es Apfelpfannkuchen. Mit Zucker. So spart man das Apfelmus. Es schmeckte ganz gut, nur dürfen die Äpfel nicht zu wässerig sein. Das als kleiner Tipp.
Diese und weitere Varianten sind international ebenfalls bekannt: So berichtet der englische Star-Koch Jamie Oliver, dass in Amerika gerne eine Handvoll Heidelbeeren dem Teig zugesetzt wird, er selbst gibt ein Rezept für Pancakes mit Bananen-Kokos-Joghurt und Mango an, und weist darauf hin, dass bei amerikanischen Pancakes Backpulver ins Mehl gemischt wird.
Auch Thomas Lieven kannte mehrere Rezepte für die Verwendung von Eiern, Mehl und Milch, so zum Beispiel eines für brennende Eierkuchen, die er 1940 in Portugal kredenzte. Man bestreue die Eierkuchen einfach mit reichlich Zucker, gebe einen ordentlichen Schuss Rum drüber und zünde ihn an. Im Dschungel waren Pfannkuchen ebenfalls sehr beliebt, das Dschungelkind und seine Geschwister aßen sie am liebsten mit Zimt und Zucker, und in dem Heinz Rühmann-Film »Wenn der Vater mit dem Sohne« lässt sich Ulli, der Ziehsohn von Teddy Lemke alias Heinz Rühmann, von der Küchentante am Telefon Anweisungen geben und versucht Eierkuchen zu backen.
Heutzutage sind wir auf telefonische Ratschläge indes nicht mehr angewiesen, in nahezu jeder Zeitschrift findet man ein Rezept für Pfannkuchen: Es gibt sie gefüllt mit Champignons, Möhren und Zucchini, und unter dem Begriff »Asia-Pfannkuchen« mit unter anderem 300 Gramm Rinderhackfleisch mutet das ganze recht exotisch an.
Nun werden Sie sich vielleicht fragen, was hat das Pfannkuchen-Szenario mit der Evolution und der Entstehung des Menschen zu tun? Oh, eine ganze Menge. Denn wie Frank D. Braun im Vorwort des Buches »Die 100 besten Meisterköche, Restaurants, Rezepte, Weine« ausführt, sind Essen und Trinken die Basis des Lebens. Und: Hält man sich nicht an das Rezept, dann bekommt man schnell etwas ganz anderes.
Das süddeutsche Pendant lernte ich als Zwölfjähriger bei einem Besuch meiner Verwandten in München kennen. Wir fuhren raus aufs Land und kehrten zum Mittag in einem Landgasthof ein. Urbayerisch und gemütlich. Dort aß ich ein Gericht, das so lecker war, dass ich es unbedingt wieder essen wollte. Doch leider hatte ich mir den Namen nicht gemerkt. Erst viel später erfuhr ich, dass es sich eigentlich nicht um ein bayerisches, sondern um ein österreichisches Gericht handelte: Kaiserschmarren. In der Beilage der Zeit , dem Zeit Magazin, beschreibt Wolfram Siebecks im September 2007 ein Rezept und weist darauf hin, dass wir uns »im österreichischen Sektor der Hochküche befinden«. Er macht als ersten und ziemlich wesentlichen Unterschied zum Pfannkuchen aus, dass man beim Kaiserschmarren das Eiweiß vom Eigelb trennt und mittels Schneebesen in quasi festen Schnee verwandelt. Dieser Schnee gibt dem Teig die Lockerheit. Des Weiteren benutzt Wolfram Siebecks einen Backofen, keine Pfanne. Aber seine Zutaten sind genau die gleichen wie bei meinen Pfannkuchen: Eier, Mehl, Zucker, Milch, Butter oder Margarine. Zwischendurch muss der Schmarren noch zerrupft werden, damit er auch so aussieht, wie er aussehen soll. Er benutzt dazu zwei Gabeln und garniert ihn an dieser Stelle mit ein wenig Zimt. Den kenne ich auch von meinen Pfannkuchen, und damit schließt sich der Kreis, denn heute esse ich beides gern.
Eine weitere (französische) Variante sind übrigens Crêpes, wie wir sie zum Beispiel von Volksfesten kennen. Die Variante ohne Eier und Milch, nur mit Mehl, Salz, Fett oder Schmalz und Wasser führt uns hingegen nach Mexiko: Weizen-Tortillas sind ein wesentlicher Bestandteil der dortigen Küche. Weizenvollkornmehl und Dinkelmehl wiederum gelten als Bestandteile von Vollkornwaffeln.
Doch zurück zu unserem Ausgangsthema: Es bleibt festzuhalten, dass wir sehr genau zu Werke gehen müssen, denn spätestens beim Teig zubereiten sollte man wissen, was es werden soll. Dann hat man die entsprechenden Zutaten besorgt und weiß, ob man die Eier trennen muss oder nicht. Ob es ein Hauptgericht wird oder ein Dessert. In der Pfanne lassen sich nur noch Nuancen ändern, aus Pfannkuchenteig lassen sich schwerlich Tortillas machen, und für Kaiserschmarren bereitet man den Teig auch anders zu als für Crêpes oder Waffeln.
Und so ist es auch bei der Versuchsanordnung für unser Experiment zur Evolution: Würden wir zu wenig Wasser beimischen, fehlte die Basis, bei zu viel elektrischer Energie (Simulation von Blitzen) wäre die Reaktion heftiger als gesund wäre. Zuviel Ammoniak oder Methan wiederum würde das chemische Gleichgewicht durcheinander bringen. Das richtige Mischverhältnis ist also von entscheidender, ja existenzieller Bedeutung. Für die Entstehung von Leben, wie wir es kennen, sind Aminosäuren unentbehrlich, und die entstehen nun einmal nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn man die nicht herstellen kann, dann wird es nichts mit dem Versuch oder Experiment. Gescheitert nennt man das dann.
Doch es hat funktioniert, auch wenn wir es im Grunde nicht sehen, sondern nur durch Rückschlüsse nachweisen können. Vielleicht war es letzten Endes aber auch gar nicht so schwierig, immerhin kann den Versuch heutzutage jeder Hobby-Chemiker nachstellen, und im Chemie-Unterricht dürfte es ebenfalls kein Problem sein. Die einzige Bedingung wäre, dass das Labor in den sieben Tagen nicht für andere Versuche gebraucht wird, da es sich ja um ein geschlossenes System handelt. »Was das Leben sonst auch sein mag, auf der Ebene der Chemie ist es erstaunlich profan: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, ein wenig Calcium, ein Schuss Schwefel, eine kleine Prise von ein paar anderen ganz gewöhnlichen Elementen, das ist alles, was man braucht«, bilanzierte Bill Bryson.
Читать дальше