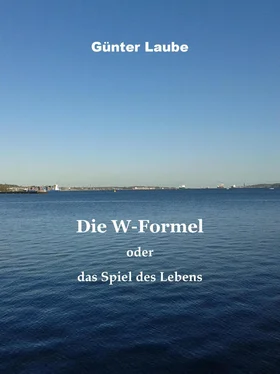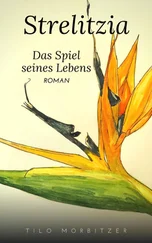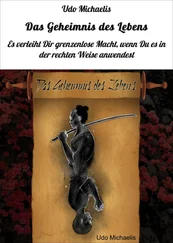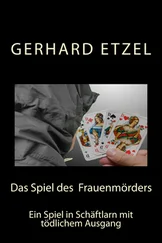Mitten in ihrer »Warum?-Phase« wurde Elisabeth geboren; Leila, eine Cousine, hatte Nachwuchs bekommen. »Warum hat Leila Baby bekommen?«, wollte Helen wissen und »woher kommt das Baby?«
»Der Doktor hat Leila das Baby gegeben«, antwortete Anne Sullivan.
»Wo hat Doktor das Baby gefunden?«, lautete die nächste Frage.
»Unter dem Herzen von Leila.«
Zum Glück fragte Helen nicht weiter. Zunächst.
Doch wir fragen nun an Helens Stelle einfach mal ganz unbedarft weiter, denn wir sind schließlich erwachsen: Wenn aus einem Affen ein Mensch geworden ist, müsste dann nicht konsequenterweise dieser Mensch eine Frau gewesen sein? Müsste nicht überhaupt der erste Mensch eine Frau gewesen sein? Denn schließlich können nur Frauen Babys bekommen, und also neue Menschen auf die Welt bringen. Egal ob künstlich oder sonst wie befruchtet. Nach einer Schwangerschaft von in der Regel neun Monaten. Doch, stop! Sie meinen, die Erklärung liegt auf der Hand? Wir begegnen ihr tagtäglich in den Medien und im wahren Leben? Oh ja, ganz richtig!
In dem Artikel »Das Geheimnis Mensch« wurde im Frühjahr 2004 in der FunkUhr erläutert, wie »das Wunder des Lebens« beginnt: »Mit dem Wettlauf von 500 Millionen Samenzellen zur Eizelle der Frau«. Die Antwort, wie neue Menschen entstehen, ist also ganz einfach, nahezu trivial: Sex!
An dieser Stelle unserer Reise legen wir eine kleine Pause ein und halten noch einmal einen Rückblick: Es gibt also nicht nur keinen Beweis für die Entstehung des Menschen aus dem Affen (bzw. eines Menschen aus einem Affen), sondern die Fakten und Tatsachen sprechen allesamt gegen eine derartige Art der Auslegung der Evolutionstheorie. Ebenso wie gegen das quasi-automatische Lernen. Ein Merkmal, das gerade in unserer heutigen Zeit, in der Bildung so groß geschrieben wird, ganz offensichtlich zu Tage tritt. Und genau diese Fakten finden im Alltag längst Anwendung. Schließlich müssten Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz sonst nicht regelmäßig zur Blutspende aufrufen, sondern man könnte auch Blut von Affen nehmen, mit denen wir Menschen ja genetisch fast identisch sind. Und nach Ansicht mancher Wissenschaftler sind wir ja im Grunde nur eine Art höherentwickelte Affen. Tja, dann müsste das Blut auch eins zu eins verwendbar sein. Ist es aber nicht. Und selbst die Menschen unterscheiden sich noch einmal in vier Grundtypen bzw. Blutgruppen: A, B, AB und Null. In der Pharmazie werden verschiedene Medikamente aus menschlichem Blut hergestellt und finden unter anderem Verwendung bei Operationen. Im Blutplasma sind über 130 Eiweißarten vorhanden, von denen rund ein Viertel zu Arzneimitteln verarbeitet wird. Eine kleine interessante Randnotiz ist, dass Blutplasma gelblich aussieht, und eine grünliche Färbung dem Kundigen die Benutzung der Antibabypille verrät, während eine eher milchige Konsistenz auf ein recht üppiges - fettes - Frühstück schließen lässt.
Wie wir Eingangs des Kapitels festgestellt haben, ist »der ganze große Reichtum an Kohlenstoffverbindungen in der Natur einmal durch den Körper von Lebewesen hindurchgegangen«. Diese Erkenntnis vermittelte Walter Greiling bereits in den 1960er Jahren in dem Buch »Chemie - Motor der Zukunft«. »Der Torf, die Braunkohlen, die Steinkohlen, das Erdöl, alles sind Reste von Leibern unzähliger Pflanzen- und Tiergenerationen.«
Haben wir damit die W-Formel gefunden? Muss nicht zwangsläufig irgendjemand die ersten Lebewesen zu Stande gebracht und ihnen die Möglichkeit zur Fortpflanzung mit auf den Weg gegeben haben? Denn vom biologischen Ablauf her stammen die Dinge, von denen wir bislang dachten, dass wir, die Menschen, aus ihnen hervorgegangen sind, von uns selbst. Nachdem nun also die biologischen Tatsachen die biologischen Theorien nicht bestätigt haben, stecken wir gewissermaßen in einer Sackgasse.
»Des is' wia bei jeder Wissenschaft, am Schluss stellt sich dann heraus, dass alles ganz anders war.« (Karl Valentin)
Wir sind damit aber nicht am Ende unserer Reise angelangt, denn wenn keine unmittelbaren Details in einer Sache zu eruieren sind, dann heißt das nicht automatisch, dass es keine gibt. Vielleicht sieht man sie nur (noch) nicht. Ändern wir also unsere Perspektive, begeben wir uns vom kleinen zum großen und dann zum ganz kleinen Anschauungsobjekt: Ein Blick auf den Stundenplan belehrt uns, dass es noch andere Fächer gibt, die uns weiterhelfen können, die Welt zu verstehen: Chemie und Physik. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit also vom Mikrokosmos hin zum Makrokosmos: Die Astronomie ist ein Teilgebiet der Physik, und gerade im 20. Jahrhundert hat sie sehr viel zur Erklärung der Entstehung der Welt beigetragen.
Also lassen Sie uns unsere Reise jetzt aus der physikalisch-chemischen Sichtweise fortsetzen. Schließlich bestehen Zellen aus Molekülen und also Atomen. Wenn man nun deren Entstehung erklären und nachvollziehen könnte, dann wäre anschließend mit Sicherheit auch eine Verbindung zu komplexeren Gebilden wie den ersten Zellen möglich. Und dann wäre es nur noch ein kleiner Schritt bis zur W-Formel, der Weltformel.
»Die Weltformel wäre damit für die Physik das, was der Globus in der Geographie ist: ein umfassender Blick auf das Ganze«, schreibt Olaf Fritsche, und damit hätten wir dann das Grundprinzip gefunden. Alles weitere wird sich dann schon ergeben.
Schauen wir also auf das Ganze, auf das ganze Universum!
III.3 Die W-Formel
Was für den Biologen die Zelle, ist für den Physiker und Chemiker das Atom. Atomos, das Unteilbare, stammt aus dem Griechischen. Mittlerweile wissen wir - seit dem 20. Jahrhundert -, dass auch das Atom durchaus teilbar ist, darauf basieren zum Beispiel die Kernwaffen, auch Atombomben genannt.
Ihr Prinzip ist die Zerlegung des Atomkerns, und zwar von mehreren Atomen, so dass in einer Kettenreaktion große Mengen von Energie freigesetzt werden können. In kontrollierter Form bringt uns die Geschichte mit der atomaren Kettenreaktion übrigens zu den Kernreaktoren, die der Stromerzeugung dienen.
Doch das ist eine andere Geschichte. Zurück zu unserem Atom. Dieses besteht aus einem Atomkern und einem oder mehreren Elektronen. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und Neutronen, die keine elektrische Ladung inne haben. Die Elektronen umgeben den Atomkern und sind negativ geladen, wobei die Bezeichnungen nicht wertend zu verstehen sind. Schließlich ist ein Mann nicht positiv, eine Frau negativ und ein Kind neutral. Es dient lediglich der Unterscheidung.
Anfangs ähnelte ein Atommodell dem Modell unseres Planetensystems, ein großer Kern in der Mitte - so wie die Sonne, und die Elektronen ziehen draußen ihre Bahn - so wie die Planeten. Doch beim Fortschreiten von der zweidimensionalen zur dreidimensionalen Betrachtung zeigte sich beim Atom ein etwas anderes Verhalten. Die Elektronen flitzen nämlich nicht in fest zuordnenbaren Bahnen um den Kern, sondern sind quasi mal hier mal da. Deswegen sprechen die Chemiker und Physiker bei den Elektronen auch von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Die natürlich berechnet werden können. Aber das soll uns jetzt weniger beschäftigen. Entscheidend ist, dass es unterschiedlich viele Protonen und Neutronen und Elektronen geben kann, aus denen ein Atom besteht. Und dadurch kommen wir zu den chemischen Elementen, deren es auf der Erde 92 natürliche gibt. Das schwerste (mit den meisten Protonen und Neutronen und Elektronen) ist das Uran, das leichteste der Wasserstoff. Der hat genau ein Proton und ein Elektron.
Ist nicht viel, reicht aber, und in Verbindung mit Sauerstoff (acht Protonen) und einem weiteren Wasserstoffatom ergibt sich unter den geeigneten Bedingungen das berühmteste Molekül der Welt: H2O, Wasser. Und damit sind wir schon mitten im Film. Denn die Frage aller Fragen lautet: Wie entstanden aus einer Anzahl von Atomen die ersten Moleküle, die sich im Laufe der Zeit ihrerseits zu komplexeren Gebilden zusammenfanden, um letzten Endes die ersten Zellen hervorzubringen?
Читать дальше