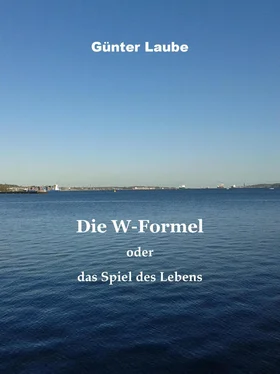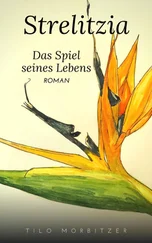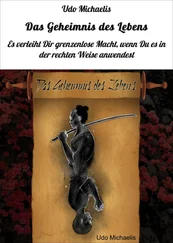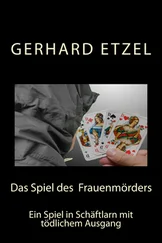Wenn man einen Stein betrachtet, dann mutet es höchst unwahrscheinlich an, dass daraus irgendwann einmal ein lebendiger Organismus wird. So ist denn auch der Sprung vom Anorganischen zum Organischen nicht so einfach nachzuvollziehen, wie wir soeben in Erfahrung gebracht haben. Doch nach Ansicht mancher Wissenschaftler ist dies bei Betrachtung eines Vorganges, der sich über eine lange Dauer erstreckt, durchaus möglich. Im Prinzip ist jeder Planet mit den entsprechenden Voraussetzungen, also Entfernung zur Sonne bzw. einem Stern und dem Vorhandensein der oben angesprochenen Elemente, geeignet Leben hervorzubringen, genau wie unsere Erde, die 30.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist.
Wie David und Arnold Brody in ihrem Buch »Die sieben größten Rätsel der Wissenschaft« ausführen, »ging die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren aus der Zusammenballung von Staub und Gasen hervor.« Sie stellen die Frage, die auch wir uns soeben gestellt haben, nämlich »wie sich Leben aus Aminosäuren und RNA entwickelt haben kann, wenn diese Substanzen Produkte lebendiger Zellen sind?« Und sie liefern eine wahrscheinliche Antwort auf die Frage, der wir jetzt nachgehen, gleich mit: »Beide Komponenten waren in der Ursuppe vorhanden.«
Um diese Theorie zu überprüfen, kann wiederum ein interdisziplinärer Ansatz hilfreich sein, und man sollte meinen, dass die Wissenschaftler im 20. Jahrhundert diese Frage eingehend erörtert hätten, sie betrifft schließlich unsere Existenz. Unmittelbar. Und in der Tat, im Allgemeinen gibt es dazu zwei Theorien: Die erste verlegt den Beginn der Evolution auf die Erde und postuliert, dass das Leben sich hier gebildet hat; gemäß zweiter Theorie kam es sozusagen per Luftpost - mit Asteroiden oder anderen kosmischen Kleinkörpern aus dem All.
Letztere Theorie lässt sich leicht nachvollziehen, denn bereits heute wird gemutmaßt, dass wir Menschen durch die Raumsonden, die wir von der Erde zu (noch unbewohnten bzw. unbelebten) Planeten schicken, unzählige Bakterien dorthin befördern. Auf diese Weise würde dort also ebenfalls zumindest die Chance bestehen, dass sich langfristig lebende Organismen entwickeln. Und je mehr Raumsonden desto mehr potentielle zukünftig mit Lebensformen bevölkerte Planeten. Quasi eine Art Schneeballprinzip.
Leider bringt uns diese Theorie der Lösung unserer Ausgangsfrage nicht näher, denn zu sagen, »es kommt von draußen«, wäre nicht zufriedenstellend. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit also Theorie Nummer eins zu: Irgendwo im Weltall muss sich dieser Prozess der Lebensentstehung abgespielt haben, also warum nicht auf der Erde? Diese Ansicht teilen derzeit die meisten Wissenschaftler - und sie verfolgen dabei alle einen gemeinsamen Ansatz in unterschiedlichen Varianten.
Die Ur-Erde, wie sie damals bestand, war eine, nun sagen wir, nicht eben lebensfreundliche Angelegenheit. Wir können froh sein, dass wir unsere Reise nur in Gedanken hierher machen, denn ansonsten würden wir ersticken. Die Atmosphäre ist unseren Lebensbedingungen noch nicht angepasst. Doch es waren bereits einige Bausteine, Elemente vorhanden, die unabdingbar für die Evolution waren.
Auch wenn es im Laufe der letzten Jahrzehnte weiterführende und ergänzende Theorien über den damaligen Zustand der Erde gegeben hat, so können wir uns dem Prinzip des Lebens anhand eines Ansatzes aus den 1950er Jahren nähern: Der Zweite Weltkrieg war vorüber, die Goldenen Fünfziger angebrochen, die Wissenschaftler konnten sich wieder ihrer friedlichen Forschung widmen. Damals herrschte die Meinung vor, dass das Leben im Ozean entstanden sei, im Ur-Ozean. Auch heute gibt es noch Forscher, die diese Ansicht teilen, andere sprechen von Meereis, Tonmineralen oder Vulkanen bzw. unterseeischen heißen Quellen. Aber das Grundprinzip, das für alle Theorien nach wie vor Bestand hat, stellte 1953 der junge amerikanische Chemiker Stanley L. Miller nach. Nach ihm und seinem Professor an der University of Chicago, Harold Urey, ging es in die Geschichte ein als das »Miller-Urey-Experiment«.
Stanley Lloyd Miller war Student bei Harold Urey an der Universität von Chicago. Er gilt als der Vater der biologisch-chemischen Evolutionstheorie des Lebens, denn er probierte einfach aus, worüber andere zuvor Theorien aufgestellt hatten: Er experimentierte mit den Stoffen, von denen angenommen wird, dass sie auf der Ur-Erde vorkamen. Die Uratmosphäre der Erde bestand aus Ammoniak, Methan, Kohlendioxid und Wasser in Form von Gas und Wasserstoff. Es herrschten viele Gewitter, und über die Zwischenstufen Formaldehyd und Blausäure entstanden schließlich die Grundbausteine des Lebens: die ersten Aminosäuren. Dies konnte Miller in seinem als »Ursuppen-Experiment« berühmt gewordenen Versuch simulieren, es bildeten sich tatsächlich Aminosäuren, nachdem er seiner Suppe einen elektrischen Funkenschlag als Nachbildung von Blitzen zugesetzt hatte. Die Grundbausteine des Lebens waren geschaffen!
Damit war der Anfang zum Eiweiß gemacht. Mit Hilfe geeigneter Katalysatoren war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Lebewesen auf der Bildfläche erschienen. In der biochemischen Wissenschaft war es der Durchbruch, erstmals konnte schlüssig bewiesen werden, dass aus anorganischen Elementen organische Verbindungen entstehen können, die die Basis des Lebens sind. Dieser Vorgang konnte jederzeit wissenschaftlich reproduziert werden, eine Grundbedingung eines Beweises in wissenschaftlicher Hinsicht. Heutzutage wird dieses Experiment bereits von Schülern im Unterricht durchgeführt. So können sie sich anschaulich von der Entstehung der Welt, der ersten Lebewesen und schließlich des Menschen ein Bild machen. Da diesen Vorgängen beachtliche Zeiträume zu Grunde liegen, ist noch eine Menge Phantasie erforderlich, um den Prozess in allen Details nachvollziehen zu können. Doch vom Grundprinzip ist es möglich, auch wenn niemand so genau weiß, wie lange die Suppe kochen musste. Aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter stören, auf ein paar hundert Millionen Jahre kam es damals nicht an. Hauptsache, das Ergebnis kann sich später einmal sehen lassen!
Das Experiment wurde anschließend von unabhängigen Wissenschaftlern wiederholt, und sah im Prinzip stets gleich aus: Die bereits angesprochenen - vermuteten - Komponenten in der Uratmosphäre der Erde, Ammoniak, Wasser, Methan und Wasserstoff wurden elektrischen Funken ausgesetzt, wodurch Blitzschläge simuliert wurden. Die dann kondensierten Gase wurden in dem Urozean, was im Experiment einfaches Wasser war, aufgefangen und durch Erhitzen wiederum verdampft. Dadurch gelangten sie aufs Neue in den Kreislauf in der Atmosphäre mit ihren Blitzen. Wurde dieses in sich geschlossene System nun eine Woche unter diesen Bedingungen gehalten, bildeten sich in der wässrigen Mischung komplexe organische Verbindungen, darunter Aminosäuren, Zucker und Fettsäuren.
Am 15. Mai 1953 wurde das Experiment in der Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlicht und erreichte so die Öffentlichkeit. Auf Grund der elektrischen Einwirkungen wurden auch Parallelen zu Frankenstein gezogen, das Thema wurde in Comics, Filmen und in Romanen aufgegriffen und verarbeitet. In den nächsten Jahrzehnten variierte Miller seine Versuchsanordnung um winzige Nuancen und perfektionierte so das Geschehen und die Theorie der präbiotisch-chemischen Evolution, dem Ursprung des Lebens. Als er 2007 starb, war das Medienecho gewaltig.
Dank Millers Arbeit war die Grundlage geschaffen, und heutzutage findet man sämtliche Details zum Miller-Urey-Experiment im Internet. Wem das alles jedoch ein wenig technisch vorkommt und Physik und Chemie nicht zu seinen Lieblingsfächern in der Schule zählte, der sei beruhigt. Mit dem Experiment befanden wir uns zwar schon ein gutes Stück in der Chemie, Physik und Biologie, doch im Leben finden sich genug Analogien für Nicht-Naturwissenschaftler. Dafür machen wir auf unserer Reise mal wieder einen kleinen Abstecher in meine Schulzeit. Dort gab es Dinge, die einen geläufigen Vergleich erlauben:
Читать дальше