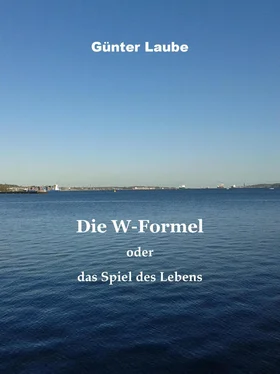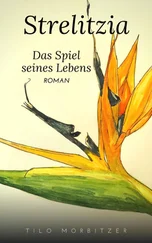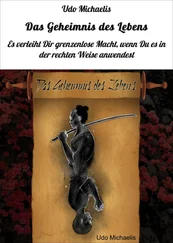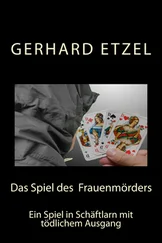Nun gilt das nicht nur für Deutschland, sondern überall auf der Welt: Auch das Dschungelkind ging zur Schule - und musste sogar Hausaufgaben machen. Sehr zum Leidwesen der einheimischen Spielgenossen, die draußen herumtollten. In Indonesien gab es Lehrer aus den USA mit englisch-sprachigen Materialien. Ergänzt durch ihre Eltern, die ihnen Deutsch beibrachten, wuchsen die Kinder dreisprachig auf: Indonesisch, Englisch, Deutsch. Später kam dann noch eine vierte Sprache hinzu: Fayu, die Sprache der Eingeborenen. Nach dem Tod eines ihrer Fayu-Freunde verließ das Dschungelkind Ende 1989 West-Papua und flog in die Schweiz. Da auch Sabines Geschwister den Dschungel verließen bzw. schon verlassen hatten, und die Mutter der Dschungelkinder nun nicht mehr ihre eigenen Kinder versorgen musste, war Zeit und Platz für den nächsten Schritt: Sie begründete eine Schule für die Fayu. Bald darauf konnten die Fayu-Kinder etwas, was die Erwachsenen nicht konnten: rechnen, lesen und schreiben.
In der Tragikomödie »Wenn der Vater mit dem Sohne« tritt Heinz Rühmann alias Teddy Lemke als Ziehvater und Lehrer in Erscheinung: Für ein Kind zu sorgen, es zu lieben und groß zu ziehen, auch wenn es nicht sein eigenes ist, und es dann wieder an die Mutter abgeben zu müssen, verlieh der Geschichte einen Hauch von Tragikomödie. Ebenso hatte die Romanfigur Winnetou, die Karl May schuf, Lehrer, und zwar im Wesentlichen drei: Der erste war sein Vater, Intschu Tschuna, ermordet von Weißen aus Gold-Gier, der zweite war Klekhi-Petra, ermordet von Weißen aus Rachsucht unter Alkohol-Einfluss, und der dritte sein (Bluts-)Bruder Old Shatterhand. Letzterer allerdings eher in der Rolle eines Gebers und Nehmers, so lernten beide voneinander, was auch eine Frage des Alters war.
Es gibt also grundsätzlich Lehrer, die wir alle kennen: unsere Eltern. Und ebenso grundsätzlich besteht ein Lehrer-Bedarf, auch wenn wir dies als Kinder nicht immer einsehen mögen. Und es gibt einen Lern-Bedarf. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!
III.2 Der A-Modus
An diesem Punkt unserer Reise wollen wir kurz innehalten und bilanzieren: Wir haben nachvollzogen, dass es einen Lehrer- und einen Lernbedarf gibt. Des Weiteren haben wir ergründet, dass man nicht automatisch schlauer wird. Doch wie sieht es nun mit der Evolution aus? Immerhin ist es selbst bei blühender Phantasie nur schwer vorstellbar, dass der erste Mensch von einem Affen unterrichtet wurde und die ersten Vokabeltests von einem Tier korrigiert wurden, das weder schreiben, noch rechnen oder sprechen konnte.
Und wieso eigentlich der erste Mensch? Wo kam er her? Gibt es in diesem Bereich einen Automatik-Modus, gewissermaßen für die Zellen im Kleinen? Denn im Großen funktioniert der Automatik-Modus nicht, wie wir am Beispiel des L-Bedarfs gesehen haben. Also, wie kam der erste Mensch auf die Welt?
Zur Klärung dieser Frage kommen gemäß Evolutionstheorie zwei Möglichkeiten in Betracht: Er wurde von einem Affen geboren, oder ein Affe verwandelte sich quasi in einen Menschen. Wenn auch in einen eher primitiven. Und damit sind wir wieder beim Übergang vom Affen zum Menschen, denn das ist das entscheidende Kriterium, in der Wissenschaftsszene spricht man vom »Missing Link«, und in der Tat ist dies die zentrale Frage: Wie entsteht aus einem Affen ein Mensch? Und aus zwei Affen zwei Menschen? Dieser Gedankengang animiert zum mathematischen Knobeln: aus X Affen X Menschen?
Fazit: War ein Affe so weit entwickelt, dass er zu einem Menschen werden konnte, inklusive Erwerb der menschlichen Intelligenz, der Fähigkeit der Sprache, des Denkens und des Transformieren des Blutes? Oder waren es mehrere Affen, die diesen Prozess durchmachten?
Tja, eine harte Nuss, denn sowohl für die eine als auch für die andere Variante gibt es keine Beweise, sondern es stellt sich im Gegenteil die Frage, warum dieser Prozess dann heute nicht mehr vollzogen wird? Denn nur das wäre ein Beweis. Auch Affen entwickeln sich schließlich weiter gemäß Evolutionstheorie. Wenn auch nicht täglich, aber schon ein paar Mal im Jahr könnte man also eigentlich davon ausgehen, dass so ein Sprung vom Affen zum Menschen zu beobachten wäre. Bei früheren Besuchen in Zoos und Tierparks habe ich indes nie einen solchen Vorgang beobachtet oder davon gehört, und auch heutzutage ist ein derartiger Sprung dort nicht zu verzeichnen.
»Für mich war der Dschungel wie ein Zoo, nur dass die Tiere frei herumliefen«, schreibt Sabine Kuegler, doch auch sie hat nie beobachtet, wie aus einem Affen ein Mensch entstand, sondern nur, dass Tiere Nachkommen gleicher Art hervorbrachten. In Zoos und Tierparks müssten die Affen doch eigentlich weiter entwickelt sein als in freier Wildbahn. Sozusagen ein bisschen zivilisierter, doch hat noch niemand einen Beweis zur Untermauerung dieser Theorie vorgelegt.
Ein bisschen erinnert mich die Vorstellung ja an den Film »Jurassic Park«, in dem Wissenschaftler die DNS von vor Jahrmillionen ausgestorbenen Dinosauriern aus einem in Bernstein gefangenen Moskito gewinnen können und so in unserer heutigen Zeit neue Exemplare hervorzubringen im Stande sind. Denn nur Gleiches kann Gleiches hervorbringen. Zellen entstehen aus Zellen, es gilt das Prinzip der Zellteilung: Eine Zelle teilt sich in zwei andere, doch die sind der Mutterzelle ähnlich, oder wie der Lateiner sagt: »Omnis cellula e cellula«.
Dem Problem der Menschwerdung gehen weltweit zahlreiche Forscher nach, und im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig arbeiten rund 400 Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen unter dem Leitmotiv: »Was macht die Einzigartigkeit des Menschen aus?«
Genetiker, Sprachforscher, Biologen, Psychologen und Paläontologen arbeiten dort interdisziplinär, und sie haben festgestellt, dass die Menschen »99 Prozent ihrer Gene mit dem Schimpansen gemein haben. Doch das ist nicht das Entscheidende. Interessant ist das eine Prozent, das sich unterscheidet, und die meisten Unterschiede finden sich in den für das Gehirn zuständigen Erbgutabschnitten«.
»98,4 Prozent der genetischen Informationen zwischen Mensch und Schimpanse sind gleich«, stellte auch Bill Bryson fest, doch ist diese Sichtweise vielleicht zu allgemein, müssen wir spezieller werden, um ein Prinzip für die W-Formel aufzudecken?
Im Alter von 13, 14, 15 Jahren, sprich in der Pubertät, begannen sich die Kinder nachhaltig zu individualisieren. Bei uns zeigte sich dass dadurch, dass ein Schüler eines Tages mit Jacke im Unterricht saß. Er zog sie einfach nicht aus. Unerhört! Das war so cool, dass wir anderen Jungs es alsbald nachmachten. Mädchen übrigens auch. Ein anderer Aspekt zeigte sich im Weg des geringsten Widerstands, eine Art »Bequemlichkeits-Weg«. Gerade soviel Hausaufgaben wie nötig, dann ab zum Cowboy-und-Indianer-spielen.
Klar, ich habe auch lieber Fußball gespielt als Latein-Vokabeln gelernt. Aber ich bin damals eigentlich nie so richtig ins Extreme verfallen. Noch nicht. Das habe ich mir für die zehnte Klasse aufgehoben. Wie wir gesehen haben. Doch zurück zum Allgemeinen und Speziellen: Die Genealogie, die Familienkunde, ist ein Wissenschaftsbereich, der die Abstammung des Menschen von seinen Vorfahren untersucht. Es ist eine spannende Geschichte, manche Menschen können ihren Stammbaum über Jahrhunderte zurück verfolgen. Doch an welcher Stelle soll da der Affe ins Spiel gekommen sein?
Helen Keller lernte zunächst in der Natur, sehr zur Freude ihrer Lehrerin Anne Sullivan, die die Natur als beste Lehrmeisterin ansah. Doch sie fürchtete sich auch ein wenig. Wie sollte sie ihr gegebenenfalls klar machen, woher das Baby, ihr Schwesterchen gekommen war? Oder andere Babys? Also wie erklären Sie einer blinden und taubstummen Siebenjährigen, woher die Menschenbabys kommen? Gelegenheit, danach zu fragen, bot sich Helen durchaus, zum Beispiel in ihrer »Warum«-Phase, die auf die Phase des Zählens folgte. Damals wurde alles gezählt, was ihr unter die Finger kam, im Haus und im Garten. So lernen Kinder. 100 Tage nach Anne Sullivans Ankunft in Tuscumbia kannte Helen bereits über 100 Wörter. Und je mehr Wörter sie kannte, um so mehr lernte sie kennen und konnte ihren Gedanken Ausdruck verleihen, sich mitteilen, die Dinge ergründen. »Warum?« wurde ihre Lieblingsfrage für über zwei Wochen, und ihre Erzieherin, ihre Mutter und ihre beiden älteren Brüder James und Simpson hatten alle Hände voll zu tun, die Fragen zu beantworten.
Читать дальше