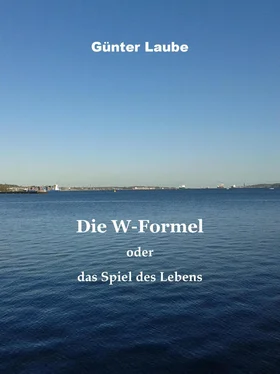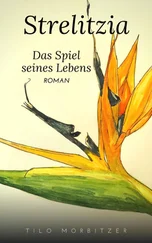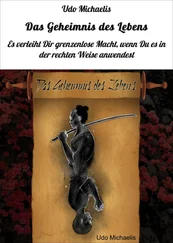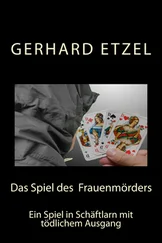Ohne den Sprung von einer Anzahl von Atomen hin zu einem Molekül und schließlich zu einer Zelle, also im Grunde von der anorganischen zur organischen Chemie und zur Biologie, wäre das Leben nicht entstanden. »Bio« stammt aus dem Griechischen und bedeutet »Leben«. Die organische Chemie, die Welt des Kohlenstoffs, ohne den kein Leben denkbar wäre, ist ein großes Feld, und lässt sich doch halbwegs übersichtlich strukturieren. Es gibt kettenförmige und ringförmige Kohlenstoffverbindungen, und die kettenförmigen lassen sich in fünf Gruppen aufteilen: in Paraffine, Olefine, Fettsäuren, Aldehyde und Alkohole. Und wie eng ähnliche Stoffe miteinander verwandt und doch verschieden sind, zeigt sich in einem bekannten Beispiel gerade am Alkohol: Der Ethylalkohol, C2H5OH hat nur ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome mehr als der Methylalkohol, CH3OH, und ist im Gegensatz zu diesem genießbar. Er entsteht durch die Vergärung von Zucker und Hefe, wir kennen es aus der Brauerei. Methylalkohol hingegen ist überhaupt nicht genießbar, er führt zur Erblindung und zum Tod.
Zu den Aldehyden zählen die Zucker, und eine bekannte Variante eines Aldehyds ist Formaldehyd. Die ringförmigen Kohlenstoffverbindungen wiederum begegnen uns täglich beim Autofahren. Benzin besteht aus mehreren Stoffen, einer ist Hexan. Es enthält sechs Kohlenstoff- und 14 Wasserstoffatome, die sich ringförmig anordnen, so wie das Benzol. Und auch andere Energieressourcen wie zum Beispiel Kohle und Erdöl sind Kohlenstoffverbindungen, die auf dem Ringprinzip beruhen. In »Chemie - Motor der Zukunft« schrieb Walter Greiling bereits in den 1960er Jahren, dass »der ganze große Reichtum an Kohlenstoffverbindungen in der Natur einmal durch den Körper von Lebewesen hindurchgegangen ist, von Lebewesen aller Art, Pflanzen, Tieren und Mikroben. Der Torf, die Braunkohlen, die Steinkohlen, das Erdöl, alles sind Reste von Leibern unzähliger Pflanzen- und Tiergenerationen.«
Es scheint eine eigene, jedoch in manchen Teilen durchaus populäre und bekannte Welt zu sein, obzwar vielfältig und komplex, doch wenn man das Prinzip kennt, wird es durchschaubar. Diese Erfahrung machte auch Helen Keller, die das Wachstum einer Pflanze live miterleben sollte: Eine Tulpenzwiebel wurde in einen Topf gesetzt und dieser in ihr Zimmer gestellt. Nach getaner Arbeit holte Helen ihre Puppe, ging in den Garten, grub sie in einem Artischockenbeet ein und erklärte der Familie: »Puppe wachsen!«
Es war nicht einfach, Helen den Unterschied zu erklären, geschweige denn begreifbar zu machen. »Man musste es der Zeit überlassen«, sagte Anne Sullivan. »Kinder wachsen nicht aus der Erde«, stellte Helen später fest und wollte wissen, wer »Mutter Natur geschaffen hat?«
Eine weitere Kernfrage wurde auch Momo gestellt, nämlich wann sie denn geboren sei, und sie sagte nach kurzer Überlegung: »Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer schon da.« Dies ist aus wissenschaftlicher Sicht natürlich keine erschöpfende oder befriedigende Antwort, also wird geforscht. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse:
Nach Ansicht von Wissenschaftlern liegen die Anfänge der Entstehung des Lebens, sprich der Evolution, rund vier Milliarden Jahre zurück. Auf der damals noch jungen Erde entwickelten sich in einem langen Prozess allmählich einfache Substanzen zu immer komplexeren Gebilden. Der erste Organismus, die erste Zelle entstand, und damit deutlich mehr als nur ein paar Atome oder Moleküle, denn wie wir aus dem Biologie-Unterricht noch wissen, beherrschen Zellen das Phänomen der Zellteilung. Und so kann die Geschichte losgehen.
Bis hin zur Bildung von Aminosäuren, Eiweißen, RNS und DNS war es dann nur noch eine Frage von ein paar Millionen Jahren. Macht aber nichts, wir hatten damals noch Zeit, keine Termine oder so, denn wir waren noch nicht auf der Weltbühne erschienen. Man, und das waren in diesem Fall die Zellen, musste sich nur durchsetzen.
Was Charles Darwin so formulierte: »Dass jedes organische Wesen ums Dasein kämpfen muss und großer Vernichtung ausgesetzt ist«, aber »der Kräftige, der Gesunde und Glückliche überlebt« und kann sich vermehren. Daraus ergibt sich die Entstehung der Arten, die Evolution der Lebewesen. Aller Lebewesen, bis hin zum Menschen. Was einige Zeit dauerte. Im Spiegel -Interview erläuterte Stephen Jay Gould 1998 den Lauf der Evolution: »Vor sechs Millionen Jahren gab es in Afrika ein Geschlecht von Menschenaffen, das uns hervorgebracht hat.«
Die Wiege der Menschheit liegt also in Afrika, genauer gesagt in Nordäthiopien. Die so genannte Out of Africa-Theorie findet ihr greifbarstes Indiz in dem Fund von Lucy.
Lucy? Kennen Sie nicht?
Lucy war eine junge Frau, die im heutigen Äthiopien starb und deren Skelett in einem bemerkenswert guten Zustand erhalten geblieben ist. Bemerkenswert deshalb, weil sie vor über drei Millionen Jahren gelebt hat. Sie wird zur Spezies Australopithecus afarensis gezählt, und ihre Entdecker, die Anthropologen Johanson und Gray, hörten am Abend der Entdeckung den Beatles-Titel »Lucy in the sky with Diamonds«. So kam die etwa Zwanzigjährige posthum zu ihrem Namen und wurde in der Wissenschaftsszene eine Berühmtheit. Bereits ein bis zwei Millionen Jahre vor ihr probierten die ersten Affen den aufrechten Gang aus, um ihn langfristig beizubehalten. Und genau hier wird es interessant: Der Übergang vom Affen zum Menschen. Denn mit den ersten Menschen wurde es Zeit für die berühmtesten 40 Wochen Wachstum, eindrucksvolle Bilder wurden im GEO -Heft vom Juli 2001 in Bezug zum Leben vor der Geburt gezeigt. Von einer Ansammlung von Zellen bis zum Baby und zum Kind, ein Wunder der Natur!
Die Entwicklungsstadien sind heutzutage per Ultraschall zu verfolgen, und in der Regel lässt sich so auch das Geschlecht des Nachwuchses frühzeitig erkennen - schon vor der Geburt. Auch was schadet oder nützt und den Nachwuchs an Eindrücken und Empfindungen prägt, lässt sich von Forschern nachweisen. Somit ist der Evolutionsprozess im alltäglichen Leben zu beobachten, und in der Wissenschaftsszene gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Details zur Evolutionstheorie.
Einige werden wir jetzt betrachten, um unsere Fragen zu klären: Wie hat sich der Mensch zu dem entwickelt, was er heute ist? Was macht den Menschen zum Menschen, und was unterscheidet ihn vom Tier? Und wer war der erste Mensch?
III.1. Der L-Bedarf
Heute ist Sonntag. Der große Tag. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen, so aufgeregt bin ich. Am liebsten würde ich jetzt schon aufstehen, doch es ist noch zu früh. Meine Eltern schlafen noch.
Nachher geht's zum Fußball. Und es ist nicht nur ein Spiel, oh nein! Wir spielen ein Turnier. Es kommen viele Mannschaften, sogar eine aus Dänemark. Damit ist das Turnier international besetzt. Natürlich macht es mehr her, gegen die zu spielen - und erst zu gewinnen! -, als wenn man gegen die Jungs von Kleinkleckersdorf aus'm Nachbarort spielt. Die man womöglich auch noch am nächsten Tag in der Schule sieht. Aber so etwas ist international, weltmännisch, global! Ruhm, Ehre und Macht sind uns gewiss!
Doch einen Tag später geht's wieder zur Schule. Eine Klausur steht auf dem Programm, und gewisse Gedanken ziehen wieder durch meinen Kopf: Der Lehrer hatte den Gedanken schon, als er uns die Aufgaben gestellt hat ...
Müssten wir die denn jetzt nicht auch haben? In Verbindung mit den Aufgaben? Ja, jeder Schüler müsste die eigentlich haben. Das könnte doch ein Grundprinzip sein, denn auch andere Lehrer stellen ihren Schülern ähnliche Aufgaben. Immerhin gab es allein in Deutschland im Schuljahr 2005/06 667.711 Lehrer. Und wenn man im Anschluss an die Schule ein Studium beginnen möchte, kann man sich heutzutage im Internet über die Hochschulen in aller Welt informieren. Weltweit sozusagen. Wie uns Barbra Streisand im Film »Is' was, Doc?« mitteilte, fanden sich bereits 1972 1.145 höhere Bildungsanstalten in den Vereinigten Staaten.
Читать дальше