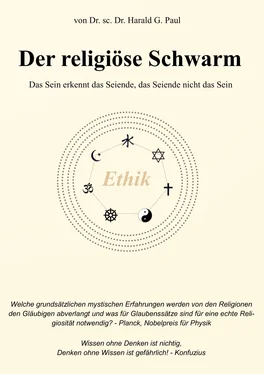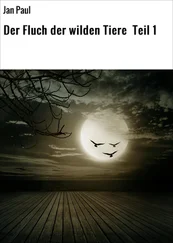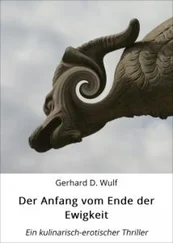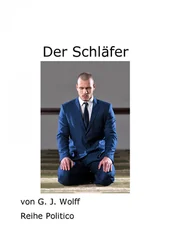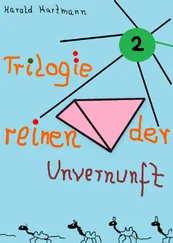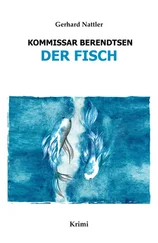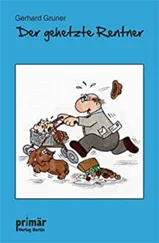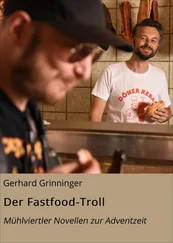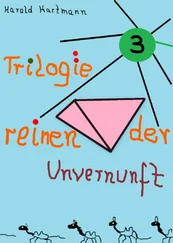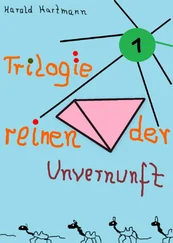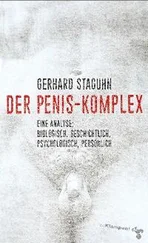Wie bekannt uns das vorkommt!
In Übereinstimmung mit der für Menschen erfassbaren, ethischen Essenz Gottes ist im Judentum das Lebendige, das Leben zu schützen. Rache ist verboten, Feindesliebe wird gefordert. Moderner gesprochen, heißt dies: „Kooperation und Deeskalation vor Aggression“. Allerdings ist im jüdischen Glauben die das Leben verteidigende Gewalt, demzufolge in Notwehrsituationen, erlaubt. Das kooperative Prinzip soll wehrhaft bleiben. „Keine Gewalt“ hat hier keinen absoluten, sondern einen relativen Charakter.
Wie in der Tora geschildert, erhielt Moses von Gott grundlegende Gesetze auf dem Berg Sinai ([26], 2. Moses ab Kap 19), zum Beispiel die zehn Gebote ([26], 2. Moses ab Kap 20 Vers 1 - 17), die die Kernvorschriften für das sozial ausgewogene Zusammenleben der Menschen, ergo ein Gott gefälliges Leben regeln sollten. Diese zehn Gebote fundieren das, was wir bis heute als moralische Normative empfinden, oder etwas komplizierter ausgedrückt, was wir als die Summe der gesellschaftlichen Normen des Zusammenlebens betrachten. Der Vorgang des Offenbarens dieser zehn Gebote war begleitet von Irrungen und Wirrungen in den jüdischen Stämmen – verbunden mit entsetzlicher Gewalt. Vielen sind die Vorgänge um die Anbetung des Goldenen Kalbs, während der Abwesenheit von Moses auf dem Berg Sinai, nicht unbekannt. Die Stämme waren verführbar durch Gold und gegenständlich, leicht anschauliche Götzen der Begierden, wie alle Menschen … bis heute.
Nun ja, wer bewältigt schon die harmonische Eintracht zwischen dem ethischen Gefühl und dem ethischen Handeln. Wem gelingt es, konsequent ein Leben ohne „Sünde“ zu führen? Deshalb gibt uns die göttliche Wesenheit, im jüdischen Glauben, die Möglichkeit der Vergebung unseres sündhaften Denkens und Handelns, was ja nicht immer Vergessen heißen muss. Tut der Mensch Buße, so können ihm seine Sünden nachgesehen werden. Der Kern der Reue darf kein Lippenbekenntnis oder intellektuelles Bedauern seiner Handlungen sein, sonder muss das klare Gefühl eines getanen Unrechtes zeigen. Somit kann letztendlich jeder Mensch nur selbst die Wahrhaftigkeit seiner Buße bestimmen und ob ihm seine kleinen oder großen Übeltaten verziehen werden können.
Diese „Vergebung der Sünden“ kennen, auf den ersten Blick, einige andere Weltreligionen nicht. Im Hinduismus ist getan, gleich getan und nicht rückgängig zu machen. Die Taten eines Lebens fließen zusammen zum Karma des Selbst. Damit baut jedes Individuum sein selbstbestimmtes Schicksal auf, beeinflusst deshalb die Art seiner Wiederkehr und seinen Verbleib im Kreislauf der Wiedergeburten und seinem Leiden. Die daraus folgende Evolution oder Degeneration des geistigen Selbst „Seele“, ist eigenverantwortlich. Allerdings kann, bei genauerer Betrachtung, diese Form der Selbstbestimmtheit durchaus in den Vorstellungen des Judentums über die „Vergebung von Sünden“ ihren Platz finden. Der Glaube an eine „Vergebung von Sünden“ ist ja gebunden an die wahrhaftige und damit eigenverantwortliche Buße. Diese souveräne Sühne regt eine Evolution der im Selbst verankerten ethischen Werte an und treibt die Annäherung an die göttliche Ethik voran.
3.1.4 Die Schöpfungsgeschichte
Die großen, monotheistischen Weltreligionen, aus zum Teil unterschiedlichsten und getrennten Kulturregionen, haben eines gemeinsam: Sie führen die Entstehung der für uns denkbaren Welt auf einen „göttlichen Erzeugungsprozess“ zurück, der in mehreren Stufen eine „göttliche“ Homogenität und Isotropie alles Seienden, eine absolute Symmetrie alles Seienden, in Unterscheidbares aufbrach.
Die Lehren der Tora beginnen mit der Genesis, mit der Erschaffung des für uns denk- und beschreibbaren Seienden und dem Anfang einer Menschwerdung auf dieser Erde, mit dem Mythos von einer Eva und einem Adam. Die Schöpfungsgeschichte über Adam und Eva entspricht zwar nicht den gegenwärtigen Erkenntnisstand in Bezug auf die biologische Evolution und der Herausbildung der verschiedenen Zweige im Stammbaum des Menschen – kann aber in Form einer Metapher als „wahr“ geglaubt werden, wenn sie als der Beginn einer zu definierenden „geistigen Menschwerdung“ interpretiert wird.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Naturwissenschaften uns geeignetere Erklärungen über die Entstehung der Welt, der Evolution des Lebens und der Herausbildung der Menschheit lehren als die Bibeltexte, - sofern man sie denn wortwörtlich nimmt. Niemand, der vertraut ist mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften, glaubt, dass unser Kosmos von einer Superintelligenz per „Wochenfrist“ konstruiert wurde und er weiß, dass die Entwicklung zum heutigen Menschen ein jahrmillionenlanger Weg der Evolution war.
Aber, man halte sich vor Augen: Mystik und Wissenschaft haben unterschiedliche innere Haltungen zur Welt. Mystik sucht nach persönlichen Erfahrungen mit der, sich in der letzten Wahrheit über das allerfassende Sein offenbarenden, einzig göttlichen Wesenheit. Sie trachtet nach „vernünftigen“ Welterfahrungen. Wissenschaft sucht Welterklärungen. Beide müssen sich von einander abgrenzen und wo es möglich scheint, ergänzen. Das Eine hat im Anderen nichts zu suchen.
Die Schöpfungsgeschichten der Bibel schildern die im Altertum und in der Antike gemachten Erfahrungen und „Begegnungen“ mit einer als göttlich empfundenen Natur, die auf einen „Anfang“ des Naturgeschehens ausgedehnt wurden. Gustav Mensching [27] schrieb: „Aus dieser erlebnishaften Begegnung gestaltet die mythische Fantasie und die fantastische Spekulation der menschlichen Frühzeit Vorstellungen, Gedanken und Bilder über den Ursprung und den Bau der Welt.“ Und weiter meinte er: „Der Mythos ist nicht primär Erklärung der Welt, sondern er ist der vielfach fantastische Ausdruck einer Begegnung mit heiligen Mächten in und an der Welt.“ Die Schöpfungsgeschichte sollte somit nicht wortgetreu und eins zu eins als Beschreibung des „Anfangs“ der Welt genommen werden. Wenn wir die Erfahrungen des Menschen mit der als göttlich empfundenen Natur und das Verspüren eines „Anfangs“ unserer Welt nachvollziehen möchten, wenn wir den „Kern“ der Schöpfungsgeschichte erkennen wollen, dann müssen wir Gegenwartsmenschen sie von der mythischen und bildhaften Sprache der menschlichen Frühzeit entkleiden. Was bleibt aber danach übrig? Mutmaßlich eine modern interpretierbare, von „urzeitlichen“ Metaphern befreite Geschichte des „Beginns“ einer Evolution des für uns erfassbaren Seienden, - die naturgemäß nicht als physikalische Theorie einer urknallartigen Seins– und Weltschöpfung verstanden werden kann und darf. Die Genesis der Bibel ist kein wissenschaftliches Werk. Sie schildert, in der Sprach- und Vorstellungswelt des Altertums, einen für den damaligen Menschen denkbaren Anfang des für ihn erkennbaren Seins. Um den Kern der Schöpfungsgeschichte aufzudecken, müssen wir sie befreien von der Sprach- und Vorstellungswelt des Altertums und sie reduzieren auf die eigentlichen Aussagen.
Versuchen wir beispielhaft, auf eine zugegeben recht spekulative Weise, eine rationale Deutung der Schöpfungsgeschichte in der Genesis der Bibel. Sie soll nur die Möglichkeit der Interpretation demonstrieren, die uns diese Geschichte einräumt, wenn wir sie von der mythischen Fantasie und fantastischen Spekulation der menschlichen Frühzeit entkleiden. Sie soll auf die Weisheitslehren aufmerksam machen, die als Kernaussagen in ihr ruhen.
Im 1. Buch Mose Kap. 1 Vers 1 ff. der hebräischen Bibel [26] steht gleich zu Beginn: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“.
Es ist als Erstes anzumerken, dass hier nicht der Himmel und die Erde unserer irdischen Welt gemeint sind. Denn zufolge der zu dieser Zeit vorherrschenden, vorderorientalischen Auffassung, wurde unter „Himmel und Erde“ ein dreigeteiltes „Himmlisches All“ verstanden. Dieses, so stellte man es sich damals vor, bestand aus den „Himmelszonen“, dem „erdartigen Firmament“ und dem „himmlischen Himmel“. (Siehe S. 16 bei Mensching, 1955 [27]; das am „Anfang“ erzeugte dreigeteilte „Himmlische All“ wird bei Weidner [28] in Himmel, himmlisches Erdreich und Himmelsozean übersetzt und interpretiert. Der Begriff „Erde“ hat hier nichts mit unseren terrestrischen Räumen zu tun!) Dieses dreigeteilte „Himmlische All“ wird vor und unabhängig von dem, später entstehenden, dreigeteilten „irdischen All“ geformt. Das irdische All, so stellte man es sich damals vor, bestand aus dem Meer, der Erde und dem Lufthimmel. Im monotheistisch angelegten Schöpfungsbericht des Alten Testaments wird das, in der vorderorientalischen Auffassung, am „Anfang“ geschaffene dreigeteilte „Himmlische All“, auf ein elementar Zweigeteiltes „Himmel und Erde“ reduziert. Das bedeutet, die Aussage des ersten Schöpfungsaktes besagt: Es wurde etwas prinzipiell Verschiedenes, sich grundsätzlich Ausschließendes aber Zusammengehörendes, geschaffen. Hierin liegt eine tiefe Weisheit. Die Gesamtheit des Seins offenbart sich anfänglich in zwei duale Daseinsformen „Himmel“ und „Erde“. Noch einmal zur Erinnerung: Hier hat die Bezeichnung „Erde“ nichts mit unseren irdischen Gefilden zu tun, sondern sie dient allein als Metapher für irgendetwas „Erdartiges“, etwas grundsätzlich Gegensätzliches und Verschiedenes in Bezug auf das „Himmelartige“. Damit sagt uns das Alte Testament, entkleidet von den mythischen Fantasien und Erfahrungswelten der menschlichen Frühzeit, dass aus der Gesamtheit des Seins eine elementare Dualität zwischen dem Himmelartigen und dem Erdartigen aufbrach. Beides waren gegensätzliche, sich ausschließende, aber sich ergänzende Seinsformen. Das göttliche Sein brach auf, erzeugte eine Trennung zwischen der geistigen Manifestation („Himmelartiges“) und der materiellen Manifestation („Erdartiges“) alles Seienden. Die prinzipielle Dualität zwischen „Geistigem“ und „Materiellen“ bzw. „Information“ und „Energie“ reflektiert den geistigen Austausch unter den materiellen Objekten, die Wechselwirkungen des Seienden, den Informationsaustausch in der für uns beobachtbaren und erfassbaren Natur. Das einheitliche, einzige „göttliche Sein“ manifestierte zwei Aspekte seines Daseins, die „Information“ und die „Materie“. Dass wir Menschen nur in dieser Dualität denken können und nicht in der Lage sind die göttliche Wesenheit als ein vorgeordnetes Sein zu empfinden, ist deshalb wenig erstaunlich.
Читать дальше